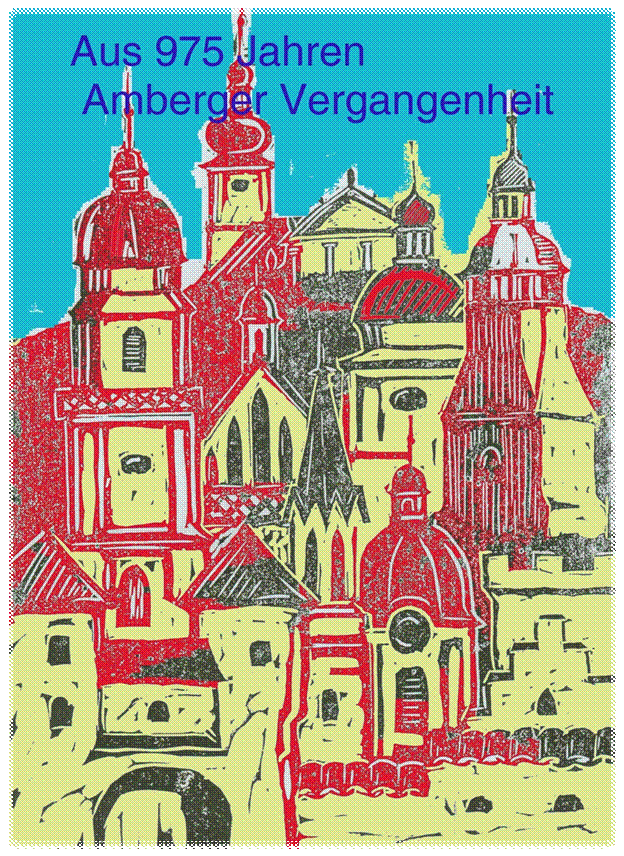
Sagen um die verschwundene Burg. 8
Ein seltsames
Geschichtsbuch. 15
Ein kostbares Pergament 19
Ein königlicher Freund
Ambergs 23
Friedrich der Siegreiche
– Der böse Fritz 28
Amberger Treue – Amberger
Blut 28
Ein guter Vormund. 28
Eine kurze aber
erfolgreiche Regierung – Ludwig IV. 28
Vom Vormund zum Kurfürsten. 29
Amberg und die Arrogation. 33
1452 – Zögerliche
Anerkennung Friedrichs 34
Erfolgloses Verhandeln
1453. 35
Schmerzhafter Freitag
1453. 36
Interdikt in Amberg. 39
Winterfeldzug gegen
Amberg. 42
Strafjustiz am 5. Februar
1454. 44
Einschränkung städtischer
Rechte. 45
Behandlung „etlicher
Abtrünniger“ 49
Amberg unter Friedrichs
Herrschaft 52
Friedrichs oberster
Geschützmeister, ein Amberger 55
Friedrichs Probleme. 58
Philipps Hochzeit in
Amberg. 61
Kurfürst Philipp. 62
Aufruhr Fehler! Textmarke nicht
definiert.
Hans Klopfer, Bürger zu
Amberg. 66
Notvolle Jahre in Weiden. 67
Reich durch Heirat 68
Besitzer einer Kapelle. 69
Bürger zu Amberg. 70
Klopfermesse St. Wolfgang. 72
Bürger unter Bürgern. 73
Die Klopferstiftung. 74
Wenn Fürsten heiraten. 78
Vilsabwärts Eisen,
vilsaufwärts Salz. 83
Rechtsstreit um
beschädigte Brücke. 86
Wie der Eselsbeck seinen
Namen bekam.. 98
Der ungetreue
Fuchssteiner 100
Die festeste Fürstenstadt 103
Das "Amberger
Lärmen" 108
Kurfürst Friedrich's
Gewaltritt. 114
Das große Sterben - Die
Pest in Amberg. 120
Neue Heimat in Amberg,
1649. 129
Ein Hochaltar für St.
Martin. 134
Der Amberger Knödel 140
Der Heideschuster Lind
und die Sebastianskirche. 147
Die Belagerung Ambergs im
Österreichischen Erbfolgekrieg 1745. 153
Zuversicht in Amberg. 153
Winterfeldzug gegen
Amberg. 154
Gefechte zwischen
Ullersberg und Kastl 157
Die erste Belagerung. 159
Beängstigende
Vorbereitungen, eine bange Nacht 162
Die Entscheidung,
Neumarkt 164
Die zweite Belagerung. 166
Ausfall der Amberger 169
Ende der Belagerung. 171
Abmarsch der Garnison -
Kapitulation. 172
Anselm Desing, ein
Universalgenie aus Amberg. 176
Dozent in Salzburg. 178
Baumeister in
Kremsmünster 179
Hunger! Hunger! 185
Hochwasser in der
Altstadt 1784. 194
Bernhardskirche -
Nationaltheater 199
Rezers Ehrentag -
21.09.1848. 208
Amberg und die Eisenbahn. 218
Wasserversorgung Ambergs
bis 1893. 227
Wasser in Amberg. 227
Wasser für den Haushalt 229
Manche Handwerker
brauchten besonders viel Wasser 229
Öffentliche Brunnen in
der Altstadt 231
Die städtische
Wasserleitung. 233
Jesuitenleitung und
andere Privatanlagen. 236
Hygienische Verhältnisse
und Wasserversorgung. 238
Wasser für Ambergs
Krankenhaus 240
Ambergs Wasserversorgung
im 19. Jahrhundert 245
Leitungswasser für Amberg
- 1892/93. 249
Ein Mahnmal aus schwerer
Zeit 256
Das Kümmersbrucker
Gefangenendenkmal 256
1914 – die ersten
Franzosen in Amberg. 257
Menschliche Anteilnahme. 258
Barackenlager
Kümmersbruck – Amberg. 260
Zivilgefangene in Amberg. 260
Aufruf um Hilfe. 262
Sterbefälle und Geburten
im Lager 263
Kriegsgefangenlager für
Franzosen, Russen und Italiener 265
Ums tägliche Brot 267
Ärztliche und religiöse
Betreuung. 270
Arbeiten im Lager –
Freizeit 272
Amberger Lagertheater 275
Arbeitseinsatz der
Gefangenen außerhalb des Lagers 278
Helfer in der
Landwirtschaft 280
Ende des
Kriegsgefangenenlagers 1919. 282
Wer nach Amberg kommt, ganz gleich aus
welcher Richtung, sieht stets als erstes Zeichen der Stadt den Mariahilfberg
mit der schönen Wallfahrtskirche. Früher schaute eine Burg von dieser Höhe aus
weit ins Land. Eine Burg? Wo ist die denn hingekommen?
Schon vor 200 Jahren wussten das die
Amberger nicht mehr genau. Was haben sie nicht alles vom Ende dieser Burg
erzählt. Um 1840 hat Herr Schönwerth diese
Geschichten für seine Sagensammlung aufgeschrieben. Hier eine Zusammenfassung:
Nordöstlich der Bergkirche ist ein
zerklüftetes, muldenreiches Gelände, das um 1800 noch unbewaldet war und die
Hollerwiese genannt wurde. Dort stand in alter Zeit ein großes Schloss, das
zuletzt zwei Ritterfräulein gehörte. Von ihrem Vater hatten sie außerdem das
Klösterl in Amberg und die Orte Raigering und Neumühle geerbt.
Nun lagerte im Keller des Schlosses in
Fässern und Kisten eine riesige Menge Geld und die beiden wollten ihren
gemeinsamen Reichtum teilen. Eine der Schwestern war blind. Die sehende
Schwester holte deshalb ein Metzengefäß, denn abzählen konnte man die Münzen
nicht. Für sich selbst füllte sie den Metzen ordnungsgemäß, für ihre Schwester drehte
sie das Maß um und häufelte die Münzen auf den Boden. Sie forderte sogar die
Blinde auf, mit ihren Händen sich zu überzeugen, dass auch für sie der Metzen
randvoll war. So betrog sie die Blinde. Diese aber tastete zum Schluss die beiden
Haufen ab und merkte schnell den Betrug. Verbittert verließ sie ihr Vaterhaus
und verwünschte es. Da bebte die Erde. Das Schloss versank und ein öder, unfruchtbarer
Erdenfleck nahm seine Stelle ein. Die Blinde verbrachte den Rest ihres Lebens
in Neumühle. Die Habgierige aber ward nicht mehr gesehen.
Vom Untergang der Burg berichtet auch eine
andere Sage. Es hauste auf dem Berg ein schlimmer Raubritter. Er nahm den
Kaufleuten ihre Waren weg und holte den Bauern die Ernte vom Felde. Über dieses
Treiben war seine gute Tochter sehr betrübt. Sie tat alles, um das Unrecht
wieder gut zu machen. Sie half den Beraubten, wann immer sie konnte. Oft hat
sie den Vater gebeten, sein wüstes Treiben aufzugeben, doch er hat sie nur ausgelacht.
Auch auf die Strafe des Himmels wies sie hin, aber der Ritter blieb verstockt.
Schließlich war das Maß seiner Schuld voll. Ein Gewitter zog auf, das den Tag
zur Nacht machte. Als das Unwetter ausgetobt hatte, war das Schloss nicht mehr
zu sehen. Es war in der Erde versunken.

Seitdem sieht man am Sonnwendabend
eine Jungfrau in weißem Gewande bei der Hollerwiese auf einem Stein sitzen.
Neben ihr wacht ein schrecklicher Hund, kohlschwarz, mit feurigen Augen. In den
Zähnen hält dieses Untier den goldenen Schlüssel, der die Schatzkammern der
versunkenen Burg öffnen kann. Den Vorübergehenden winkt die Jungfrau zu, doch
bisher hat es noch niemand gewagt, dem Höllenhund den Schlüssel zu entreißen
und den Raubritterschatz zu heben.
Auch beim Kräuterbrünnerl, dem alten Schlossbrunnen,
ist es nicht geheuer. Zu heiligen Zeiten sitzen auf der Einfassungsmauer zwei
Geister, Mann und Weib, Gesicht und Kleider wie Birkenrinde. Das sind die
Hirtenleute des wilden Ritters, die ihm bei seinen Übeltaten geholfen haben.
Auch sie winken allen zu, die vorbeikommen, ja, sie begleiten diese oft bis zum
Lindenbrünnerl und warten, dass man sie anspricht.
Manche haben beim Kräuterbrünnerl eine
große Herde geisterhafter Schafe gesehen und aus dem versunkenen Schloss eine
wunderschöne Musik gehört. Andere berichten von einer weißen Frau, die eine
Butte mit glänzenden Goldreifen trägt, um Wasser zu schöpfen.
Eine Bäuerin aus Raigering musste
einst in der Christnacht nach Amberg, um einen Arzt zu holen. Ein Irrlicht
führte sie zum Brunnen, und dort erwartete sie gar freundlich die weiße
Jungfrau. Beide schritten durch eine Tür neben der Brunnenstube in den Berg. Sie
kamen in einen Saal. Ein grimmiger Ritter saß dort an einem Tisch und stützte
sich auf sein Schwert. An einem anderen Tisch saßen mehrere Herren in schwarzen
Gewändern und tranken aus großen Humpen. Aus einem düsteren Nebengemach drangen
Klagelaute von Gefangenen. Die Jungfrau kniete sich vor dem Ritter nieder und
zeigte dann der Bauersfrau die Schätze, die der Ritter zusammengeraubt hatte.
Doch vor Schreck konnte die Bäuerin keinen Ton herausbringen. Sie flüchtete aus
dem Saal, ohne auch nur eine der Münzen genommen zu haben. Hätte die gute,
redliche Frau zugegriffen, dann wären die Geister erlöst gewesen.
Ein bekannter Geizkragen hatte es auf
diese Schätze abgesehen. Er suchte zu heiliger Zeit diesen Ort auf und ging mit
der Jungfrau in den Berg und ward nie mehr gesehen.
Die Stelle der versunkenen Burg, also
die Hollerwiese, ist öde und unfruchtbar und nichts wächst auf ihr, denn sie
ist verflucht, berichtet Schönwerth. Die Burg ist allerdings nicht tief
versunken. Würde ein Hahn an der richtigen Stelle scharren, könnte er die
Turmspitze freilegen. Wenn man auf dieser Wiese einen Stein fallen lässt, dann
klingt es dumpf und hohl aus dem Erdengrund, denn nicht nur die Burg liegt
knapp unter der Oberfläche, auch alte, unterirdische Gänge ziehen sich durchs
Erdreich hinunter zum Ziegeltor, zum Schloss Rosenberg und zum Annaberg bei
Sulzbach.

Der Bergfried der Burg
Sicher kommen uns diese Geschichten unglaublich vor. Doch es
stimmt, dass auf dem Berg eine Burg war, und zwar dort, wo jetzt unsere
Wallfahrtskirche steht. In keinem Archiv hat man bisher gefunden, wer sie
errichtet und bewohnt hat. Noch im 14. Jahrhundert tagte die Landschranne auf
dem Berg nahe der Burg, und deren letzter Rest, der mächtige Bergfried, wurde
erst 1702 abgebrochen.
Auf der Hollerwiese stand nie ein Schloss. Das sehr hügel-
und muldenreiche Gelände ist jetzt trotz des sagenhaften Fluches mit schönen
Bäumen bewachsen. Unter der Erde aber gibt es wirklich Hohlräume, und es tönt
an manchen Stellen dumpf, wenn man fest aufstampft. Bereits Wiltmeister
berichtet in seiner Chronik von diesem „Hohlen“ auf der Hollerwiese, die einst
„Hohle Wiese“ hieß. Doch wie entstanden diese Hohlräume?
Man hat schon sehr früh die festen, gelben Sandsteine des
„Ambergs“, so hieß einst der Mariahilfberg, für die Gebäude der Stadt
gebrochen. Hinter der Ruine der alten Burg hat man um 1550 sogar ein Bergwerk
mit Stollen und Schächten angelegt, um an die Steine zu kommen. Man schuf also
einen unterirdischen Steinbruch.
Nachdem dieser aufgelassen wurde, brachen nach und nach
stellenweise die Stollen und der Zugang ein und schließlich versank dieser
seltene Steinbruch unter der Erde in Vergessenheit. Man entdeckte dieses
Bergwerk wieder, als 1978 ein Stollenstück einbrach und man in das alte
Steinbergwerk einsteigen konnte. Außerdem fand man im Staatsarchiv, Akten über
diesen unterirdischen Steinbruch.
Franz Schönwerth, der uns diese Sagen aufgeschrieben hat,
ist in Amberg geboren. Er hat außer den Sagen unserer Heimatstadt auch jene der
gesamten Oberpfalz gesammelt. An ihn erinnert eine Straße im Dreifaltigkeitsviertel.
Jahrhunderte ober- und unterirdischer Steinbruchtätigkeit
haben auf unserem Berg vielerorts Mulden, Gruben, Steilhänge, Abraumhalden und
sogar unterirdische Gänge hinterlassen.

Auch das sagenumwobene Kräuterbrünnerl hat einen
irreführenden Namen. Es erinnert nicht an üppige Kräuter, die einst hier
wuchsen, sondern an den ersten Mesner des Marienheiligtums auf dem Berg. 1662
bezog Sigmund Kreukl das Mesnerhaus und musste über 30 Jahre jeden Tag das
notwendige Wasser an einer kleinen Quelle holen, die bald Kreuklbrünnlein hieß,
und von dem auch im 18. Jahrhundert in den Bergkirchenrechnungen berichtet
wird. Im 19. Jahrhundert wusste man vom Mesner Kreukl nichts mehr, und Kreuklbrünnerl
musste man sinnvoll erklären. Man wandelte „Kreukel“ zu „Kräuter“ um, und das
ergab einen zwar klar verständlichen, aber irreführenden Sinn.
Die Herrnstraße, die zum Rathaus führt, ist aufgerissen.
Neue Kanalrohre sollen eingelegt werden. Die Arbeiter pickeln, und der kleine
Wall gelben Sandes wird immer höher. Wer ins Geschäft geht oder zum Einkaufen,
der bleibt ein bisschen stehen und guckt neugierig in den Graben. Dann geht er
wieder weiter.
Einer aber hat Zeit. Stundenlang steht der Mann schon da und
schaut jedem Schaufelwurf nach. Manchmal bückt er sich auch, hebt ein wenig
Erde auf und zerbröckelt sie mit seinen Fingern. „Was der wohl sucht“, denken
sich die Leute, die vorübereilen.
Jetzt wird die Erde schwarz braun. „Herr Oberregierungsrat,
was ist das für Zeug?“, fragt einer der Arbeiter, der auf einer Schaufel spürt,
wie schwer der schwarzbraune Brocken wiegt. „Das ist Schlacke von den
Eisenschmieden, die früher einmal in unserer Stadt betrieben wurden“,
antwortete Herr Oberregierungsrat Dollacker. Die Arbeiter wundern sich, dass
der Schlackenbrocken so schwer ist.
Ja, damals, im 10. oder 11. Jahrhundert, so alt sind diese
Schlacken sicher, da konnte man das Erz noch nicht so gut ausschmelzen wie
heute. In den Schlacken steckt noch viel Eisen und daher sind sie so schwer.
Die Arbeiter pickeln und graben weiter. Die Schlackenschicht
nimmt gar kein Ende. Jetzt fällt dem Herrn Oberregierungsrat ein Brocken
besonders auf. „Das ist doch keine Schlacke?“, denkt er sich. Er hebt ihn auf
und kratzt mit den Fingern die Erdkruste weg. Neugierig schauen die Arbeiter
zu. „Das ist ja ein Geißhorn!“, lachen sie. „Reich waren die Amberger damals
nicht, wenn sie sich mit Geißen abfretten mussten“, sagen sie und lachen noch
einmal.
Ein hart gebrannter säulenartiger Lehmbrocken rollt über die
Schaufel. Dollacker schüttelt, stochert an dem Gebilde und schau, im harten
Klumpen steckt eine Röhre aus gebrannten Ton. Herr Dollacker zeichnet das
seltsame Ding mit ein paar Strichen in sein Notizbüchlein und drunter schreibt
er: „Tondüse für den Blasebalg zu einem Rennofen.“ So hieß man in alter Zeit
die Schmelzöfen.
Die braune Schicht geht zu Ende und der gelbe Sand ist
wieder da. Plötzlich stutzt ein Arbeiter. Sein Pickel ist in ein Stück morsches
Holz gefahren. „Halt!“, ruft der Herr Oberregierungsrat und bückt sich.
Wirklich, unter der Schlackenschicht ist ein Stück Holz. „Jetzt ganz vorsichtig
weiterarbeiten, meine Herren!“, sagt er zu den Arbeitern. Und schon steht er
selbst im Graben und wühlt mit seinen Fingern im Sand. Noch ein Stück Holz und
dann ein Knochen, und gleich daneben noch einer. Die Arbeiter stehen da und
schauen. Sie brauchen nichts zu fragen. Sie sehen ja selbst, was da im Boden
liegt: das ganze Skelett eines Menschen. Eine unheimliche Geschichte!

In den nächsten Tagen werden noch elf Gräber entdeckt und
freigelegt. Hier war ein Friedhof, ein christliches Gräberfeld, das sicher
schon 1200 Jahre alt ist. Als man später die Friedhöfe bei den Kirchen anlegte,
hat man den alten Friedhof mit seinen Toten vergessen, und schließlich hat man
über die Gräber die Schlacken gebreitet. Und die Amberger sind jahrhunderte
lang über die Gräber gelaufen und wussten es nicht.
So erzählt der Amberger Boden aus der alten und uralten
Geschichte. Man muss nur lesen können in diesem Geschichtsbuch, so wie es der
Herr Oberregierungsrat Dollacker gekonnt hat.
Diese Geschichte hat sich 1920 zugetragen. Ähnliches geschah
in der Herrnstraße auch schon 1914, und damals hat Regierungsrat Dollacker noch
interessantere Funde gemacht. Acht Reihengräber konnte er feststellen. Im
Bereich unserer Herrnstraße liegt demnach ein Reihengräberfeld, von dem man
bisher 20 Gräber gefunden hat. Dieser Friedhof wird im 8. Jahrhundert angelegt
worden sein, also in der Zeit Karls des Großen. Ferner hat der unermüdliche Heimatforscher
5 Hügelgräber aus der späten Hallstattzeit aufgedeckt. Vor über 2500 Jahren siedelten
schon Menschen innerhalb unserer Altstadt. - An den eifrigen Forscher, der aus
Liebe zur Geschichte seiner Vaterstadt ohne jede Entschädigung seine gesamte
Freizeit mit Archivforschung und Bodenbeobachtung zubrachte, erinnert die Dollackerstraße.
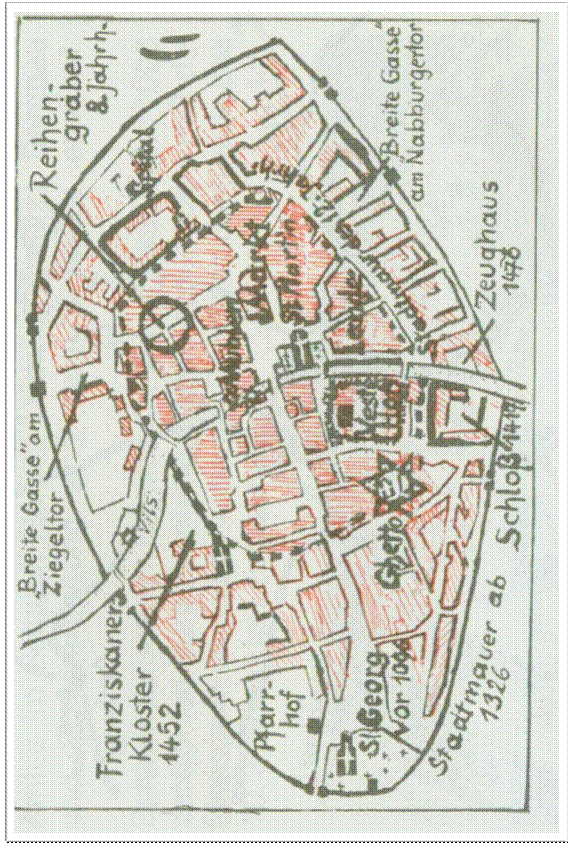
In Amberg gibt es eine Archivstraße. Dort steht das
Staatsarchiv für den Regierungsbezirk Oberpfalz, in dem viele alte Akten und
Urkunden aufbewahrt werden. Einige Millionen alter, vergilbter Blätter sind
dort, auf denen man lesen kann, was vor 200, 300 oder auch vor 500 Jahren in
unserer Heimat Oberpfalz geschehen ist. Im Hauptstaatsarchiv in München sind
noch viel mehr solcher alter Akten.
Eine Urkunde hätten wir zu gerne in Amberg, aber die
Archivverwaltung gibt sie nicht heraus. Freilich, zur 950-Jahr-Feier Ambergs
konnten wir sie im großen Rathaussaal sehen. Sie hatte einen Ehrenplatz.
Wollen wir dieses kostbare Stück genauer betrachten. 65 cm
misst es in der Länge und 50 cm in der Breite. Ein eigenartiges Papier ist das,
leicht bräunlich und dick. Man hat hier Pergament verwendet, und das ist eine
besonders gegerbte Kälberhaut.
Was hat der Schreiber auf das Pergament geschrieben? Es ist
die früheste Kunde von unserer Vaterstadt. Wir können die alte Schrift nicht
lesen. Die Buchstaben sehen ganz anders aus als die unsrigen, und die Sprache
ist gar nicht Deutsch, sondern Latein. Doch einige Wörter lassen sich
entziffern:
AMMENBERG, GISELA, HENRICI und EBERHARD.
Und das steht in der Urkunde: Kaiser Konrad schenkt auf
Wunsch seiner Gemahlin Gisela und seines Sohnes Heinrich dem Bischof Eberhard
von Bamberg für seine treuen Dienste AMMENBERG im Nordgau. AMMENBERG, so hieß 1034
unser Amberg.
Wir erfahren noch mehr. Dieses Amberg war damals schon ein bedeutender
Ort. Da fuhren von Amberg Schiffe auf der Vils nach Regensburg, Fischer holten
ihre Beute aus den Gewässern und Jäger stellten dem Wild nach. Mehrere Mühlen
gab es bereits. Kaufleute lebten dort, zogen mit ihren Waren zu Wasser und auf
den Straßen zum Markt und entrichteten in Amberg ihren Zoll. Der Bischof von
Bamberg aber bekam das Recht, in seinem neuen Besitztum Gesetze zu erlassen und
seine Einkünfte zu mehren.
Die kaiserliche Villa Amberg wurde so bischöflich -
bambergischer Besitz.
Das war für den Bischof von Bamberg sicher ein schönes,
wertvolles Geschenk. Nun hatte er über Vils, Naab und Donau eine schnelle
Verbindung zu den bambergischen Besitzungen in Österreich. Damit nun niemand
diese Schenkung anzweifeln konnte, hat sie der 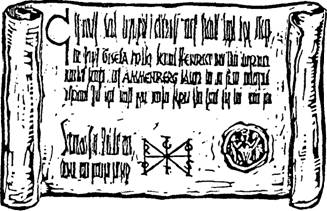 Kanzler
Burchard unterschrieben, man hat das kaiserliche Siegel aufgedrückt und Kaiser
Konrad hat sein Namenszeichen dazusetzen lassen.
Kanzler
Burchard unterschrieben, man hat das kaiserliche Siegel aufgedrückt und Kaiser
Konrad hat sein Namenszeichen dazusetzen lassen.
Wann und wo ist diese Urkunde ausgestellt worden? In der
letzten Zeile steht:
REGENSBURG, 24. APRIL 1034
Seit dieser Zeit ist der Name Amberg schriftlich
überliefert. Kannst du ausrechnen wie alt diese Urkunde ist?

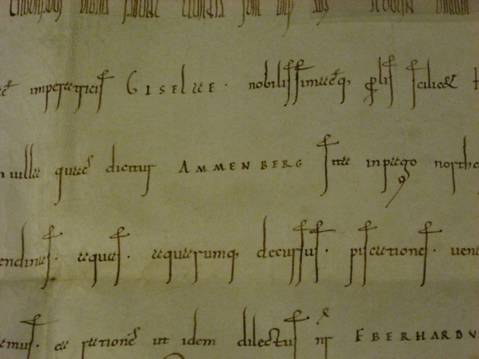
24. April 1034, Regensburg
Kaiser Konrad II. überlässt Bischof Eberhard I. von Bamberg verschiedene
Herrschaftsrechte „in villa, quae dicitur Ammenberg“ (in dem Dorf, das
Ammenberg genannt wird).
Sie betreffen Bann, Markt, Zoll, Fährgerechtsame, Mühlen, stehende und
fließende Gewässer, das Fischerreirecht, das Jagdrecht sowie sonstige kaiserliche
und herzogliche Rechte.
Es gibt nicht viele Städte, die ihre Vergangenheit so weit
zurückverfolgen können wie Amberg. Nürnberg wird erstmals 1050, Eger 1061,
München 1158 und Weiden 1241 schriftlich erwähnt. Andere Orte unserer Heimat
sind sogar älter als Amberg. Nabburg ist für 929, Lauterhofen für 806 und
Vilshofen gar schon für 777 schriftlich überliefert.
Die Bischöfe von Bamberg, die neuen Herren Ambergs, haben
ihren neuen Besitz nach Kräften gefördert. Sie ließen um 1050 die Pfarrkirche
St. Georg bauen. Sie erreichten 1165 beim Kaiser, dass die Amberger die gleichen
Handelsrechte im Reich erhielten wie sie die Nürnberger besaßen. 1166 erließ
der Bischof von Passau den Amberger Händlern alle Abgaben auf Fürsprache des
Bambergers, wenn sie mit ihren Waren durchs Passauer Bistum nach Ungarn fuhren.
– Zu bedenken ist, dass Villa damals nicht nur vornehmes Wohnhaus, oder Ortschaft
mit mehreren Bauernhöfen sondern auch einen Verwaltungsbereich mit mehreren
Dörfern, Einzelhöfen und Mühlen bedeutete.
Übrigens, wenn die Archivalien des Amberger Staatsarchivs
eng aneinander gepresst längs der B 85 abgestellt würden, wie lange wäre diese
"Papierschlange"? Nun, ihr Kopf wäre schon in Sulzbach, während ihr
Schwanz im Staatsarchiv endete. Viele Akten über Amberg hat auch unser
Stadtarchiv.
|
Ende Oktober 1347 wusste man es auch in Amberg: Kaiser
Ludwig der Bayer ist tot. Während einer Bärenjagd vor den Toren Münchens war
er plötzlich vom Pferd gesunken. Ein Bauer war ihm zu Hilfe geeilt, hatte den
Sterbenden am Feldrain ins Gras gebettet, und in den Armen dieses einfachen
Mannes ist der mächtigste Herrscher Deutschlands gestorben.
In Amberg war man erschüttert. Wo Bürger zusammenkamen,
sprachen sie von ihrem König und Kaiser, der so viel für die Stadt getan
hatte. Man erinnerte sich an seine Wohltaten: 1310 war es. Rings um Amberg
gab es fast kein Holz mehr für den Bergbau und die Hammerwerke.
|

|
Auswärtige hatten viel Holz aufgekauft und weggeschafft. Arg
waren die Wälder verwüstet. Da hat Herr Ludwig, damals war er noch Pfalzgraf,
befohlen, dass innerhalb einer Meile rings um Amberg auch nicht das kleinste
Bäumchen anderswohin verkauft werden darf. Von Wolfsbach über Bittenbrunn,
Ursensollen, Ammerthal, Rosenberg, Hahnbach, Urspring, Pursruck, Ebermannsdorf
und wieder zurück nach Wolfsbach sollte sich dieser Meilenkreis ziehen. Da
gab’s bald wieder preiswertes Grubenholz und reichlich Holz für die Köhler.
1317 hat Kaiser Ludwig das Bürgerspital gegründet. Nicht nur
die alte Johanniskirche und den großen Hof vor dem alten Nabburger Tor hat er
für dieses fromme Werk gegeben, auch viele Bauernhöfe und Felder und Wälder hat
er dazu geschenkt. 50 alte, arme Bürgersleut’ konnten schon damals im Spital
sorgenfrei ihren Lebensabend verbringen, und es kostet sie keinen Pfennig. Gott
vergelt's dem guten Kaiser.

Und wie war es mit unserer Stadt? Niemals hätten wir unser
Amberg so vergrößern und so stark befestigen können, wenn unser Herr Ludwig
nicht den Zoll vom Erzberg und in der Stadt für diesen Zweck uns überlassen
hätte. Die Pfarrkirche St. Georg, die Georgenvorstadt, das Spital und die
Häuser an der alten Magdeburger Straße sind jetzt (1347) schon weitgehend durch
den tiefen Graben und einen Wall oder sogar schon von Tortürmen und Mauern
geschützt und mit der Stadt vereint. Und mit großem Einsatz wird weiter an den
Befestigungen gearbeitet. Dank des Erzzolls werden auch unsere Nachkommen das
große Befestigungswerk weiterführen und vollenden.
Händler und Kaufleute denken daran, wie er ihnen den Zoll
und alle Abgaben im ganzen Herzogtum Bayern auf allen Straßen und Flüssen
erlassen hat. Auf viel Geld hat er verzichtet, unser König. Wie hat er unser
uraltes Recht auf die Schifffahrt geschützt! Zu gern hätten 1311 die
Regensburger die Erz- und Eisenfracht ab Schmidmühlen an sich gerissen. Herr
Ludwig hat sie sauber abblitzen lassen.
Auch die hochweisen Herren des Rates denken zurück. Wisst
ihr noch wie unser guter Herr Ludwig 1325 verfügt hat, dass kein Amberger
Bürger wegen Besitz- und Erbschaftsstreitigkeiten vor ein anderes Gericht
gerufen werden darf als vor das Schrannengericht bei der Eichenstauden oder auf dem Amberg? 1324 hat er unsere Stadtsteuer
auf den niederen Betrag von 90 Pfund Pfennigen für alle Zeiten festgesetzt. Und
1318 hat er gar auf eine alt überlieferte Abgabe verzichtet. Ob Amberg je
wieder einen so gütigen Herrn bekommt?
Schließlich wissen sogar die Kinder etwas Besonderes vom
toten Kaiser zu rühmen. Jedes Jahr wird zu Lichtmess der Jahrestag für Herzog
Ludwig, den Vater des Kaisers, gehalten. Nach dem Amt kommt immer das große
Schenken. Priester, Lehrer und Schüler erhalten nach dem Willen des Stifters
kleine Geldbeträge, den Aussätzigen gibt man Bier, und das ist das Allerschönste,
jedes Amberger Kind kriegt 2 Eier.
So denken die Amberger an Allerseelen 1347 mit Liebe und
Trauer an ihren Kaiser. Die Amberger Bürger waren ihm wirklich „lieb vor
anderen“, wie er es in der Spitalurkunde von 1317 sogar aufschreiben hat
lassen.

Die meisten Amberger haben den Kaiser mehr als einmal
gesehen. Oft hat er die Stadt besucht, sehr gern hat er sich in der alten
Veste, im Eichenforst aufgehalten. Mit jedermann war er freundlich, mit allen
Sorgen durfte man zu ihm kommen und geholfen hat er, wenn es möglich war.
Unvergessen ist ihnen sein Besuch nach der siegreichen
Schlacht bei Mühldorf am Inn 1321. Der Gegenkönig, Friedrich der Schöne von
Österreich, war geschlagen und saß als Gefangener in der Burg Trausnitz.
Umjubelt zog Ludwig ein, umjubelt ritt er weiter nach Kastl zu seinem Freund
Abt Hermann und zu seinem Feldhauptmann, dem wackeren Seyfried Schweppermann. -
Lange ist's her.
Nach bald 700 Jahren ist das Bürgerspital, diese großzügige
Stiftung König Ludwigs, noch immer ein Segen für Amberg. 190 Bürger werden
gegenwärtig dort versorgt. Am Ludwigstag, zu Lichtmess, gibt es leider keine
Eier mehr für die Kinder, wie es der Kaiser angeordnet hat. Seit einigen Jahren
aber spendet eine Amberger Brauerei am Lichtmesstag jedem Spitalinsassen ein
Seidel Bier. Die Landschranne bei der Eichenstaude findet man heute in keinem
Stadtplan mehr. Beim Drahthammer aber ist noch der hohe Erdhügel zu sehen, auf
dem einst die Gerichtsherren tagten.
Ein Pfund Pfennig sind nicht 500 Gramm in Pfennigmünzen. Mit
Pfund bezeichnete man einst eine Menge von 240 Stück. Nun kann man ausrechnen,
wie viele Pfennige damals die Stadt Amberg an Steuern zahlen musste. Allerdings
war 1347 ein Pfennig sehr viel wert. Für 90 Pfennig konnte man ein Schwein
kaufen. Ein Handlanger verdiente an einem Tag 7 bis 10 Pfennige.
An den guten Kaiser erinnert ein Gedenkstein am Bürgerspital
und eine Straße beim Bahnhof. - In Kastl feiern die Bürger bis heute das
"Kastler Recht" zur Erinnerung an die Marktrechtsverleihung durch
Kaiser Ludwig. Die Stürmerin, eine Riesenglocke, die Ludwig dem Kloster
stiftete, begleitet seit mehr als 650 Jahren mit tiefem Gebrumm den Tagesablauf
des Marktes. Droben in der Klosterkirche aber ruht, im Laufe der Jahrhunderte
zur Mumie geworden die kleine Anna, ein Töchterlein des Kaisers.
Die Bilder zeigen den Kaiser nach einem Relief in Mainz,
unser Bürgerspital um 1900 und die alte Veste in der alten Hofhaltung um 1590.
An der Vils die "Engelsburg", oder Klösterl, dahinter
"Eichenforst" oder "Alte Veste" und Frauenkirche.
18 Jahre war Pfalzgraf Ludwig IV., als er 1442 Kurfürst
wurde. Sein Vater Kurfürst Ludwig III. war bereits 1436 gestorben, und die
folgenden sechs Jahre hatte sein Onkel Pfalzgraf Otto von Moosbach als Vormund die
Geschicke der Kurzpfalz bestimmt und sich auch der drei Söhne seines verstorbenen
Bruders angenommen, besonders als deren Mutter 1438 ebenfalls starb.
Ludwig, Friedrich und Ruprecht fanden in der kinderreichen
Familie des Vormunds einen guten Platz. Die beiden Älteren erhielten eine
umfassende, vielseitige Ausbildung in allen ritterlichen Künsten und in vielen
Wissenschaften. Sie sollten schließlich als Herrscher in den von ihrem Vater
ihnen zugeteilten Pfalzgrafschaften die Regierung übernehmen. Für Ruprecht war
eine Laufbahn im höheren Klerus vorgesehen.
Ludwig IV. konnte ohne Schwierigkeiten in allen
kurpfälzischen Landen die Regierung antreten. Noch 1442 erwarb er Vilseck
pfandweise vom Bamberger Bischof. Nachdem sein Bruder Friedrich 1443 ebenfalls
großjährig geworden war, hätte er nach dem Testament des Vaters einen
stattlichen Teil der Kurpfalz als eigene Pfalzgrafschaft beanspruchen können.
So sollte er im Nordgau Hahnbach, Vilseck, Pressath, Oberviechtach und Kastl
erhalten. Doch die beiden Brüder wollten die Kurpfalz nicht weiterhin durch
eine Teilung schmälern. Ludwig sollte sie noch 8 Jahre ungeteilt regieren und
Friedrich für diese Zeit eine angemessene Lebensführung ermöglichen.
Der junge Kurfürst musste sich sogleich mit den Armagnaken
auseinandersetzen. Diese französischen Söldnerhaufen, die sich nach dem Ende
des englisch / französischen Krieges nicht aufgelöst hatten, suchten seit
Jahren plündernd und raubend die deutschen Grenzgebiete heim. Der junge Kurfürst
bemühte sich vergebens um eine friedliche Lösung. Er war noch keine 20 Jahre,
als er Reichshauptmann wurde und die Freibeuter bis 1445 endgültig vertrieb.
1445 heiratete Ludwig die Tochter Margaret des Herzogs von Savojen, der in seinen
älteren Jahren Kleriker geworden war und schließlich noch Papst wurde. 1448
wurde dem Kurfürstenpaar ein Sohn geboren und auf den Namen Philipp getauft.
Bei einem Besuch in Amberg 1449 wünschte der junge Vater seine kurpfälzischen Untertanen
im Nordgau sollten dem kleinen Kind als Kurfürsten huldigen und beschwören,
niemand andern als Kurfürsten anzuerkennen. Dazu war man gerne bereit. Wenige
Monate später, am 13. August 1449 starb Kurfürst Ludwig IV. plötzlich und
unerwartet. Der kleine Philipp war Kurfürst. Sein Onkel Friedrich übernahm die
Vormundschaft auf Wunsch des Verstorbenen bis zu dessen Volljährigkeit und die
Regierung der Kurpfalz.
Pfalzgraf Friedrich hatte keinerlei Schwierigkeiten mit
seinen neuen Aufgaben. Die Bürger der Städte und Märkte, das Landvolk und die
Adeligen und der Klerus leisteten ihm überall in der Kurpfalz bereitwillig als
Vormund den Huldigungseid.
Schon im Oktober 1449 schrieb Friedrich seinen ersten
Reichstag nach Bretten aus, um im Krieg zwischen Nürnberg und Markgraf Albrecht
von Hohenzollern zu vermitteln. Am 11. Januar 1450 wurde dieser Fall wieder in
Heidelberg behandelt und dort ging es zudem um Differenzen zwischen Ulrich von
Württemberg und der Reichsstatt Esslingen. Für die Wertschätzung, die dem
kurpfälzischen Vormund entgegengebracht wurde, spricht der starke Besuch, denn
35 Reichsfürsten, 3 Bischöfe und Vertreter mehrerer Reichstädte hatten sich
eingefunden. Er wurde ebenso als Vormund anerkannt, wie einst Pfalzgraf Otto.
Keiner seiner Nachbarn hegte feindselige Absichten gegen die Kurpfalz.
Als Friedrich am 3. August 1451 zu einem Fürstentag nach
Speyer einlud, kamen sogar der Kurfürst von Mainz der Markgraf Albrecht von
Hohenzollern, Herzog Ludwig von Landshut, weitere 12 Fürsten, 26 Grafen, 20 Freiherrn
und 32 Ritter. Man konnte einen Waffenstillstand zwischen den verfeindeten
Lichtenbergern und Leinigern vermitteln und andere Meinungsverschiedenheiten
aushandeln. – Dann sorgte Friedrich für eine allgemeine Überraschung. Er teilte
den Adeligen und hochadeligen Herren mit, er beabsichtige durch die Arrogation
(Anwünschung, Adoption) des minderjährigen Kurfürsten Philipp dessen Vater und
auch Kurfürst zu werden. Zu seiner Überraschung fand dieses Vorhaben bei dieser
Versammlung hoher und niedriger Fürstlichkeiten keine Zustimmung.
Doch Friedrich gab seinen ehrgeizigen Wunsch nicht auf und
wandte sich an die Adeligen und hohen Räte der Kurpfalz, mit denen er seit
Jahren ein gutes Einvernehmen pflegte. Von diesen Verhandlungen berichtet sein
Schreiben vom 16. September 1451: „Frau Margareth von Savoy, Pfalzgräfin bey
Ryne (Philipps Mutter) … und die trefflichsten rete und … gelieder des Fürstenthums
der pfalzgrafschafft bey Ryne … hant uff ihre eyde geraten, dass dem hochgeborn
fürsten philip und der … pfalzgrafschafft … es am nützlichsten sei wenn wir
(Friedrich) unsern vetter zu unserm Sohn annehmen.“ Er versicherte, er werde
nicht heiraten, solange Philipp oder einer von dessen Söhnen lebt. So sollte
vermieden werden, dass es zwischen seinen und Philipps Nachkommen zu Irrungen
und zu einer Teilung des Fürstentums kommt. Er stellt fest „dass bislang die
kurpfalz mechtiglich in hohen wirden eren und macht kumen ist“ und er „von
gantzen Hertzen geneyget (ist), dass das selbe fürstenthum by solchen wirden,
eren und macht … also blieben möge. So begeren wir, den obgenannten unsern
vetter hertzog Philips zu unsern sohne zu han.“ Und all dies geschehe Gott dem
Allmächtigen zum Lob, dem heiligen römischen Reich und der Kurpfalz zur
Stärkung und gemäß der Ordnung und Satzung unseres allergnädigsten Herren des
römischen Königs Friedrichs III.
Ob Friedrichs Vorhaben wirklich ein Gotteslob war? Mit
Sicherheit war es ein Wortbruch gegenüber seinem Bruder. Ganz sicher aber ist,
dass der König und spätere Kaiser Friedrich III. diese Arrogation niemals
anerkannt hat, da er sie nicht mit der Goldenen Bulle vereinbaren konnte.
Versichert hat Friedrich ferner, dass der Kurpfalz all seine eigenen Erbstücke,
dann alles was ihm sonst noch zusteht und was er als Kurfürst erwirbt und „erobert“
ganz und ungeteilt verbleiben soll.
Vom 13. Januar 1452 stammt die Urkunde zu dieser Arrogation.
Einleitend wird betont, dass die Mutter Philipps, die Räte und herausragenden
Glieder der Pfalzgrafschaft am Rhein Pfalzgraf Friedrich gebeten haben, die
Kurwürde zu übernehmen und seinen Neffen zu adoptieren. Weil „ihm Nutzen und
Wohlfahrt der Kurpfalz sehr am Herzen liegen“, willigte er ein, unter folgenden
Bedingungen:
- Kurfürst
Friedrich soll seinem Vetter wie einen rechten, natürlichen, ehelichen
Sohn halten. Erst wenn er zu Jahren gekommen ist und geheiratet hat, soll
er einige Schlösser, Städte und Dörfer, wie es Friedrich am passendsten
dünkt, erhalten.
- Friedrich
wird nicht heiraten bei Lebzeiten Philipps und dessen männlichen Nachkommen.
– Wegen dieser Bereitschaft Friedrichs zum Zölibat, um „all seine Lieb, Milde
und väterlichen Neigungen dem Sohn seines Bruders zuwenden und auch um die
Pfalz vergrößern und mehren zu können“, preist sein Hofkaplan und Chronist
Matthias von Kemnath diese Entscheidung als eine „wunderliche Schickung
der ewigen Vorsehung Gottes“ und „das allergrößte gute Werk überhaupt“ in
vielen wohlklingenden Zeilen.
- Friedrich
verspricht wie schon erwähnt, all seine gegenwärtigen Güter und künftigen
Erwerbungen der Kurpfalz zu überlassen.
- Friedrich
versichert, von den Landen, die jedem Kurfürsten vorbehalten sind, nichts
zu veräußern und zu versetzen, und in seinem Testament nur über 6000 fl
verfügen zu wollen.
- Festgehalten
wird, dass alle kurpfälzischen Dienstleute nur von Friedrich Lehen nehmen
dürfen und ihm Huldigung und Eid leisten müssen. Dies gilt auch für die
Verwaltung in jenen Landen, die er Philipp einst bei seiner Hochzeit
überlassen wird.
- Fremde
Lehen, die zur Pfalzgrafschaft gehören darf nur Friedrich empfangen und
zwar bis zu seinem Tod.
- Allen
Ständen des Landes, den Geistlichen, Grafen, Rittern, Herren und Knechten
der Kurpfalz sichert er alle ihre Rechte zu. Ebenso erhalten die
Universität Heidelberg, die Städte und Märkte und die Juden ihre
gesiegelten Briefe und alten Rechte.
- Dagegen
soll Friedrich seinen und seines Neffen Erbteil mit allen Herrlichkeiten,
Rechten und Zugehörungen inne haben … als ein rechter Herr des Landes auf
Lebenszeit.
- Gleichzeitig
erklärte Friedrich alle Eide, die Bauern, Bürger, Räte und Lehensleute der
Kurpfalz, seinem Vetter Philipp, dem Kurfürsten und ihm als dessen Vormund
geschworen haben, für nichtig. Alle haben nunmehr ihre Huldigung ihm als
„ihren rechten natürlichen Herren zu leisten“.
Als man in Amberg von der Arrogation erfuhr und aufgefordert
wurde, Friedrich als Kurfürsten zu huldigen, befand man sich in einem schweren
Gewissenskonflikt. Man hatte Kurfürst Ludwig IV. eidlich versprochen nur
Philipp als Kurfürsten anzuerkennen. Friedrich hatten sie selbstverständlich
nur als Vormund gehuldigt. Nun verlange er von ihnen einen Eidbruch.
Sie hatten bislang alle ihre Pflichten gegenüber Heidelberg
und dem Vormund gewissenhaft erfüllt und würden dies auch fernerhin tun. Doch
hat man mehrmals untertänigst gebeten ihnen die Vereidigung auf Kurfürst
Friedrich zu erlassen. Es ging für sie um einen Eid mit Gott als Zeugen. Jeder
Untertan, der seinem Fürsten geschworen hatte, musste bereit sein, die Rechte
seines Herren in den Stadt- oder Landfahnen bis zum Tode zu verteidigen. Jeder
Landesherr bestrafte Meineid schwer. Dann aber war Meineid auch schwere Sünde
und es ging um die ewige Seeligkeit. Konnte Friedrich wirklich von einem Eid
lösen, den man einem anderen geleistet hatte? Man nahm diese Angelegenheit sehr
ernst und wandte sich an Rechtsgelehrte und diese erklärten „dass diese
Anwünschung nicht statthaben möge (dürfe), dieweil der angenommene Sohn reicher
und mächtiger ist als der anwünschende Vater.“
Bürgermeister und Rat erklärten sich schließlich bereit zu
huldigen, wenn der Papst, der Kaiser oder das Kurfürstenkollegium ihnen
versichern würden, dass diese Huldigung Friedrichs nicht gegen ihre Philipp
beschworenen Verpflichtungen verstoße. Friedrich lehnte dieses Verfahren ab,
obwohl Papst Nikolaus V. bereits Ende 1451 die Arrogation gebilligt hatte und
Friedrichs Standpunkt vertrat. Der Kurfürst fand es wahrscheinlich unter seiner
Würde, wegen einiger Bürger eine Entscheidung anderer einzuholen und sich
dieser unterwerfen zu müssen.
In der Rheinpfalz hatte es in der Huldigungsfrage keinen
Widerspruch gegeben, doch sonst hatte nur der Kurfürst von Trier 1452 dieser
Rangerhöhung Friedrichs zugestimmt.
Erst 1452, neun Monate nachdem er sich zum Kurfürsten
gemacht hatte, führte Friedrich seinen ersten Krieg. Er zog gegen die Grafen
von Lützelstein, eroberte Stadt und Schloss und besetzte ihre Lande. – Der
erste Feldzug, die erste größere Mehrung der Kurpfalz.
In Amberg hatte man im Lauf des Jahres genug Zeit, die
Situation zu überdenken. Schließlich hatten im westlichen Bereich der Kurpfalz
alle Untertanen in Stadt und Land, aber auch die Adeligen vom Edelmann bis zum
Grafen und selbst die geistlichen Würdenträger Friedrich als Kurfürsten gehuldigt.
Man war weiterhin gegen Friedrichs Vorgehen, das den Regierungsantritt ihres
kleinen Kurfürsten Philipp weit über die Jahre seiner Mündigkeit hinaus
verzögern musste. Viele waren jedoch der Meinung man müsse den Verhältnissen
Rechnung tragen und tun, was die Verhältnisse zuließen bzw. erzwangen. Das war
zumindest die Meinung vieler Räte und Bürger. Die meisten Inwohner und Bürger
aber wollten die Arrogation verweigern, und in diesem Punkt herrschte innerhalb
der Einwohnerschaft steigende Zwietracht.
Friedrich hatte in Amberg nicht nur seine kurpfälzischen
Dienstleute und Räte, sondern auch Zwischenträger, die ihm genau berichteten
was in Amberg vorging. Er wollte endlich versuchen die Amberger zur Zustimmung
der Arrogation zu bringen. Nach einjährigen Verhandlungen musste etwas geschehen,
denn es war zu befürchten, dass man seine kurfürstliche Würde allgemein nicht
ernst nähme, wenn diese selbst in seinem Herrschaftsbereich nicht ernst
genommen würde.
Friedrich schickte im Februar 1453 den Domherrn und Doktor
der Theologie Ernst Landschad, seinen einstigen Lehrer, dann Hans Landschad von
Steinach, beide kurpfälzische Räte mit kleinem Gefolge nach Amberg. Am 25.
Februar predigte der Domherr im neuen Chorteil der Martinskirche über das
Gewissen und betonte, dass die Amberger ohne alle Bedenken Friedrich als
Kurfürsten huldigen können. Nicht wenige Zuhörer wünschten, seine Worte würden
viele überzeugen, damit der Zwiespalt in der Stadt und mit Heidelberg ein Ende
habe.
Am 26. Februar wurde der Rat und die Gemein (Bürger und
Inwohner) in den großen Saal des Schlosses geladen. Diesmal sprach Dr.
Landschad als Jurist und Diplomat. Er versuchte darzulegen, dass der kleine
Philipp durch die Arrogation keine Nachteile haben werde, wie die
Vertragspunkte zeigen. Doch die kannte man in Amberg auch, und es kam zu
erregten Debatten, besonders als ein Amberger Mechanikus (Geschütz- und
Glockengießer) die Argumente des Herrn Doktor gründlich zerpflückte und mit
Rechtsgutachten widerlegte. Selbst an der Heidelberger Universität zeigte man
sich von diesem gelehrten Disput eines Handwerkers mit Doktor Landschad sehr
beeindruckt und noch nach Jahren sprach man davon. Gerade diese Diskussion
beweist, dass man sich selbst in den Amberger Bürgerkreisen recht gründlich mit
Friedrichs Rangerhöhung beschäftigt hatte.
Bei der anschließenden Abstimmung lehnte die Mehrzahl der
Anwesenden die Arrogation ab. Man war stolz über diesen Sieg im Wortgefecht mit
dem Domherrn und war zuversichtlich, Friedrich würde bei weiteren Verhandlungen
nachgeben. Die Heidelberger reisten nach wenigen Tagen zu den kurpfälzischen
Ämtern im Nordgau (Hirschau, Vilseck, Nabburg, Oberviechtach, Schnaittenbach,
Kemnath, Waldeck, Rieden). Doch die Nachricht von der Entscheidung der Amberger
war bereits überall bekannt und überall lehnte man die Arrogation ab. Am 20.
März kamen die beiden Landschads nach Amberg zurück, bezogen wieder ihre
Quartiere und man vermutete sie würden länger bleiben. In Amberg hoffte man auf
eine Fortsetzung der Verhandlungen.
In der Passionswoche waren die Heidelberger nach Amberg
zurückgekehrt. Wie überall in der Christenheit bestimmte die nahe Karwoche den
Tageslauf. Der Freitag dieser Woche hieß allgemein der schmerzhafte und war ein
Tag, an dem des Mitleidens der Gottesmutter in der Leidenszeit ihres Sohnes gedacht
wurde. Ein stiller, ernster Tag also. Man besuchte die Messfeier und besondere
Andachten und begab sich auch zum stillen Gebet in die Kirchen.
Plötzlich, zwischen 11 und 12 Uhr schreckten hektische
Hornsignale vom Martinsturm die Bürger auf. Eilig hasteten sie aus Kirchen und
Wohnstuben, spähten zum Turm hinauf, sahen wie der Türmer die weiße Kriegsfahne
schwenkte und sie gegen Norden festmachte. Sogleich richtete sich jeder nach
der für Kriegsfälle vorgeschriebenen Ordnung. Die Zugbrücken rasselten nach
oben, die Torflügel wurden verschlossen, bewaffnete Bürger eilten zu ihren
Sammelplätzen und zum Marktplatz kamen jene, die vom Feind verursachte Brände
zu löschen hatten. Frauen Kinder und Greise schafften Löschwasser auf die Dachböden
ihrer Häuser.
Aber wer war es, der unter Missachten der üblichen
Waffenruhe zu heiligen Zeiten gen Amberg rückte? An den Hohenzoller Albrecht
dachte man, der war keine Freund der Kurpfalz. Ganz verwunderlich war, dass die
große Glocke nicht geläutet wurde. Sie sollte nicht nur die Bürger zu den
Waffen rufen, sie musste den Feinden auch künden, dass man sie erwartet und besonders
hoffte man, sie würden die Hilfe der Stadtheiligen herbeirufen. Und dann
verbreitete sich überall die schlimme Feststellung des Türmers, dass der
Klöppel der Glocke entwendet worden war. Die Angreifer mussten Helfer in der
Stadt haben.
Ein Angriff ohne Fehdeansage! So handelte doch kein Ritter
und erst recht kein Domherr. Dann erschienen die ersten Reiter und über ihnen
wehte die Fahne der Kurpfalz. Zorn und Wut über diesen feigen Anschlag
überwogen rasch alle Befürchtungen und Ängste der Bürger. Man war mit den Heidelbergern
doch im Gottesdienst in der Kirche gewesen, war ihnen ruhig und zuvorkommend
begegnet. Mancher war mit ihnen im gleichen Gasthaus gesessen und diese Herren
hatten diesen heimtückischen Überfall vorbereitet. Es war nicht zu fassen. Was
wäre geschehen, wenn es zum Kampf gekommen wäre.
Inzwischen hatten sich die Angreifer vor der Stadtmauer
gesammelt. Die Anführer waren unschlüssig, was angesichts der abwehrbereiten
Stadt zu unternehmen war. Die Wehrgänge waren besetzt und die Lunten der
Wallbüchsen qualmen. Damit hatte man nicht gerechnet. Mit der Abteilung schwer
bewaffneter Reiter und dem Aufgebot der Untertanen der Churpfalz war ein
Sturmangriff über Wassergraben, Zwingermauer gegen wohl gerüstete und mit
Feuerwaffen versehene Bürger auf der hohen Stadtmauer unmöglich. Dafür fehlt es
sogar an Leitern. - Von Verhandlungen zwischen Ambergern und den Angreifern ist
nichts überliefert.
Das für den Überfall zusammengeholte Aufgebot von Bauern und
Bürgern aus dem kurpfälzischen Landen nördlich Ambergs und die Reiterei rückten
ab und verschwanden hinterm Galgenberg. Der Türmer rollte die weiße Kriegsfahne
ein und die Krieger auf den Mauern wurden wieder Bürger und waren froh über
diesen Ausgang. Doch nun musste man sich um die Heidelberger Gäste kümmern. Man
traf die Landschads wohl gerüstet in ihren Quartieren, bereit sich an die
Spitze der in die Stadt eingedrungenen Krieger zu setzen. Es kam zu wüsten
Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten, und „wenn nicht einer der Räte
dazwischen gekommen wäre, hätte man sie alle zu Tode gebracht“, berichtet der
Chronist Panholz, ein Zeitgenosse.
Mit Ketten gefesselt brachte man die Heidelberger, Herren
und Knechte samt dem kurpfälzischen Landschreiber, Landrichter und den
Unterrichter Peter Nortweiner ins „Loch“, dem sicheren Gefängnis unterm mittleren
Rathaussaal, das sonst nur für Verbrecher und geringe Leute bestimmt war. Gern
hätte man auch den Ratsherrn Gregor Alhard eingelocht, doch der hatte sich
seiner Festnahme entzogen, wie Münster in seiner „Cosomografie“ 1550 berichtet.
Er war ein streitsüchtiger und wenig beliebter Rat, der sich mit den Heidelbergern
gut verstand. Da Alhard fürchtete, festgenommen zu werden, musste er unerkannt
aus der Stadt kommen. Aber wie? Nun war ihm eine Kuh verendet, die schnitt er
auf, weidete sie aus und ließ sich in die Kuhhaut einnähen. Kein Torwärter hat
sich um die verendete Kuh gekümmert, die sogleich aus der Stadt geschafft
werden musste.
Dieser Freitag brachte für die Bürger noch eine weitere,
bedrückende Situation. Im Lochgefängnis saß auch der Domherr Dr. Landschad. Für
den wäre aber nur ein geistliches Gericht zuständig gewesen. Der Amberger
Pfarrherr Heinrich von Rabenstein wollte die Kirchenrechte gewahrt sehen und verhängte
über die Stadt das Interdikt. Ab sofort entfielen Andachten, Messen und
Predigten, die Kirchenglocken verstummten und keine Sakramente wurden mehr
gespendet. Zu Taufen, Sterbefällen, Beerdigungen und Hochzeiten würde kein
Priester kommen.
Da man am 24. März das Fest Mariä Verkündigung feiern
wollte, das man wegen der nahen Kar- und Osterzeit vorverlegt hatte, war am 23.
März abends Komplet und Salve Regina vorgesehen. Nichts wurde gefeiert. Der
Stadtrat reagierte schnell und noch am Freitag eilten berittene Boten nach
Regensburg, um die Aufhebung des Interdikts beim Bischof zu erreichen. Am Fest Mariä
Verkündigung schwiegen dann wirklich die Glocken und die Kirchen blieben
geschlossen. Der Palmsonntag kam, und weite Strecken gingen die Gläubigen mit
ihren Palmbuschen in die Nachbardiözese Eichstätt, also nach Ursensollen oder
Götzendorf zur Palmenweihe. Man stand plötzlich außerhalb der Christenheit.
Endlich am frühen Nachmittag des Palmsonntags kam der
Regensburger Weihbischof mit der bischöflichen Vollmacht zur Beendigung des
Interdikts. Es bedurfte keiner langen Verhandlungen, und Glockengeläute
verkündete das Ende der kirchen- und priesterlosen Zeit, ja man konnte sogar
noch die feierliche Palmsonntagsvesper in St. Martin begehen. Die Predigt des
Weihbischofs trug übrigens viel dazu bei, in Ruhe und Frieden den Tag zu beenden.
Dr. Landschad wurde noch am Palmsonntag aus dem Lochgefängnis geholt.
Am 26. März endete die Haft für die übrigen Gefangenen. Der
Rat der Stadt verlangte von den drei adeligen Herren Hans Landschad,
Landrichter Konrad von Eglofstein und Landschreiber Georg von Riecken
„Urfehde“. Sie mussten schwören, sich an den Ambergern, die sie „in Sicherung
genommen, nicht zu rächen“. Die Heidelberger dürften Amberg rasch verlassen
haben. Die kurpfälzischen Herren des Amberger Regiments blieben und übernahmen
wieder ihre Aufgaben.
In der Stadt muss es nach diesem vereitelten Überfall zu
Änderungen beim Stadtregiment gekommen sein. Die „Gemein“ gewann größeren
Einfluss und schloss Verträge mit dem Rat und beide Seiten beschworen sie. Von
den Abmachungen ist leider nichts in Amberg erhalten geblieben. Nunmehr saßen
neben den Herren aus alten Ratsgeschlechtern auch bürgerliche Handwerker im
Inneren Rat, dem Entscheidungsträger der Stadt. Was bereits 1352 am Widerstand
des Rates und der Landesherrschaft gescheitert war, hatten die Bürger in dieser
Notsituation des Widerstands gegen das ungerechtfertigte Vorgehen der Heidelberger
Gesandtschaft erreichen können. „Gemein“, und Bürger waren nunmehr bei den Entscheidungen des inneren Rats
mitbeteiligt.
Dem Kurfürsten in Heidelberg hat der Rat sicher eine
Stellungnahme zum Ergebnis der Diskussion mit dem Domherrn von Landschad, dann
zum Überfall am 23. März und zur Arrogation übersandt. Friedrich muss „mit
Vertröstungen“ geantwortet haben, wie man ihm noch 1460 vorgeworfen hat.
Die Pflichten gegenüber dem Vormund und der Kurpfalz hat man
in Amberg nach wie vor erfüllt. In Amberg selbst beschäftigte man sich in
diesem Jahr noch mit dem Bau des Franziskanerklosters. Friedrich unterstützte
die Stadt dabei. Von dem Anschlag wollte er sicher wenig wissen. Er verkehrte
also mit „seinen Lieben, Ehrsamen und Getreuen zu Amberg“ in alter herkömmlicher
Weise und unterstützte brieflich die Bemühungen der Stadt für das
Franziskanerkloster, das der Amberger Bürger Hans Bachmann gestiftet hatte.
In der Stadt kam niemand auf den Gedanken, dass jemand, der
mit seinen „Lieben, Ehrbaren und Getreuen“ gemeinsam ein fromme Stiftung
fördern will, einigen dieser „Lieben usw.“ am liebsten den Kopf vor die Füße
legen wollte.
Friedrich wollte und konnte den Fehlschlag im Februar / März
1453 nicht hinnehmen. Von Ehrgeiz getrieben hatte er sich zum Kurfürsten
gemacht und dabei schwere Verpflichtungen übernommen. Doch bis Ende 1453 hatte
nach dem Kurfürsten niemand mehr seine Würde anerkannt. Seine Absichten verrät
sein Auftrag an seine geheimen Vertrauensleute in Amberg. Sie mussten eifrig in
Wirtshäusern, Schenken und auf dem Markt herumhorchen und jene notieren, die
Schlechtes über ihn redeten. Er verlangte die Aufzeichnungen und sammelte Belastungsmaterial.
Die Amberger wussten davon nichts.
Das Jahr 1453, das den Ambergern so viele Aufregungen
gebracht hatte, ging für sie ruhig zu Ende. Der Winter, der keine Jahreszeit
zum Kriegführen war, zog ins Land und man hoffte weiter auf eine friedliche
Zeit im Jahr 1454 und eine Einigung mit Heidelberg.
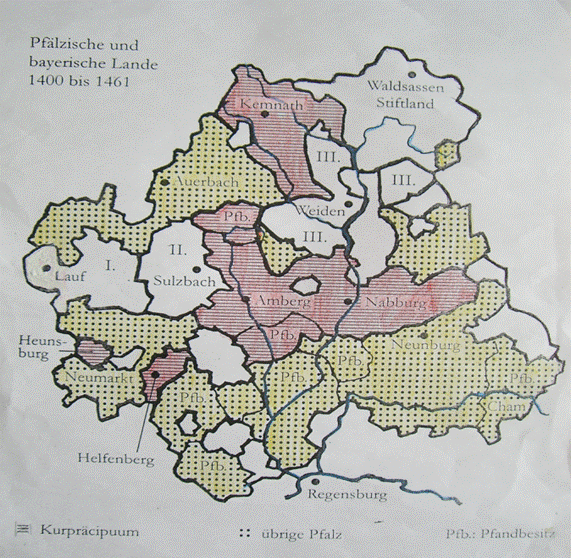
Anders Friedrich! Er wusste, dass man in Amberg an gar keine
Gefahr dachte und viele des alten Rats unzufrieden mit der Entwicklung waren.
Von Parteiungen und Meinungsverschiedenheiten hatte er erfahren. Ende Januar beschloss
er zu handeln.
Die Amberger waren etwas überrascht, als Ende Januar ihnen
gemeldet wurde, dass sich bei Kastl gegen 400 kurpfälzische Reiter aufhielten.
Von dieser geringen Streitmacht erwarteten sie keine Gefährdung. Umso größer
war der Schrecken aller, als sich diese Streitmacht in kurzer Zeit auf über
1000 Reiter und 2000 Mann Fußvolk erhöhte, damals eine stattliche Streitmacht.
Das Fußvolk bestand in der Hauptsache aus Aufgeboten kurpfälzischer Ämter im
Nordgau. Die Reiterei waren meist Söldner. Von Artillerie berichtet kein
Chronist etwas. Friedrich war demnach überzeugt, dass eine überraschende Machtdemonstration
genügen wird, um diejenigen, die ihm nicht gehorchen wollten, einzuschüchtern.
Er wusste durch seinen Geheimdienst wie schlecht es um die Verteidigungsbereitschaft
der Stadt stand, und dass in der Bürgerschaft viele bereit waren ihm zu
huldigen. Hinhaltende Täuschung und plötzlicher überraschender Aufmarsch waren
ihm gelungen. Friedrichs Chronisten berichten stolz, dass man die Amberger mit
der Nachricht von nur 400 Reitern bei Kastl bewusst getäuscht hatte. Als man in
Amberg erfuhr, dass am 2. Februar der Kurfürst selbst in Kastl eingetroffen
war, und über 3000 Bewaffnete sich dort versammelt hatten, dachte niemand mehr
an Widerstand. Bürger, die sich sehr gegen Friedrich gestellt hatten verließen
eiligst die Stadt. Sogar noch nachts, als die Tore geschlossen waren, „fielen
noch viele über die Stadtmauer aus“. Der Rat der Stadt beschloss, Friedrich
entgegen zu ziehen und sich seiner Gnade zu unterwerfen.
Am 3. Februar brach Friedrich noch vor Tagesanbruch in Kastl
auf. Graf Emich von Leiningen führte die Vorhut. Er fand das Wingershofertor
unverteidigt und besetzte es. Er brachte sogleich die anderen Tore unter
Kontrolle und beorderte vor jedes einige Adelige und 40 Schützen bzw. Bauern.
Als man in der Stadt mit dem Anzug des Kurfürsten rechnete, stellten sich die
Geistlichkeit mit einer wertvollen Reliquie, die Stadträte mit den Stadtschlüsseln
und die ganze „Gemein“ auf, um ihm entgegenzugehen. Doch dazu kam es nicht. Als
der hohe Herr von diesem geplanten Empfang erfuhr, zog er durch ein anderes Tor
in die Stadt ein. Von einem Empfang durch die „Lieben, Ehrsamen und Getreuen“
wollte er nichts mehr wissen. Er war jetzt Sieger und Herr. Er ließ die
Torschlüssel zu sich ins Schloss bringen und sofort alle Tore sperren und
bewachen. Anschließend mussten die Bürger ihre Waffen abliefern. Die Landfahnen
wird er nun entlassen haben. Seine Reiter und Söldner kamen in städtische
Quartiere. Friedrich hatte sein Ziel erreicht und zwar: „Listig wie ein Fuchs,
rasch und wild wie ein Wolf und machtvoll und stark wie ein Löwe.“ So schreibt
uns Josef Kraft, ein Zeitgenosse des Ereignisses in Regensburg.
Noch am Nachmittag mussten ihm alle Einwohner auf dem
Marktplatz huldigen. Doch vorher versicherte der Kurfürst Bürgermeister und
Rat, dass Amberg stets beim Kurpräzipium bleiben und auch nie verpfändet werde.
 An sich hätte
Friedrich sich als versöhnlicher, großzügiger Sieger zeigen können. Doch Unterwerfung
und Huldigung genügten ihm nicht. „Wutentbrannt war er gegen Amberg gezogen“,
schreibt Veit Arnpeck, der 1454 in Amberg studierte und diese Tage miterlebte
und später beschrieb. Die Zuträger hatten dem Kurfürsten reichlich Material
geliefert. Allerdings waren viele der Angezeigten aus der Stadt geflohen,
dennoch fanden die Häscher noch 60 Bürger, gegen die am 4. Februar verhandelt
werden konnte. Die Anklage fußte ausschließlich auf den geheimen Mitteilungen
der Spitzel Friedrichs. Bei der Vielzahl der Beschuldigten konnte von langen
Verhandlungen nicht die Rede sein. Verteidiger standen den Angeklagten nicht
zur Verfügung.
An sich hätte
Friedrich sich als versöhnlicher, großzügiger Sieger zeigen können. Doch Unterwerfung
und Huldigung genügten ihm nicht. „Wutentbrannt war er gegen Amberg gezogen“,
schreibt Veit Arnpeck, der 1454 in Amberg studierte und diese Tage miterlebte
und später beschrieb. Die Zuträger hatten dem Kurfürsten reichlich Material
geliefert. Allerdings waren viele der Angezeigten aus der Stadt geflohen,
dennoch fanden die Häscher noch 60 Bürger, gegen die am 4. Februar verhandelt
werden konnte. Die Anklage fußte ausschließlich auf den geheimen Mitteilungen
der Spitzel Friedrichs. Bei der Vielzahl der Beschuldigten konnte von langen
Verhandlungen nicht die Rede sein. Verteidiger standen den Angeklagten nicht
zur Verfügung.
Am 5. Februar wurden die Urteile über die „Verbrecher“ in
aller Öffentlichkeit auf dem Marktplatz in Anwesenheit Friedrichs verkündet und
vollzogen. Veit Arnpeck schreibt, dass 48 auf Bitten und Flehen ihrer
Angehörigen zu hohen Geldstrafen „begnadigt“ wurden, acht Bürger wurden des
Landes verwiesen, und vier ließ Friedrich enthaupten. (Andere Chronisten melden
drei bis fünf Hingerichtete.) Den Besitz der Enthaupteten und Ausgewiesenen
beschlagnahmte der Kurfürst, und ebenso verfuhr er mit Hab und Gut der vielen
Flüchtigen.
In den folgenden Tagen mussten auch die anderen Städte,
Märkte und Ämter der Kurpfalz Friedrich als Kurfürsten huldigen, doch scheint
ihn bei dieser Aufgabe der Statthalter Emich von Leiningen vertreten zu haben.
Am 7. Februar geschah dies in Nabburg und am 12. in Waldeck. Überall wurden
Strafgelder kassiert, während in Amberg manche der zu Geldstrafen Verurteilten
im Gefängnis festgehalten wurden. Friedrich verstand es jedenfalls in der Stadt
und den kurpfälzischen Ländern reichlich Bußgelder zu kassieren.
Friedrich erließ sogleich neue Vorschriften, die seine
Herrschaft in Amberg stärkten und die Freiheiten der Stadt schmälerten. So
musste nunmehr jeder, der sich in Amberg niederließ um Bürger zu werden, außer
der Stadt auch „der Landesherrschaft schwören und geloben“.
- Ansonst
durfte kein Dienstknecht, Geselle oder andere Mannsperson in Amberg aufgenommen
werden, wenn sie nicht geschworen hatten, der „Herrschaft und der Stadt
keinen Schaden zu tun“.
- Die
Stadt hat Amtsleuten und Boten der Herrschaft bei Tag und Nacht die
Stadttore zu öffnen.
- Der
Umgelter darf künftig nur mit Zustimmung des Vicedoms von der Stadt eingesetzt
werden und hat nicht nur der Stadt, sondern auch der Herrschaft zu
schwören.
- Die
Jagd der Bürger im kurfürstlichen Wildbann auf Rebhühner, Hasen und Vögel
ist den Bürgern künftig nur „widerruflich“ gestattet.
- Aus
Ambergs „städtischer Hofmark Schönbrunn“ hat das bewaffnete Landvolk auszurücken,
wenn diese die Herrschaft fordert. Dem Vicedom und seinen Knechten muss
dort Atzung und Nachtquartier bereitet werden.
- Wer
von der Stadt in die Fronfeste gelegt wurde, kann nur mit Zustimmung des
kurfürstlichen Landschreibers freigelassen werden.
- Bürger,
die vom Rat verurteilt wurden und glauben, es wäre ihnen Unrecht geschehen,
können ihre Angelegenheit vor dem Vicedom bringen und der entscheidet über
Revision oder Gültigkeit. Sollte der Rat der Stadt richtig geurteilt
haben, hat der Bürger 40 Gulden Gebühr zu zahlen. Davon erhält die Stadt
ein Drittel für den „Stadtbau“, (Ausbau der Stadtbefestigungen), der
Hauptteil gehört dem Statthalter.
- Die
Amberger dürfen keinen Knecht des Kurfürsten als Bürger oder Dienstmann
der Stadt aufnehmen ohne Wissen des Landesherrn. Alle Amberger haben „die
gnädige Herrschaft bei all ihren Gerechtigkeiten und Herrlichkeiten
bleiben zu lassen“.
- Es
sind „alle Eide und Bündnisse, die Rat und Gemein zu Amberg ohne unserer
gnädigen Herrschaft Wissen getan haben… ganz ab“. Damit war die alte
Ratsverfassung, die 1453 geändert worden war, wieder in Geltung.
- Friedrich
ließ eine neue Bergordnung erarbeiten, wodurch die Befugnisse der Stadt
erheblich beschnitten wurden. Ab 1455 musste daher im Bergbau viel
geändert werden.
Schloss wird Zwingburg
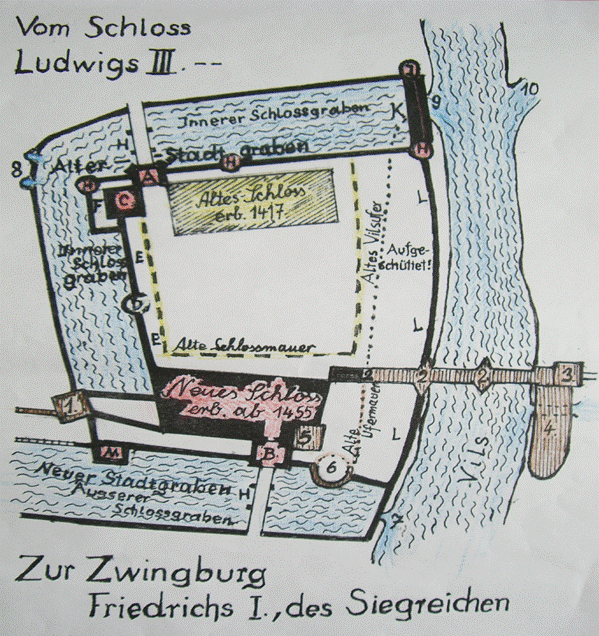
|
Gebaut unter Friedrich I.
A – Tor zur Stadt ê
B – Tor ins Freie
C – Hoher Turm (Fuchssteiner)
E - Lange Mauer ê
F – Turmzwinger ê
H – Wehrmauertürme ê
J – vorgeschobener Turm
K – Bogen über Auslauf des Schlossgrabens
L – Ehemals Vilsgrund
M – Wohnturmbau (Ruine) ê
ê = abgebrochen
|
Vor 1455 vorhanden
1 - Altes Wingershofer Tor (unterer Fuchssteiner)
2 - Stadtmauer über die Vils
3 - Zinnenturm
4 - Alte Bastion ê
5 - Turm (Gegenstück zu 3)
6 - Rundturm (Gegenstück zu 5)
7 – Auslauf des äußeren Schlossgrabens
8 - Quellen
9 - Auslauf des inneren Stadtgrabens
|
Kurfürst Friedrich war entschlossen eine künftige Auflehnung
der Bürger unmöglich zu machen. Das 1417 gebaute Schloss, das nur von einer Gartenmauer
umgeben war, musste eine wehrhafte Zwingburg werden. Die Stadt hatte das alte
Wingerhofertor, die anschließende Stadtmauer und zwei Türme rechts der Vils,
dann die Fortsetzung der Stadtmauer auf drei Bogen über die Vils, den
Zinnenturm am linken Vilsufer und das Bollwerk vor diesem Turm abzutreten.
Außerdem „durfte“ die Stadt ihm 3000 Gulden in drei Jahresraten
„verehren“. Später wurde die dritte Rate
erlassen.
Der Kurfürst ließ an Stelle der Stadtmauer im Süden einen
wehrhaften Schloss- und Torbau (Landratsamt) schaffen, von dem aus eine
Zugbrücke über den Schlossgraben ins Freie führte. Die Herrschaft war nunmehr
künftig nicht mehr auf die städtischen Tore angewiesen. Das Stadtgrabenstück im
Süden wurde verbreitert und vertieft und mit Mauern eingefasst. Zur Vils hin
schloss ebenfalls eine Mauer den Graben ab. Dahinter sammelte sich im Graben
all das Wasser aus einem größeren Einzugsgebiet zu einem kleinen Weiher. An der
Vils befand sich ein Wehr mit dem der Wasserstand zu regulieren war. Auf der
inneren Grabenmauer errichtete man eine feste Mauer mit Schießscharten in zwei
Stockwerken. Im Norden errichtete man westlich des „alten Schlosses“ einen
festen Torbau mit Waffenhof und einen hohen Turm, heute Fuchssteiner genannt.
Der alte schon vorhandene Graben nördlich vor dem alten Schloss, durch den das
Wasser einiger Quellen zur Vils floss, wurde breiter und tiefer ausgegraben und
vom Fuchssteiner ab weiter gen Süden bis zum alten Wingershofertor vergrößert.
Auch der innere Schlossgraben wurde mit Mauern begrenzt. Riesige Erdmassen
mussten hier ausgehoben werden. Mit ihnen füllte man die Vils so auf, dass sie
nur mehr durch zwei Bogen floss. Für die Vilsschifffahrt allerdings unbeabsichtigt
eine wesentliche Verbesserung. Die schon erwähnten Quellen füllten den neuen
inneren Schlossgraben. Der Auslauf zur Vils blieb unverändert. Zwischen
Fuchssteiner, Nordwestecke des neuen Schlossgebäudes und altem Wingershofertor
erstreckte sich die lange Mauer, die ebenso wie alle anderen Wehrmauern mit
Türmen verstärkt war. Von der damals entstanden Stadtbrille verlief bis zum
Auslauf des äußeren Stadtgrabens ebenfalls eine Wehrmauer mit Schießscharten in
zwei Stockwerken, die dem Vilslauf flankierten.
Der dritte Bogen der Stadtbrille wurde beiderseits geschlossen und der
dadurch gewonnene Raum von der Hofküche benutzt.
Aus dem Schlossareal war eine große, kaum angreifbare
Wasserburg geworden, deren stärksten Befestigungswerke stadtwärts lagen. Vom
damals wesentlich höheren Turm beim Tor zur Stadt war ein Gutteil Ambergs zu
kontrollieren. Wasser, Türme und Mauern trennten die kurpfälzischen Herren
künftig von ihren „Lieben, Ehrsamen, Getreuen“, die fürderhin weniger eigene
Befugnisse und Rechte, dafür aber mehr Abgaben hatten und ansonst um einiges
ärmer geworden waren.
Zu jenen, welche die Arrogation abgelehnt hatten, gehörte
auch Jörg Kastner dessen Geschlecht immerhin turnierfähig war. Ihm gehörten die
Hammerwerke Moos und Laubhof, er trieb Eisenhandel und war im Bergbau tätig. Er
war lange Zeit im inneren Rat und einige Jahre Bürgermeister gewesen. Im
Februar 1453 konnte er rechtzeitig fliehen, und Kurfürst Friedrich beschlagnahmte
sogleich seinen gesamten Besitz, neben den Hammerwerken, verschiedene Häuser in
Amberg, große Grundstücke um Amberg und Hab und Gut von einigem Wert. Doch aus
Rücksicht auf einflussreiche Verwandte und Freunde Kastners musste Friedrich
mit dem „Abtrünnigen“ verhandeln und ihm seinen Besitz 1455 zurückgeben. Am 14.
April 1455 versicherte der Hammerherr schriftlich, künftig ein getreuer und
gehorsamer Diener des Landesherrn zu sein und sich ohne dessen Genehmigung
nicht in Amberg oder Sulzbach niederzulassen. Kurfürst Friedrich versprach, ihn
als einen in seinen Landen Ansässigen bei seinen Geschäften zu schützen.
Kastner musste allerdings auf jede Entschädigung für
Einbußen an Besitz und Einkünften während der Nutzung durch den Kurfürsten verzichten.
Auch sein Schwiegersohn Jörg Baumgartner in Nürnberg verzichtete auf Ersatzleistungen
für solche Verluste. Was der Kurfürst an beweglichen Besitz und an Grundstücken
verschenkt, für sich genommen und veräußert hat, ist leider nicht bekannt.
Sehr hoch und dem Reichtum Kastners entsprechend war mit
1000 Gulden sein Strafgeld. Verständlicherweise hatte der „Begnadigte“ diese
Summe nicht bar. Sein oben genannter Schwiegersohn konnte ihm diesen Betrag als
Darlehen für ein Jahr geben. Als Pfand verschrieb ihm Kastner sein Haus mit
Hofraum am Marktplatz, die große Paint (Gründe nahe der Stadt) vorm Nabburgertor
und die Wiese jenseits der Vils beim Kloster. Kastner konnte schon nach einem
Jahr das Darlehen ablösen und durfte sich in Amberg 1457 wieder als Bürger
niederlassen. Bürgermeister und Rat verzichteten auf seine Bitte auf die
Steuern von 1455 – 1457 angesichts „seiner verderblichen Schäden so ihm
angestanden“. Von 1455 – 1459 war er wieder einer der vier Bürgermeister,
musste aber dann dies Amt aufgeben und starb 1467.
Erhard Frank, der Kastner von Vilseck, ein Mann in den
70iger Jahren und seine Familie wurden von Friedrich besonders hart behandelt.
Er dürfte sich 1453 geweigert haben, am 23. Februar das Aufgebot der Vilsecker
nach Hahnbach und weiter gen Amberg zu führen. Friedrich I. scheint ihn als
Hauptschuldigen am Misslingen jenes fragwürdigen Überfalls auf die Stadt
betrachtet haben. Spätestens am 6. Februar 1454, als Vilseck dem Statthalter
den Huldigungseid auf Friedrich leistete, wurde Frank verhaftet und ins
Gefängnis gesteckt. Es sollte es nicht mehr lebend verlassen. „Frank ist wegen
seiner Verbrechen ins Gefängnis gekommen und dort im September 1454 gestorben“,
schreibt der Heidelberger Chronist Mathias von Kemnath. Friedrich ließ daraufhin
sogleich einen Revers ausstellen, dass Agnes, die Witwe Erhard Franks „auf
alles Hab und Gut ihres Ehemanns verzichtet und solches Kurfürst Friedrich
übergeben hat“. – Eine sehr vornehme Umschreibung für Enteignung.
Nach dem Tod der Witwe um 1458 bemühte sich die Tochter
Barbara mit ihrem Ehemann Heinrich Bestler um die Rückgabe des väterlichen
Erbes. Auf ihr und ihrer Freunde „fleißiges Bitten“ hat sich der Kurfürst 1459
„so gnädig erwiesen und ihr und ihrem Schwiegersohn Hans Schlammersdorfer“ sämtlichen
1454 beschlagnahmten Besitz ihres Vaters „wieder gegeben“. Barbara Bestler und
Hans von Schlammersdorf aber, „begaben sich (entsagten) der anderen Güter und
Habe …, es sei Bargeld, Hausrat oder andere liegende und fahrende Habe ihres
Vaters, … so zu des gnädigen Herren Handen gekommen, aber durch sein Gnaden
einbehalten oder jemand anderem gegeben wurde“. Sie verzichteten ausdrücklich
„auf Schönlind, Irlbach und den Wald, das Ole (Ölhof) genannt, mit allem Zubehör“,
und haben ferner auf den Ersatz „der Schäden, die ihre Güter gelitten haben“ am
Montag nach Oculi 1459 verzichtet.
Friedrich hatte also 5 Jahre recht großzügig Franks Nachlass
verwaltet. 1457 hat er z. B. Conz Schrott den Jüngeren für geleistete Dienste
mit dem Dorfe Schönlind beim Hammer Bruck „begnadet“. Wie Conz Schrott wurden
sicher viele andere mit beschlagnahmten Gütern kurfürstlich belohnt.
Der Tod des alten Erhard Franks im Gefängnis verdient
besondere Beachtung. Die Hofchronisten, die über Friedrich nur Lobenswertes
berichten und alles was er tat, berechtigt finden, führen an, dass der Kurfürst
grundsätzlich Abtrünnige mit dem Tod bestrafte, es sei denn, sie hätten sehr
hohe Fürsprecher. Sie führen dafür Beispiele an: 1470 nahm der Kurfürst bei der
Eroberung von Armesheim 40 Fußknechte gefangen, die früher einmal der Kurpfalz
unterstanden. Er betrachtete sie als Abtrünnige und „fürbass begunnd man die zu
fueren bis hin gen Altzen (Alzey) in die Tuerm, drinn mussten sie erfaulen“.
Ähnlich handelte Friedrich 1471 nach der Eroberung von Wachenheim. 53
Gefangene, darunter solche, die wider seine Gnad gehandelt haben und seine
Leibeignen waren“, wurden ertränkt. – Erhard Frank war für ihn ein
„Abtrünniger“. Die verhängte strenge Haft war das Todesurteil für den alten
Mann.
Die Amberger mussten sich fürderhin Friedrichs Willen fügen,
und sie betrachteten die ihnen aufgezwungenen Eide als bindend. Friedrich war
weiterhin ein strenger Herr gegen jene, die ihm 1453/54 die Huldigung
verweigert hatten. Das Gesuch des 1454 ausgewiesenen Hans Seidl um die
Erlaubnis endlich heimkehren zu dürfen, lehnte er 1460 ab. Der Stadtschreiber
Hans Schober, der 1454 entlassen worden war, aber 1460 von der Stadt wieder
angestellt wurde, musste 1468, also nach 14 Jahren endgültig entlassen werden.
Schobers Rechtfertigungsschreiben half ihm nichts.
Auch nach 1454 musste die Stadt noch manche Einschränkung
ihrer Rechte hinnehmen. Schon 1455 hat Friedrich seine Einspruchsmöglichkeiten
beim Bergbau erreicht. Ab 1466 fordert er auch das Mitspracherecht bei der Jurisdiktion
der Hammereinigung. Er verlangte unter anderem die Hälfte der Strafgelder.
Bislang war die Hammereinigung nur eine von Amberg und Sulzbach geführte
Vereinigung der Oberpfälzer Hammerwerke. Wo es aber um seinen Nutzen auch ging,
setzte er sich für die Bürger ein. So begehrten die Sulzbacher 1455/56 freie
Schifffahrt auf der Vils für Erz und Eisen. Ihr Landesherr, Herzog Albrecht
III. in München und Kaiser Friedrich III. unterstützten nachdrücklich dieses
Verlangen. Doch Friedrich I. verteidigte die alten Vorrechte Ambergs auf der
Vils nachdrücklich, unbeugsam und erfolgreich.
Besonders verbunden war Friedrich den Amberger
Franziskanern. So kam er am 11. April 1455 zur feierlichen Grundsteinlegung des
Klosters und spendete als Bauzuschuss 100 Gulden. Das war allerdings sehr
bescheiden, denn nicht nur hatte er im Vorjahr ein Vielfaches der Stadt Amberg
und ihren Bürger abgepresst, sondern mancher Amberger Bürger hat ein Mehrfaches
für das Kloster gestiftet als der Kurfürst. Friedrich kam noch öfter nach
Amberg, schon um sich von den Fortschritten der Bauarbeiten an seiner Stadtburg
zu überzeugen. Gelegentlich wandte er sich sogar an Amberger Bürger in finanziellen
Angelegenheiten. Ohne lange Verhandlungen leistete ihm der Berggewerke und
Eisenhändler Hans Klopfer Bürgschaft für 900 Gulden und Wilhelm Ortenburger für
800 Gulden.
1454 hatten die Amberger zwar alle Waffen abliefern müssen,
doch der wehrlose Zustand konnte nicht lange dauern. Die Stadt musste sich
schließlich selbst verteidigen können. Nach kurzer Zeit konnten die Amberger
Büchsenschützen wieder ihre Schießkünste ausüben.
Solange Friedrich sich hauptsächlich mit seinen
rheinpfälzischen Nachbarn, besonders mit seinem Vetter Pfalzgraf Ludwig von
Veldens herumschlug, war Amberger Waffenhilfe nicht gefragt. Das änderte sich,
als 1460 Markgraf Albrecht Achilles von Ansbach im Bunde mit vielen Fürsten
gegen Friedrich kämpfte und seine Ritter in kurpfälzische Gebiete des Nordgaus
einfallen ließ. Darauf hin zog der Amberger Vicedom mit einem kleinen Aufgebot
der Stadt und des Umlandes ins Fränkische und zerstörte zwei Burgen. 1461 jedoch
befahl wahrscheinlich der Kurfürst selbst ein allgemeines Aufgebot aller
Wehrfähigen, und der Statthalter führte Reiterei und Fußvolk samt der „Wagenburg“
in die Markgrafschaft. Neustadt am Kulm, Weißenstadt, Creußen, Schnabelweiß und
viele weitere Städte und Märkte eroberten die Kurpfälzer und brannten alles
nieder. Über 100 Dörfer gingen in Flammen auf. Kein Heer des Markgrafen hinderte
sie an ihrem Tun. 1500 Rinder und viele Wagenladungen mit Beutegut brachte man
zurück nach Amberg, wo „billiger Markt“ gehalten wurde. Die Amberger und die
Kurpfälzer im Nordgau hatten das „Kriegen“ in jeder Form rasch gelernt. Der
Krieg erfasste schließlich halb Deutschland. 1462 sprach der Papst den Kirchenbann
über Friedrich aus und der Kaiser verkündete ihm die Reichsacht und den
Reichskrieg.
Friedrich aber besiegte 1462 bei Seckenheim seine
benachbarten Gegner, zersprengte ihr Heer und machte 500 Gefangene, darunter
Markgraf Karl von Baden, Graf Ulrich von Württemberg, den Bischof von Metz und
viele Grafen, Ritter und Adelige. Der Kurfürst ließ sich auch diesen Sieg
reichlich mit Lösegeld vergolden. Graf Ulrich von Württemberg z. B. musste
100.000 Gulden zahlen. Die rheinpfälzischen Burgen reichten kaum aus, um all
die vornehmen Gefangenen gut und sicher zu verwahren, bis sie ihr Lösegeld
bezahlt hatten. Kurz darauf siegte Herzog Ludwig von Landshut, der einzige
treue Verbündete Friedrichs, bei Gingen über den Markgrafen von Ansbach /
Hohenzollern. Beide Wittelsbacher hatten sich siegreich gegen eine große
Übermacht durchgesetzt und überall in ihrem Landen feierte man diese Erfolge,
sicher auch in Amberg. Man war schließlich Sieger, und gemeinsame militärische
Erfolge fördern auch die Verbundenheit zwischen Landesherrn und Untertanen.
Friedrich der Siegreiche verdankt einen beachtlichen Teil
seiner Erfolge einem Amberger, dem Geschützmeister Martin Mertz. General
Dollacker nimmt an, dass dieser als Sohn des Türmers und Rechenmeisters Mertz
in Vilseck geboren wurde. 1438 übernahm der alte Mertz die Türmerstelle auf dem
Amberger Martinsturm, die er bis 1458 inne hatte. In Amberg besuchte Martin die
Lateinschule, denn er beherrschte später diese Sprache. Mathematik dürfte ihm
sein Vater beigebracht haben. Bei einem Amberger Glocken- und Geschützgießer
ging er in die Lehre und wurde Meister. Besonders pflegte er den praktischen
Umgang mit Feuerwaffen und wurde so Geschützmeister. 1460 hatte er bereits
Erfahrung und trat in den Dienst Friedrichs I.. Beim Feldzug gegen Mainz bewies
er dann sein Können. Bei der Belagerung von Kleinbockenheim beherrschten die
Bürger vom Wehrturm ihrer Kirche aus das Vorfeld der Stadt. Dank seiner
Treffsicherheit richtete Mertz diesen Turm so zu, dass er nicht mehr benutzt
werden konnte und die Kleinbockenheimer kapitulieren mussten. 1469 wurde Mertz
nach vielen Einsätzen zum Obersten Geschützmeister der Kurpfalz befördert. Dank
seiner Schießkunst und seines großen Geschützes, der Basteinerin mussten die
Burgen Bocksberg und Schupf nach kurzer Zeit kapitulieren. Im Feldzug 1470/72
schoss er Schiersheim, die Strahlenburg, Arnsheim, Stadt und die Schlösser
Wachenheim, Bockenheim, Niederulm, Lambsheim, Ruprechtseck und Dürckheim sturmreif.
Michael Boehm reimt bei Wachenheim:
… es ruckten Gesellen frisch und voll Mut,
wohl vierzig Büchsenschützen gut,
die die von Amberg hätten,
geschickt an solche Stätten.
Ihr Hauptmann der mit ihnen kam,
Jörg Gutzinofen war sein Nam
die schossen allzeit von dem Schloss
in diese Stadt mit Büchsen groß.
Mathias von Kemnath schreibt von der Belagerung der Stadt
Dürkheim: „Besonders hatte Friedrich zwei sehr gute Büchsenmeister für das
Schießen mit großem Geschütz und zwar so wirksam, wie es Friedrich je
vorgekommen ist. Dazu kamen 40 sehr gute Büchsenschützen mit Schlangen
(Feldschlangen), Voglern und Hakenbüchsen von Amberg.“ Man kann annehmen, die
Amberger haben auch die Geschütze mitgebracht. 372 Tonnen Schießpulver hat
Mertz in diesem Krieg verschossen.
Und wieder dichtet Michael Boehm:
Als der kunstreich Meister Martin
in solchen Haufen gern schoss hin,
wie ich einstmals sah, als er schuss
aus einem Hauptstück tat einen Schuss
dass Arm und Haupt aufstuben,
gen Himmel sich erhuben.
 Amberg
ist die einzige kurpfälzische Stadt, deren militärische Hilfe die beiden
Chronisten Friedrichs erwähnenswert fanden, und nur Martin Mertz und Jörg
Gutzinofen haben sie sogar persönlich gerühmt.
Amberg
ist die einzige kurpfälzische Stadt, deren militärische Hilfe die beiden
Chronisten Friedrichs erwähnenswert fanden, und nur Martin Mertz und Jörg
Gutzinofen haben sie sogar persönlich gerühmt.
Nach 1472 war Mertz nicht mehr im Kriegseinsatz. Er
beschäftigte sich in Amberg, wo er ein Haus besaß und eine Einheimische
geheiratete hatte mit Geschoßkonstruktionen, Geschützlafetten, Schießlehre und
Pulvermischungen. Er unterrichtete ferner Geschützmeister in der Schießlehre.
1472 kam das Amberger Aufgebot wieder zum Einsatz nachdem
böhmische Adelige raubend und plündernd in die pfälzischen Lande eingefallen
waren. Die Vicedom zog über den Wald (Böhmerwald), man eroberte die Burg Dissaw,
erschlugen viele der Besatzung und zerstörten die Burg bis auf den Grund. Der
Schlosshauptmann Reb wurde nach Amberg gebracht und kam in strenge Haft.
Erst 1486 wird wieder von einem Einsatz des Meisters Mertz
berichtet. Kurfürst Philipp belagerte Schloss Geroldseck eine große ausgedehnte
Burganlage mit Mauern die über 2 m dick waren. Kurfürst Philipp hatte ein
stattliches Heer aufgeboten. 1800 Reiter, 4000 Gewappnete, 250 Schweizer
(Söldner) und 1600 Landsknechte. Beachtlich war die von Mertz eingesetzte
Artillerie. Die großen Geschütze hatten wieder Namen: „Ballauf“, „Neidhart“,
„Baslerin“, „Pfalz“, „Löw“ und „Narr“. Dazu kamen 24 Schlangen (lange Rohre),
25 Sturmbüchsen und 30 Vogler (Hinterladergeschütz). Sechs Wochen lang beschoss
Mertz die starken Mauern und dann war die Feste sturmreif und ziemlich
demoliert und kapitulierte.
Er lebte dann weiterhin in Amberg, beschäftigte sich noch
immer mit Schießlehre und verfasste dazu sogar ein Buch. 1501 starb er und
wurde bei St. Martin beerdigt. Sein kunstvoller Grabstein ist wahrscheinlich
ein Denkmal, das ihm sein Kurfürst setzen ließ.
Die Inschrift beweist
dies.
Anno domini 1501 jar
am tag vitalis ist verschieden der erber meyster martin mercz buchssenmeister
in der kunst mathematica buchssenschiessen vor andern berumt der seynn hercz
und wergk aleg zu aufnemen der pfalcz vor andern furstenthum bis an seyn endt geseczt
und getreulich gedynet des sele got gnedig und barmherzig sey.
So streng Friedrich jene, die für ihn Abtrünnige waren,
abstrafte, so großzügig musste er bald mit seinen eigenen Versprechungen fertig
werden. Bei der Arrogation hatte er versprochen, auf Ehe, Liebe und Kinder zu
verzichten, um sich dem Wohl der Kurpfalz und des kleinen Philipp widmen zu können.
Die Kurwürde und die lebenslange Herrschaft waren ihm mit 25 Jahren mehr wert
als Ehe und Kinder, und er beschwor zölibatär zu leben. Kaum acht Jahre später
aber dachte er anders, hatte als ständige Gefährtin die Bürgerstochter Clara
Dett aus Augsburg, die einige Zeit Hofjungfer beim Münchner Herzog Albrecht
gewesen ist. 1461 und 1463 wurde der Kurfürst Vater von „zwen huebscher, natuerlicher
sone“ und er war ihnen allem Anschein nach ein guter Vater.
Doch uneheliche Kinder hatten es damals schwierig.
Handwerksmeister durften sie z. B. nicht als Lehrlinge nehmen und für Kleriker
war eheliche Geburt Voraussetzung. Kurfürst Friedrich unternahm alles, um
seinen Wildfängen den Lebensweg zu erleichtern. Er ließ sich das einiges
kosten. Vom Papst erwarb er eine Bulle, die seinen ältesten Sohn Friedrich als
ehelich erklärte. Weitere Urkunden bestätigten dem Zehnjährigen als künftigen
Kanonikus von Worms und Speyer, und schließlich wurde ihm sogar noch die Stelle
eines päpstlichen Protonotarius (Oberschriftführer) zugesichert. Eine Pergamenturkunde
des Hochstiftes Speyer machte, kraft eines dem Stift verliehenen Privilegs
Kaiser Karls IV., seine beiden Söhne zu allen weltlichen Sachen ehelich. Er
wollte aber auch die Mutter seiner Kinder versorgt wissen und verschrieb ihr
Hausbesitz in Heidelberg, Worms und Darmstadt und legte für sie 5000 Gulden bei
verschiedenen Städten zu 5% an. Auch für jeden seiner Söhne standen 5000 Gulden
samt den entsprechenden Zinsen zur Verfügung, wenn sie in die Jahre gekommen
waren. – Eigentlich wollte er Geld nur zum Nutzen der Kurpfalz verwenden,
allerdings kam es selbst auf diese hohe Ausgabe nicht an. Die Einnahmen des
Landes waren entsprechend gewachsen.
Friedrich war nunmehr unehelicher Vater zweier ehelicher
Söhne und einer ledigen Mutter. Das Versprechen bei Philipps Arrogation war damit
gebrochen. Doch ohne Erlaubnis einer irgendwie zuständigen Stelle oder Person
wollte er diesen seltsamen Familienstand nicht beenden. Seinen Adoptivsohn
Philipp, der inzwischen ja großjährig geworden war, bat er am 24. Januar 1472
um die Erlaubnis, Clara Dettin heiraten zu dürfen. Philipp hatte keine
Einwände, er gedachte ja ebenfalls demnächst zu heiraten. Clara und ihre Söhne
verzichteten daraufhin auf alle kurfürstlichen Würden, Rechte und Ehren, und
kurz darauf fand die Trauung zwischen dem Kurfürsten und seiner Clara in aller
Stille statt.
Nun blieb Friedrich nur, für seinen jüngsten Sohn Ludwig
eine entsprechende Stellung zu schaffen. Schwer fiel dies Friedrich nicht.
Seine kriegerischen Erfolge und seine Macht hatten die Kurpfalz sehr vergrößert.
40 größere und kleinere Herrschaften mit vielen Städten, Märkten und Dörfern
hatte er erobert, 30 weitere konnte er durch Kauf, Verträge und „gütige
Abmachungen“ erwerben. - Wohl hatte Friedrich einst versprochen, alles was er besitzt,
erwirbt und erobert verbleibt der Kurpfalz. Doch angesichts dieser unerwarteten
Vergrößerung des Fürstentums konnte man das Versprechen vergessen. Die 15
Herrschaftsgebiete, die er für Ludwig zu einer eigenen Grafschaft Wertheim /
Löwenstein vereinte, schmälerten den Zuwachs der Kurlande nur unwesentlich.
Vertraglich wurde besonders auf die freundschaftlichen Beziehungen zwischen
beiden Fürstentümern Wert gelegt. Die Löwensteiner Grafen sollten z. B., wenn
sie etwas verkaufen wollten, Länderbesitz erst der Kurpfalz anbieten. – Noch
heute leben Nachkommen Friedrichs des Siegreichen als Grafen von Löwenstein und
Wertheim unter uns.
Die Macht und das Ansehen der Kurpfalz konnte nach
Friedrichs Ansicht sein Sohn Philipp durch eine gute Partie am besten
vergrößern. Die Gräfin Sophia von Katzenellenbogen, Erbin einer größeren
Grafschaft hätte die Kurpfalz gut abgerundet. Philipp lehnte ab. Kurfürst
Friedrich empfahl ihm Maria, die Tochter Karls des Kühnen, Erbin eines großen
Reiches zwischen Deutschland und Frankreich mit dem wohlhabenden reichen
Holland und Flandern und dem sehr angesehen Herzogtum Burgund. Eine
mitteleuropäische Großmacht wäre die Kurpfalz geworden, wenn Philipp seinem
Vater gefolgt hätte.
Dieser aber bestand darauf Margareta, die Tochter Ludwigs
des Reichen zu heiraten. Wie der Titel des Vaters schon vermuten lässt, wars
keine schlechte Partie. Vom 19. bis 22. Februar 1474 dauerten die aufwändigen
und von vielen vornehmen Gästen besuchten Hochzeitsfeierlichkeiten in Amberg.
Das Programm dafür hatte der Kurfürst selbst genau festgelegt, teil genommen
hat er aber nicht. Wieder musste Friedrich mit der Reichsacht rechnen und als
Geächteter konnte er kaum Reichsfürsten und Verwandte des Kaisers empfangen.
Erst nach der Hochzeit bekam Philipp im April 1474 die
kurpfälzischen Lande um Amberg als seine Herrschaft übertragen, nachdem er
schon zehn Jahre lang volljährig war. Er durfte jedoch nur die entsprechenden
Einnahmen genießen, die Regierungsgewalt gab Friedrich nicht aus der Hand. Er
besetzte weiterhin die Amtsstellen, nahm und verlieh die kurpfälzischen Lehen,
und alle Amtsinhaber waren nur dem Kurfürsten verantwortlich. Seinen Räten in
Amberg teilte er mit, dass Philipp „nichts im Lande verkaufen oder verpfänden“
dürfe. Das Land war ihm nur auf „Widerruf“ überlassen. Friedrich bestand
darauf, „Philipps Lande zu ordnen und zu setzen wie es ihm dünkt“.
Trotzdem herrschte zwischen dem jungen Pfalzgrafenpaar und
dem Rat der Stadt Amberg ein entgegenkommendes, gutes Verhältnis. Der Rat der
Stadt besaß schließlich weitgehende Selbstverwaltung. Über Geldangelegenheiten
z. B. verhandelten Bürgermeister und Rat mit dem Pfalzgrafen, ohne sich um
Heidelberg zu kümmern.
Kurfürst Friedrich besuchte Amberg nicht mehr. Er war ab Mai
1474 in Reichsacht, weil er sich weigerte, die Herrschaft der Kurpfalz dem
nunmehr volljährigen Philipp zu übergeben und die hohen Lösegeldforderungen
ganz oder teilweise zu erlassen. Nicht herausgeben wollte er zudem einige
Reichsbesitzungen im Elsass. - Vollziehen wollte allerdings niemand die
Reichsacht.
Als Geächteter konnte Friedrich 1475 nicht zur Landshuter
Hochzeit reisen. Der junge Herzog Georg von Niederbayern, der Bruder
Margaretas, der Gemahlin von Friedrichs Sohn Philipp heiratete die polnische
Königstochter Hedwig. Der Vater des Bräutigams, Herzog Ludwig war ein alter
Waffengefährte Friedrichs. Bei der Hochzeit zu Landshut, die jene des Vorjahres
in Amberg an Aufwand, Gästen und Festlichkeiten noch weit übertraf, erfuhr
Pfalzgraf Philipp besondere Beachtung. Der ebenfalls anwesende Kaiser Friedrich
III. empfing ihn freundlich als pfälzischen Kurfürsten, und Philipp leistete
willig alle Dienste, die mit der pfälzischen Kurwürde verbunden waren. Viele
der anwesenden weltlichen und geistlichen Fürstlichkeiten folgten dem
kaiserlichen Vorbild. – Unbekannt ist, wie Friedrich der Siegreiche diese
Aufwertung seines Adoptivsohns empfunden hat.
Seine letzten zwei Jahre brachten dem wahrscheinlich bereits
kranken Kurfürsten manche Betrübnis. 1475 starb im Alter von 15 Jahren sein
Sohn Friedrich als päpstlicher Protonotar und Domherr zu Worms und Speyer. Von
kriegerischen Unternehmungen Friedrichs wird nichts mehr berichtet. Nur von
Verleihungen mehrerer Benefizien und einer Mesnerstelle steht etwas in den Regesten.
Im Frühjahr 1476 starb dann sein Hofkaplan und Chronist Mathias von Kemnath,
und am 12. Dezember des Jahres endete das Leben des Kurfürsten nach 51
Lebensjahren, von denen er zwei als Phlipps Vormund und 25 als Kurfürst regiert
hat.
Zur Beerdigung am 29. Januar 1477 reiste Pfalzgraf Philipp
nach Heidelberg. Nicht in der stattlichen Heiliggeistkirche, der Ruhestätte
einiger seiner Vorgänger, sondern in einer kleinen von Friedrich gestifteten
Kapelle des schlichten Franziskanerklosters wünschte er begraben zu werden. Auf
Pracht und Herrlichkeit legte er keinen Wert mehr. Aufgebahrt und beigesetzt wurde
er in der schlichten Kutte der Franziskaner. Seine Grabstätte ist nicht mehr
erhalten. Sie wurde 1689 bei der Zerstörung Heidelbergs von den Soldaten Ludwigs
XIV. von Frankreich völlig demoliert.
Pfalzgraf Philipp wurde in Heidelberg von seinen Untertanen,
Dienstleuten und vom Klerus sogleich als Kurfürst gehuldigt. Anschließend nahm
er die Huldigung in den rheinpfälzischen Landen entgegen. Nach Amberg und in
den Nordgau reiste er im April 1477 „mit 230 Pferden, etwann Rittern und Grafen
darunter“. Die Herren des Amberger Rates
ritten ihm mit Pfeifern, Trommlern und Trompetern entgegen und haben
ihren „natürlichen, gnädigen Herrn“ mit Musik in die Stadt geleitet zum
festlichen Empfang durch die Bürger. Am Mittwoch nach dem Passionssonntag
huldigten Bürgermeister, Räte und Bürger und die ganze Gemein ihrem gnädigen
Herrn Kurfürst Philipp. Bereits vor 28 Jahren hatten sie ihn als kleines Kind
bereitwillig ihre Eide geleistet, dann ihrem Eid gemäß handeln wollen und Leben,
Freiheit und Hab und Gut riskiert, ehe sie dem siegreichen Friedrich huldigen
mussten. Nun war Philipp ihr Kurfürst und für 31 Jahre ihr wohlwollender
Regent.
 Links des Hauptportals
von St. Martin ist dem Mauerwerk eine auffallend schöne Steinplatte aus rotem
Marmor eingefügt. Ungewöhnlich ist schon ihr Breitformat. Rundbogenarkaden
gliedern die Fläche, wobei das Mittelfeld die doppelte Breite eines der übrigen
vier Felder hat und zudem durch einen „Eselsrücken" noch vergrößert ist.
Eine zeitlos wirkende Kreuzigungsgruppe bildet die Mitte des Steines. In den
rechts und links anschließenden Arkaden stehen die Bischöfe St. Nikolaus und
St. Wolfgang. Die äußeren Felder füllen prächtig gestaltete Wappen.
Links des Hauptportals
von St. Martin ist dem Mauerwerk eine auffallend schöne Steinplatte aus rotem
Marmor eingefügt. Ungewöhnlich ist schon ihr Breitformat. Rundbogenarkaden
gliedern die Fläche, wobei das Mittelfeld die doppelte Breite eines der übrigen
vier Felder hat und zudem durch einen „Eselsrücken" noch vergrößert ist.
Eine zeitlos wirkende Kreuzigungsgruppe bildet die Mitte des Steines. In den
rechts und links anschließenden Arkaden stehen die Bischöfe St. Nikolaus und
St. Wolfgang. Die äußeren Felder füllen prächtig gestaltete Wappen.
Die Inschrift fasst als breites Band den Stein ein, obere
und untere Zeile stehen normal zum Betrachter, man kann also ohne Kopfverrenken
lesen, dass „der. Erberg (ehrbar), man. Hanns. Klopffer. Purger. tzu. amberg. am.
suntag. Jubilate." starb. Römische Ziffern nennen an der linken Randleiste
das Sterbejahr 1473.
Der Stein hat sicher nie das Grab Klopfers gedeckt. Er ist
so gestaltet, dass er senkrecht an einer Wand anzubringen war, um so Rang,
Reichtum und Frömmigkeit des Toten zu zeigen.

Grabstein der Berggewerken Hans Klopfer, + 1473.
Nördliche Außenwand zu St. Martin.
Wer war nun dieser Hans Klopfer, der ein so adeliges Wappen
führte und sich stolz als Bürger verewigen ließ? Die Volksüberlieferung weiß nichts
mehr von diesem Amberger. Archivalien im Stadtarchiv können dagegen einiges an
dieser in 500 Jahren allmählich vergessenen Persönlichkeit aufhellen, und eine
ferne Vergangenheit uns näher bringen.
Um 1410 wurde Hans Klopfer in Weiden geboren. Goldschmied
war dort sein Vater, doch so wohlhabend, wie man nach diesem Beruf annehmen
möchte, war die Familie nicht. Weidens Entwicklung unterschied sich in den
ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts sehr von dem ruhigen Fortschreiten Ambergs.
1400 hatte König Ruprecht Weiden dem Böhmenkönig abgenommen, die Kämpfe in
diesem grenznahen Land gingen weiter bis 1410. Kurfürst Ludwig verpfändete
anschließend die Stadt an Herzog Ludwig von Ingolstadt, was Pfalzgraf Johann,
der über weite Gebiete der Oberpfalz herrschte, gar nicht gefiel. Johann
verbündete sich mit dem Burggrafen von Nürnberg, und 1421 standen die Aufgebote
dieser Fürsten vor Weiden. Trotz hartnäckiger Verteidigung wurde die Stadt im
Sturm genommen und durchlitt all die Schrecken und Nöte einer gewaltsamen
Eroberung. Pfalzgraf und Burggraf übernahmen gemeinsam das Regiment im Weidener
Land.
Kaum dass die Mauern ausgebessert und verstärkt waren,
begannen die schlimmen Hussitenjahre. Ab 1426 stürmten fast jedes Jahr die
fanatischen Kriegshaufen über den Böhmerwald. Weiden war zwar einer jener
wenigen Orte, die nie von den Hussiten belagert wurden, doch die Not des
Umlandes zehrte auch den Wohlstand der Stadt auf. So stark war Weidens Befestigung,
dass die Stadt 1427 und 1431 zum Sammelpunkt des Reichsheeres gewählt wurde.
Den siegessicheren Aufbruch gegen Böhmen erlebten hoffnungsvoll die Bürger, und
jedes Mal sahen sie kurz darauf die flüchtenden Haufen deutscher Kriegsknechte
durch ihre Stadt hasten. Erst 1434 endete diese schreckensvolle Zeit. - Die
Volksüberlieferung hat sie bis heute nicht vergessen.
Wo Schwert und Morgenstern regieren, kann ein kunstreicher
Goldschmied wenig erhoffen. Hans Klopfer, der all die Not seiner Geburtsstadt
mittragen musste, wandte sich gleich gar nicht dem Beruf seines Vaters zu.
Lehrer wurde er. Als ihm der Abt von Waldsassen für seine Dienste einige Zehentrechte
übertrug, konnte Lehrer Klopfer mit seinen Einkommensverhältnissen durchaus
zufrieden sein. Sie reichten aus für den Lebensunterhalt einer Familie.
Als Schulmeister Klopfer heiratete, konnte ihm sein Vater
nur 30 fl geben. Seine Auserwählte, deren Namen wir nicht wissen, brachte ihm
jedoch gut das Zwanzigfache an Mitgift in die Ehe. Jetzt konnte sich Klopfer
auch im Warenhandel und in Geldgeschäften betätigen. Wie er es mit der Schule
hielt, wissen wir nicht. Dann starb seine Frau, er kam in den Besitz ihres
Vermögens und hatte nun 700 Gulden zu versteuern. - Mit dem Frieden begann sich
allmählich der Wohlstand des Landes zu heben. Für einen Mann mit dem Unternehmungsgeist
Klopfers ergaben sich gute Geschäftsgelegenheiten. Wahrscheinlich wandte er
sich schon in Weiden dem Eisenhandel zu.
Reich jedoch wurde Klopfer erst durch seine 2. Ehe mit der
Witwe Elisabeth Markhart. Einiges wissen wir auch von ihrem Leben. Ihr Vater,
Hans Unrue, wird sowohl als Metzger als auch als Ofensetzer, immer aber als
wohlhabender Bürger bezeichnet. Im bösen Jahr 1421 hat man ihn bei der
Verteidigung Weidens totgeschossen. Die Waise Elisabeth Unrue heiratete in
jungen Jahren Ulrich Markhart, einen Weidener Bürger, der als Händler zu
einigem Reichtum gekommen war. Lange währte diese Ehe nicht, von einer Pilgerfahrt
nach Rom kehrte Ulrich nicht zurück. Elisabeth war einzige Erbin. Zehent- und
Giltrechte, Häuser und Feldgründe und ein Barvermögen von 1800 fl brachte sie
mit in ihre zweite Ehe.
Kurz nach der zweiten Hochzeit dürfte Hans Klopfer eine
stattliche Kapelle auf dem Fischerberg bei Weiden erbaut haben. Wahrscheinlich
war an dieser Stelle schon seit Jahren ein Heiligenbild, das an einem Baum
befestigt war, von frommen Leuten verehrt worden. Die Kapelle hieß nämlich
fortan „Zur heiligen Staude" oder auch „die heilige Staude". Der Sage
nach soll allerdings ein reicher Bürger Weidens in schwerer Krankheit den Bau
einer Kapelle gelobt haben. Er wurde gesund und wusste nun nicht, wohin er das
Kirchlein stellen sollte. Zwei Ochsen mussten den Bauplatz angeben. Er ließ sie
frei laufen, am Ort ihrer ersten Rast wurde die Kirche errichtet.
Sagenhaft ist manches bei dieser Kapelle am Fischerberg,
sicher aber wissen wir, dass sie Hans Klopfer gehörte und dem heiligen Wolfgang
und der hl. Helena geweiht war. Wolfgang war nämlich der Lieblingsheilige des
Kapellenbesitzers Klopfer. Vielleicht erinnert die Mitpatronin St. Helena an
seine erste Frau; möglicherweise hieß sie Helene.
 Mehr und bessere
Gelegenheiten zu gewinnbringender Geldanlage als Weiden bot damals die
kurpfälzische Residenzstadt Amberg. 1444 bewarben sich die Klopfers um das Amberger
Bürgerrecht. Das kostete nicht viel, Bürgermeister und Rat Ambergs freuten sich
über diesen Neubürger, der fortan sein großes Vermögen an der Vils versteuern
wollte.
Mehr und bessere
Gelegenheiten zu gewinnbringender Geldanlage als Weiden bot damals die
kurpfälzische Residenzstadt Amberg. 1444 bewarben sich die Klopfers um das Amberger
Bürgerrecht. Das kostete nicht viel, Bürgermeister und Rat Ambergs freuten sich
über diesen Neubürger, der fortan sein großes Vermögen an der Vils versteuern
wollte.
Als Amberger Bürger konnte Klopfer nunmehr am Eisenhandel
nach Ulm und Schwaben teilnehmen. Den billigen Wasserweg auf Vils, Naab und
Donau durften ja nur die Amberger zollfrei mit ihren Eisen-, Erz - und
Salzfrachten benutzen, ein sehr einträgliches Vorrecht. Das „bayerische
Eisen" aus der „Eisenstadt Amberg" beherrschte dank der günstigen
Frachtkosten konkurrenzlos den schwäbischen Markt. Klopfer verstand es, diese
Situation zu nutzen.
Als Amberger Bürger durfte er auch im Bergbau tätig werden.
So wohlhabend war er, dass er sich keiner Gesellschaft anschließen brauchte. Er
konnte allein alle Risiken tragen, verfügte aber auch alleine über die Gewinne.
Reicher Bergsegen war ihm beschieden. Seine Erzgrube, „Klopferin" hieß sie
noch nach Jahrzehnten, galt als besonders ergiebig.
Die Erfolge stärkten sein Selbstbewusstsein. Ein prächtiges
Wappen mit allem heraldischen Beiwerk, mit Helm und Helmzier ließ er sich
schaffen. Im Schild aber zeigten drei Berghämmer nicht nur seinen Namen,
sondern auch sein Betätigungsfeld. Auch seine Frau bekam ein Wappen, vielleicht
eine Fortentwicklung der Hausmarke ihres Vaters.
Schon 1450 vertrat der „ersam und weis" Hans Klopfer
gemeinsam mit Conrad Alhard und Hans Kastner, zwei Angehörigen alteingesessener
Ratsfamilien, die Stadt Amberg bei verschiedenen Gelegenheiten. 1451 übernahm
er die Verwaltung der Martinskirche. Der Chor der neuen Kirche stand damals
kurz vor der Vollendung. Durch seine Tätigkeit und reichliche Beiträge erwarb
er sich den Anspruch auf eine eigene Kapelle in diesem Gotteshaus. Ab 1453 verwaltete
er gemeinsam mit Hans Bachmann, der das Franziskanerkloster gestiftet hatte
und ebenfalls ein erfolgreicher Ulmfahrer war, das umfangreiche Amberger Bürgerspital.
Als 1452 Friedrich I. die Stadt überfallen ließ, stand Hans
Klopfer im eigenen Harnisch, bewaffnet wie ein Rittersmann, auf der Stadtmauer.
Anschließend jedoch riet er zu Verhandlungsbereitschaft und Nachgiebigkeit.
Die Eroberung Ambergs und das Strafgericht Friedrichs I.
brachten ihm keine Nachteile. In der städtischen Gemeinschaft des
Eisenbergwerks, die nach 1454 gegründet werden musste, hatte niemand einen höheren
Anteil als Klopfer. Auf 500 Gulden lautete sein Brief 1456.
 Reichtum verpflichtet.
Wie andere angesehene Bürger hat auch Hans Klopfer das seine beigetragen zum
Bau von St. Martin, zu dieser bewundernswerten Gemeinschaftsleistung der
Amberger. 1457 stiftete er zudem noch eine „ewige Messe" zu Ehren des
heiligen Wolfgangs, die auf dem Nikolausaltar in der Klopferkapelle zu lesen
war. Dem Seelenheil der Klopferschen Eheleute und deren Vorfahren, besonders aber der Seelenruhe des Ulrich
Markhart, des ersten Mannes der Klopferin, ist diese Stiftung gewidmet.
Reichtum verpflichtet.
Wie andere angesehene Bürger hat auch Hans Klopfer das seine beigetragen zum
Bau von St. Martin, zu dieser bewundernswerten Gemeinschaftsleistung der
Amberger. 1457 stiftete er zudem noch eine „ewige Messe" zu Ehren des
heiligen Wolfgangs, die auf dem Nikolausaltar in der Klopferkapelle zu lesen
war. Dem Seelenheil der Klopferschen Eheleute und deren Vorfahren, besonders aber der Seelenruhe des Ulrich
Markhart, des ersten Mannes der Klopferin, ist diese Stiftung gewidmet.
Ein eigener Messkaplan musste Woche für Woche mindestens
fünf heilige Messen laut Stiftungsbrief während des täglichen Hochamts in St.
Martin lesen. Ansonsten hatte er keine Verpflichtungen. Er konnte sich aber
freiwillig als Lehrer, Chorsänger und Buchabschreiber betätigen.
Dem Benefiziaten standen für seinen Dienst am Klopferaltar
hohe Getreideabgaben aus zwei Höfen in Pirk bei Weiden, dann der 7. Teil des
Großzehents und der 7. Teil aller Waldnutzung in diesem Dorf und noch sieben
Käse und eine Fastenhenne zu.
Ferner hatte Klopfer der Amberger Stadtkammer 400 fl auf
ewige Zeit geliehen, dafür musste die Stadt dem Messkaplan jährlich 20 fl
geben. Ein eigenes Haus wurde dem Priester zugesichert. Die Stadt befreite
dieses Gebäude, wie alle anderen Benefiziatenhäuser, von Steuern, Wachdienst
und anderen bürgerlichen Lasten.
Wahrscheinlich stammten die Ausstattungsgüter dieser
einträglichen Messstiftung aus dem Nachlass des Ulrich Markhart.
Wie die angesehenen Familien Kastner, Reich, Alhard, Gießer,
Baumgartner und Steinhauser hatte nunmehr auch das Ehepaar Klopfer in St.
Martin seinen eigenen Kaplan, seine Messstiftung, seine Kapelle, seinen
Begräbnisplatz und natürlich auch seine Wappen. Übrigens gibt es kein Wappen in
dieser Kirche, das sich stolzer und selbstbewusster gibt als jenes der
Klopferschen Eheleute.
Am 6. August 1457 bestätigte Kaspar Schenk, Domvikar in
Regensburg, diese Stiftung, die auch die Zustimmung des Amberger Pfarrherrn
Heinrich von Rabenstein fand.
Im öffentlichen Leben nahm der erfolgreiche Berggewerke
seine Pflichten gebührend wahr. Als er 1457 zu Unstimmigkeiten wegen der Löhne und
Arbeitszeiten der Taglöhner in Amberg kam, beauftragte man den „lieben Ratsfreund"
Klopfer, gemeinsam mit anderen Ratsherren eine gerechte und angemessene
Regelung zu erarbeiten.
Es gab auch Zwist mit den „Ratsfreunden". Als Klopfer
1459 seine Steuern zum Rathaus trug, eine wenig erfreuliche Bürgerpflicht,
entlud sich sein Groll in böser Kritik an den Rechenherrn. Als „Junker"
bezeichnete er sie, warf ihnen vor, ihn ungerecht zu behandeln und mehr Wert
auf sein Geld als auf sein Wort zu legen. Das war „Bürgermeister und Rat"
zu viel. Er wurde zu acht Tagen Haft auf dem Vilstorturm und zum Bau von sechs
Ruten Stadtmauer (das sind 21 m) verurteilt. Das fand wiederrum Klopfer als
unangemessen. Er beschwerte sich bei Kurfürst Friedrich, erreichte aber nur einen
Teilerfolg. Der Landesherr tadelte den erbosten Steuerzahler wegen der Beleidigung
des Stadtrats. Er mahnte ihn zu Bescheidenheit, da er ja „nicht zu den
Vornehmsten der Stadt zähle". - Das war ein peinlicher Hinweis auf
Klopfers Schulmeistervergangenheit. - Zusammenfassend fand Friedrich I. das
Urteil gerecht, hob aber, und das freute Klopfer, die Haftstrafe auf. Das Stadtmauerstück
dagegen musste er bauen lassen. Das dürfte ihn 15 bis 20 Gulden gekostet haben,
eine Kleinigkeit für Klopfer, für andere ein Betrag, von dem sie gut ein Jahr
leben konnten.
Als man ihm 1460 eine Strafe von zwei Gulden diktierte, weil
er nicht zur Teilhaberversammlung der Gemeinschaft des Eisenbergwerks
erschienen war, zahlte er ohne Widerrede.
Ansonst war Klopfer ein hochgeschätzter Mitbürger. Mehrmals
übernahm er Vormundschaften, stets hat er gewissenhaft das Vermögen seiner
Mündel verwaltet. 1464 lieh er der Stadt Amberg die stattliche Summe von 1000
fl gegen 50 Gulden Jahreszins. Wenn nötig, half er Mitbürgern durch Darlehen;
er lieh z. B. Michael Ortenburger 633 fl. Auch Bürgschaften übernahm er, und so
wurde er sogar Bürge seines Herrn, des Kurfürsten Friedrich, als dieser ein
Darlehen von 900 fl brauchte.
Ein erfolgreiches, erfülltes Wirken also! Dennoch liegt ein
Schatten über dem Leben der Klopferschen Eheleute. Kinder blieben ihnen
versagt. Kinderlosigkeit hat man damals als bitteres Los empfunden. Der Name
Klopfer, den beide zu hohem Ansehen gebracht hatten, sollte mit ihnen vergehen,
ihr großes Vermögen sollte in fremde Hände kommen. Sie konnten nur durch
letztwillige Bestimmungen über ihr Vermögen zukunftsweisend verfügen. Sie
taten's nach bestem Wissen, in bester Absicht.
Ihrer beider Geburtsstadt Weiden übereigneten sie 1470 die
Klopferkapelle „Zur heiligen Staude". Gerne übernahm die Stadt diese
Kapelle, die inzwischen zu einer beliebten Wallfahrtsstätte geworden war.
Wahrscheinlich hatte bereits Hans Klopfer einige Jahresmessen für dieses
Kirchlein gestiftet.
Eine sehr bemerkenswerte Stiftung ließen beide 1471
besiegeln. Sie übergaben der Stadtkammer 1200 fl, wogegen sich die Stadt
verpflichten musste, 52 fl als „Klopferstiftung" jährlich zu verteilen.
Da sollte, erstens, zwei Amberger Bürgersöhnen, deren Eltern
unter 1000 fl an Vermögen hatten, das Studium an einer Universität ermöglicht
werden. Für jeden waren jährlich 20 fl vorgesehen, genug, um Studiengelder und
Lebensunterhalt an einer Universität zu bestreiten. Bedingung war nur, dass das
Studium der sieben freien Künste nach vier Jahren, jenes der Medizin oder der
Dichtkunst nach fünf Jahren, das Jurastudium nach sechs Jahren und das Studium
der Philosophie und Theologie nach sieben Jahren als Licentiat oder Doktor
beendet wurde.
Zweitens, musste sich die Stadt verpflichten, jedes Jahr von
diesen Zinsen einer armen, ehrsamen Bürgerstochter, deren Eltern unvermögend
waren, zehn Gulden als Heiratsgut und Haussteuer zu geben.
Drittens musste jährlich mit einem Gulden ein Jahrtagsamt
mit sieben Beimessen, am Wolfgangsfest für die Vorfahren des Ehepaars Klopfer
finanziert werden. Der Stadtpfarrer, seine vier Kapläne, die Benefiziaten der
zwei Marienstiftungen in St. Martin und der Klopfersche Messkaplan sollten den
Jahrtag halten und dafür gebührend bezahlt werden.
Viertens hatte der Stadtrat gemeinsam mit der
Kirchenverwaltung am Nikolaustag eine Spende für die Schulkinder auszurichten.
Wenn diese nach alter Gewohnheit bei der Nikolausprozession
vom Pfarrhof bei St. Georg nach St. Martin am Rathaus vorbeikamen, mussten
unterm Rathaustor jedem Schüler eine Hallersemmel (1 Heller ist 1/2 Pfennig), jedem
Hilfslehrer vier, dem Herrn Schulmeister aber sechs solcher Brote gereicht
werden. Hilfslehrer und Magister aber sollten ja nicht den Schulbuben ihre
Nikolaussemmeln wegnehmen.- Eigens vermerkt hat's der einstige Schulmeister.
Es ist sicher kein Zufall, dass in dieser Stiftung so sehr
der Kinder und Heranwachsenden gedacht wurde. Da Klopfer selbst keine Kinder
hatten, sollten wenigstens Kinder anderer beschenkt und gefördert werden.
Knapp zwei Jahre später starb Hans Klopfer. Seine Witwe
scheint ihn fast um zehn Jahre überlebt zu haben. In St. Martin fanden beide
ihre letzte Ruhestätte. Ihr Nachlass dürfte trotz aller Stiftungen noch einige
reich gemacht haben. So lieferte z.B. ein Benefiziat dem Testamentsvollstrecker
über 800 fl ab, die ihm die Klopferin zur Verwahrung übergeben hatte.
Heute erinnern nur noch die Wappen in St. Martin und die
anfangs geschilderte Gedenkplatte, an das Ehepaar Klopfer, deren Stolz es war,
„Bürger zu Amberg" zu sein.
Von den Klopferschen Stiftungen fand das St.
Wolfgangsbenefizium schon um 1540, als Amberg sich allmählich der Lehre Martin
Luthers zuwandte, ein frühes Ende. Die Kapelle zur hl. Staude am Fischerberg
wurde unter den evangelisch / kalvinischen Kurfürsten ab 1553 immer mehr
vernachlässigt und ab 1588 demoliert. An ihrer Stelle steht seit 1952 wieder
eine kleine Kapelle. Am längsten erhielt sich die Spende der Niklaussemmeln.
Nach 1634 war die durch Krieg und Pest verarmte Stadt nicht mehr in der Lage,
ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Es muss nun festgehalten werden, dass weder der Reichtum des
Hans Klopfer noch seine verschiedenen Stiftungen im alten Amberg etwas
Einmaliges waren. 38 ähnliche Benefizien wurden von Eisenhändlern, Berggewerken,
Handwerkern und Priestern gestiftet.
Auch andere Bürger ließen Kirchen bauen. Wolfhard Reich
verdankt Amberg die Katharinenkirche, und Hans Bachmann hat aus eigenen Mitteln
ab 1452 das Franziskanerkloster samt Kirche errichten lassen.
Die vermögenden Amberger dachten aber nicht nur an die Ehre
Gottes und an ihr Seelenheil, sie vergaßen nie ihre ärmeren Mitbürger und die
Bedürfnisse der Allgemeinheit. Erst durch Zustiftungen der Bürger wurde das
Bürgerspital zur umfassenden Versorgungsanstalt für Alte und Hilfsbedürftige.
Häufig wird in Testamenten der Aussätzigen im Leprosenhaus und der Kranken im
Lazaretthaus gedacht, doch auch den Bau von Straßen und Brücken hat man durch
Vermächtnisse gefördert. Als Einzelstiftung sei „das reiche Almosen" des
Hans Kastner vom Jahre 1433 erwähnt. Der wohlhabende Berggewerke und
Eisenhändler gab so reichlich Zehent und Gilteinkünfte, dass man jede Woche 54
armen Leuten je einen achtpfündigen Laib Brot, ein Pfund Fleisch bzw. in der
Fastenzeit 1/2 Pfund Schmalz und alle Vierteljahr zehn Pfennige geben konnte.
Erst die Inflation von 1923 hat diese alten
Wohltätigkeitsstiftungen ihrer finanziellen Grundlagen beraubt und sie
ausgelöscht. Bis heute aber besitzt die Stadt Amberg noch viele um fangreiche
Waldungen, die einst zum Bürgerspital, zur Leprosenstiftung und zum Almosenamt
von Amberger Bürgern gegeben wurden.
„Jörgl“, hat der gestrenge Herr Hofkastner gesagt, „du musst
helfen, die Rinder nach Amberg zu treiben für die Festtage, wenn unser Herr
Pfalzgraf Philipp die Pfalzgräfin Margareth, die Tochter des reichen Landshuter
Herzogs heiratet. Vielleicht bleibst gleich die Hochzeitstage in der Stadt,
wenn der Vater erlaubt. Siehst was, was du dein Lebtag nimmer vergisst."
Jetzt treibt also der Spitalhofbauernjörgl von Hiltersdorf
seine zwanzig Ochsen, Kühe und Kälber nach Amberg hinein. "Arg viel für
eine Hochzeit", denkt sich der Jörgl.
In Paulsdorf sieht er eine noch größere Herde. Die kommt von
Nabburg her und will auch nach Amberg. Da muss sich der Jörgl schon sehr wundern.
Dann kommt er in Moos mit seinem Vieh zwischen ein paar Kaufmannswagen, beladen
mit Gewürz, Wein und Fisch. Hinterm Dorf überholt ihn ein Reiterzug. Die
Rüstungen der Ritter glänzen, die Pferde sind festlich geschmückt. Der Jörgl
muss nur grad schauen. Von seinem Vieh will er kein Stück verlieren, aber es
wird immer schwerer, aufzupassen.
Das letzte Stück der Reise ist eine Qual. Bauernkarren mit
Mehl, Jäger mit Wildbret, Wagen mit Weinfässern, dann wieder Bauernkarren mit
Kisten drauf, in denen Ferkel quietschen. Alles zwängt sich hinein zur Stadt,
zur Fürstenhochzeit.
Endlich ist der Jörgl im Schloss. Der Vorratsverwalter zählt
das Vieh und übernimmt es. Dem Jörgl drückt er 15 Pfennig in die Hand. Der
schaut. So viel Geld denkt er sich. Aber der Verwalter sagt: "Kommt nicht
drauf an heut, wo unser Fürst heiratet!"
Auf dem engen Hof des Schlosses sind die Küchen aufgebaut.
Vor jeder stehen ein paar Wagen mit Schweinespeck, mit Hasen und Rehen, mit
Heringsfässern und mit Sachen, die der Jörgl sein Lebtag noch nie gesehen hat.
Da muss er staunen, wie die Köche gerade einen ganzen geschlachteten Ochsen auf
den Spieß stecken.
"Haben die Heimburger immer noch nicht die fünfhundert
Hühner gebracht?" So schreit einer von den Köchen. "Und die Waldecker
müssten doch schon
lang da sein mit ihren zweihundert Spansäuen!" So hört der Jörgl aus der
anderen Ecke. „Donnerwetter“, denkt der Jörgl! „So also geht's zu, wenn
ein Fürst Hochzeit hat.“
Da drückt ihm einer eine Semmel in die Hand und zwei Würste.
"Kost nix heut! Bist auch zu Gast geladen zur Fürstenhochzeit wie wir
alle! Freu dich, Bruderherz!"
Dann geht der Bub zum Bäckergirgl. Der wohnt am Roßmarkt und
ist sein Taufpate. Die Begrüßung ist kurz, denn auch im Hause des Bäckergirgls
geht's zu vor lauter Hochzeit. In der unteren Kammer haben zwei kurpfälzische
Reitknechte aus Heidelberg ihr Quartier aufgeschlagen, oben im Dachkammerl
hausen drei sächsische Lakaien. Zwei Ratsherren stehen gerade bei seinem Paten.
Er soll jetzt noch zwei Landsknechte aus dem Gefolge der Braut, der
Herzogstochter Margarethe von Landshut aufnehmen. "In Gott's Namen! Ich
werd sie schon noch unterbringen", sagt der Bäckergirgl.
Und der Jörgl hat aber in selbiger Nacht im Hause seines
Paten auch noch ein Schlafplatzerl gefunden.
Am nächsten Tag, es ist ein Sonntag, erlebt der Jörgl den
Einzug der Fürsten. Über vierhundert adelige Herren und Damen, alle in rote
Gewänder gekleidet, kommen mit dem jungen Pfalzgrafen Philipp. Gut tausend
Pferde mag sein Gefolge zählen. Ganz wirr ist dem Jörgl schon im Kopf vor
lauter Schauen. Aber er treibt mit hin und her unter den Menschen, und isst und
trinkt mit ihnen, ein Stück vom gebratenen Ochsen, ein Glas Wein, eine Brezel.
Wie im Schlaraffenland! Aus allen Augen leuchtet die Freude: Unser Pfalzgraf hat
Hochzeit!
Am Abend donnern die Kanonen. Bum, bum, bum! „Jörgl,
brauchst nicht zu erschrecken. Jetzt gerade hat der Bischof das junge Paar
vermählt. Hörst du die Trompeten schmettern?“
Am Montag sieht der Jörgl das Brautpaar beim Kirchgang. Drei
golddurchwirkte Röcke und drei ebensolche Überwürfe trägt die Braut und das Krönlein
auf ihrem Haar blinkt und blitzt. Es gibt nichts Schöneres, denkt der Jörgl.

Am Nachmittag ist ein Turnier auf dem Amberger Marktplatz.
Der Jörgl hat nichts davon gesehen. Es war einfach nicht durchzukommen, so
viele Menschen wollten zuschauen.
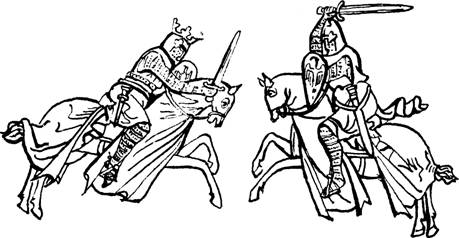
Am Abend geht der Jörgl mit seinem Paten ins Schloss, um die
Fürsten an der Tafel zu sehen. Welch ein Glanz! Tausend Kerzen brennen und ihr
Schein bricht sich in den silbernen und goldenen Geschenken, die auf dem Gabentisch
ausgebreitet sind. Der Pokal der Stadt Amberg ist gut zwei große Bauernhöfe
wert und ist noch nicht der größte.
Jetzt tragen die Diener eine große Burg herein. Ach, das ist
ja ein Kuchen! Da sieht der Jörgl, wie ein Diener mit einem langen Messer die
Burg entweischneidet. In jeder Hälfte der Kuchenburg sitzt ein Knäblein und
singt. Ein Häslein hüpft aus der einen Hälfte, aus der anderen schwirrt ein
buntes Vögelein heraus. Der Jörgl reißt Augen und Mund auf. Er sieht den
Küchenbuben nicht, der ihm einen Becher Wein hinreicht.
Am Mittwoch zieht der Jörgl wieder heim. Was er erlebt hat,
kann er immer noch nicht fassen.
Viele Jahre sind vergangen. Der Jörgl ist ein alter Mann mit
schlohweißem Haar geworden. Aber immer noch erzählt er davon, wie er dazumal
anno 1474 auf der Amberger Fürstenhochzeit dabei gewesen ist.
Vom Aufwand bei dieser Hochzeit können wir uns kaum eine
Vorstellung machen. 5 Zentner Mandeln, 15 Körbe Feigen und große Mengen
Pfirsiche, also Früchte, die damals bei uns keiner kannte, wurden verbraucht. 50
feiste Ochsen und 50 gute Kühe und Hunderte von Kälbern und Schweinen wurden
nach Amberg geschafft. 80 Zentner Butter und 24 große Fässer mit Heringen
wurden angeliefert. 20 Köche standen dem "Obristen Koch" zur Seite, 5
neue Küchen hatte man eigens im Schlosshof aufgebaut. 6 Bäcker mussten schon 10
Tage vorher mit dem Brotbacken für dieses Fest beginnen. Es war schwer, die 300
Fürsten, Grafen und Adeligen, die mit zahlreichem Gefolge kamen, in der Stadt
unterzubringen. Fast noch schwieriger war es, die Pferde zu versorgen. Der
Bräutigam zog mit 1000 Rossen gen Amberg und die Braut hatte keinen
bescheideneren Tross. An Pracht und Aufwand stand die Amberger Hochzeit der
heute weltberühmten Landshuter Hochzeit wenig nach. Ein Jahr nach dem Amberger
Fest vermählte sich nämlich Herzog Georg von Niederbayern, der Bruder der jungen
Frau Pfalzgräfin in Landshut mit der polnischen Königstochter Hedwig.
Im Sebastiansviertel erinnern Margaretenweg und
Philippstraße an das Brautpaar um 1474.
Schifffahrt auf der Vils! Viele Jahrhunderte zählte sie zu
den Besonderheiten Ambergs. Ließ es das Wetter zu, dann fuhr man von April bis
Oktober, Woche für Woche, am Sonntagmorgen mit vier bis sechs Schiffen, alle
beladen mit Erz und Eisen, nach Regensburg. Man belieferte unterwegs die Hämmer
und kam am Donnerstag oder auch erst am Freitag mit Salz zurück.
Erst 1826 hat man diesen Wassertransport eingestellt. Einige
Begebenheiten sollen an diese vergessene Verkehrseinrichtung erinnern.

Salztransport
Schiffbruch auf der Vils
1479 - Schwer mit Eisen und Blech beladen, näherte sich das
Schiff des Meisters Jakob dem Markt Kallmünz. Im Auftrag der Amberger
Eisenhändler Plech und Fraislich sollte er diese Ladung nach Regensburg zum
Weitertransport nach Ulm bringen. Bislang war die Fahrt ohne Zwischenfälle verlaufen,
die schlimmste Strecke hatte man hinter sich.
Die ersten Häuser von Kallmünz waren zu sehen, und schon
näherte man sich der Vilsbrücke. 0 je! Ein dumpfer Stoß, ächzendes Holz,
gurgelndes Wasser! Wie Frösche platschten die acht Schiffsleute in die Vils,
klammerten sich an die Brückenhölzer und zogen sich ans Land. Verletzt war keiner.
Das Schiff lag mit aufgerissener Seitenwand auf Grund.
Im Nu waren Neugierige zur Stelle. Bald kamen auch die
Amtsleute des bayerischen Herzogs Albrecht in München. Die Amberger begannen
die ersten Eisenschienen aus dem kaum brusttiefen Wasser zu bergen.
"Halt!", rief der gestrenge Kallmünzer Pfleger. "Nach dem
allgemeinen Recht der Grundruhr beanspruche ich dieses gestrandete Gut für
Herzog Albrecht." Erstaunt schauten die Schiffsleute, dann protestierten
sie, doch das war vergebens. Der Pfleger erklärte ihnen: „Alles Handelsgut das
mit einem zerbrochenen Wagen auf einer Straße liegt, ist dem zuständigen
Landesherrn verfallen, und wenn ein Schiff Schiffbruch erleidet und zu Grund
geht, gehört es ebenfalls dem Grundherrn.“ Als der Schiffsmeister behauptete,
die Vils sei Amberger Gewässer, lachten die Kallmünzer nur, und die Kallmünzer
gingen mit Feuereifer ans Werk, holten Eisen und Bleche aus dem Wasser und dem
Schiffsmeister blieb nichts, als sehr verärgert nach Amberg zurück zu kehren.
Die Kallmünzer werkelten weiter, bis das letzte Eisenstück geborgen war.
Zufrieden sah der Pfleger auf das wertvolle Strandgut. Der
Herzog würde sich freuen und ihn belobigen. Mancher Bürger aber hatte am Abend
sein heimlich weggeschafftes und verschachertes Eisenstück in einem Wirtshaus
vertrunken.
In Amberg war man empört. Kurfürst Philipp schickte sofort
Hans von Helmstett nach München, zwei Herren des Rates begleiteten ihn. Sie
erklärten dem Herzog Albrecht, dass die Wasserstraße zur Donau der Kurpfalz zugehöre
und bewiesen dies mit alten Urkunden. Der Herzog sah das ein, und die drei
reisten ab mit einer besonderen Anweisung für den Kallmünzer Pfleger. Der
schaute recht sauer drein. Alles Eisen, alles Blech musste er den Ambergern
zurückgeben.
„Da fehlt aber einiges", stellte Meister Jakob kritisch
fest. Das war nicht zu leugnen. Der Pfleger musste schließlich den Ambergern
den Wert des verschwundenen Eisens - wo mochte es bloß hingekommen sein - auf
Heller und Pfennig ersetzen. Jetzt waren es die Amberger, die lachen konnten.

Schiffe aus
Amberg in Regensburg an der Donau bei der „Eisengred“ (um 1630)
Auf Vils und Naab durften neben den Ambergern nur der Markt
Schmidmühlen Schifffahrt treiben, dieser jedoch nur mit einem Schiff. Salz,
Eisen und Erz war auf dieser Strecke für die Amberger zollfrei. Rechtsstreitigkeiten
auf dieser Wasserstraße wurden grundsätzlich in Amberg entschieden. Auf
gestrandetes oder gesunkenes Gut hatten keiner der verschiedenen Landesherren
an Vils und Naab Rechtsanspruch. Diese Flüsse waren kurpfälzisch-ambergisches
Gebiet oder Amberger Hohheitsgewässer.
Schiffsunfälle gab es auf dieser Strecke häufig. In manchem
Jahr verlor die Amberger Flotte drei bis vier Schiffe. Von einem Schiffmeister
wird erwähnt, dass er im Laufe der Jahre
zehn Schiffe „ertränkt“ habe.
Die Sonderrechte der Amberger auf Vils, Naab und Donau
bestimmen auch die gerichtliche Verhandlung wegen der beschädigten Brücke von
Etterzhausen.
1525 - Der Amberger Schiffsmeister Hans Krueg sollte für den
Augsburger Bürger Hans Pfefferlein 48 Ztr. Karpfen und Hechte nach Mariaort
bringen, eine bemerkenswerter Auftrag. Leider erfahren wir nicht, wie man die
Fische auf dem Schiff verfrachtet hat.
„Auf dem Weg hat Krueg 6 Knechte nahe Pielenhofen
weggeschickt und nur einen Knecht bei sich behalten. Er ist eine Stund in der
Nacht gefahren und hat am St. Mathiastag das Schiff an der Brücke zu
Etterzhausen erstossen weswegen die 48 Ztr. Fisch verloren gingen. Das es
Kruegs Schuld ist, der die Knecht weggeschickt und bei Nacht gefahren ist, …
was wider die Ordnung der Schiffsleut Teutscher Nation ist verlangt Pfefferlein
den Ersatz seines Schadens.“ Dieser Unfall wurde im kurpfälzischen Amberg und
nicht im Neuburger Amt Burglengenfeld behandelt und Pfefferlein kam sicher zu
seiner Entschädigung, denn bei Nacht zu fahren und ohne das nötige Schiffsvolk
ist mehr als fahrlässig. Es klagten aber auch die Gemeinde Etterzhausen, die
ihre stark beschädigte Brücke richten lassen musste. Davon wollten aber Krueg
und die Amberger Schiffsmeister nichts wissen: „Sollten wir allen Schaden, so
sich bei Fällen der Brücken ergibt … wieder gut machen müssen, so wüssten wir
die Schifffahrt nicht zu betreiben, da jeder Anlieger nur nach seinem Vorteil
und Nutzen ins Wasser baut und nicht Rücksicht auf die Schifffahrt nimmt. Daher
kommt es immer wieder zu Schädensfällen. Nämlich in Schmidmühlen, Emhof,
Dreidendorf, Kallmünz, wo Schiffe immer wieder Pflöcke an der Brücke ab-
hinwegstoßen, ja auch gar ein Joch abwerfen. Item mehr als einmal wurde die
Brücken zu Pettenhofen auf den Schiffen hinweggeführt. Bis zur Stunde hat man
niemals was bezahlt. … Item, so ist noch in der Menschengedenken, dass zu
Etterzhausen kein Brücken, sondern von alters eine Überfahrt (Fähre) gewesen.
Die Schifffahrt ist also älter als die Brücke, und man hätte so bauen müssen,
dass die Schiffe nicht Schaden erleiden können.“
Nun forderte Krueg Ersatz der Reparaturkosten am Schiff. Der
Ausgang des Rechtsfalls ist leider nicht bekannt. Man wird sich darauf geeinigt
haben, dass jeder seine Schäden selbst trägt.
Es ist vielfach belegt, dass Mühlen- und Hammerwerksbesitzer
vor 1640 alle Schäden an den Fällen, an Uferbauten und an ihren Brücken selbst
behoben ließen. Schließlich waren die Fälle ja auch die Stauanlagen für den
Mühlen- oder Hammerwerksbetrieb. Die Müller- und Hammerherrn mussten auch bei
der Wasserhaltung Rücksicht auf die Schifffahrt nehmen. So mussten sie den Fall
bei der Talfahrt offen lassen, also das Wasser fließen lassen, bis die Schiffe
den nächsten Fall erreicht hatten. Bei der Bergfahrt aber war der Fall zu
schließen, sobald das letzte Schiff durchgezogen war. Damit die Schiffe am
Sonntag genug Wasser hatten, mussten am Samstag gen Abend die Mühlen und
Hammerwerke oberhalb der Stadt ihre Stauanlagen öffnen.
Diese Vorschriften zeigen, welche Bedeutung die
Vilsschifffahrt für die Allgemeinheit hatte. Bemerkenswert ist, dass die
Schiffsleute und die Stadt 1501 eine Genehmigung für die Sonntagsfahrt von
Papst Alexander VI. erwirkten, da nur an diesem Tag die Werksanlagen an Vils
und Naab nicht arbeiteten. Schiffsleute waren nunmehr vom Besuch der Sonntagsmesse
befreit.
Selbstbedienung eines Hammerherrn
1550 - Der Hammermeister Wolf Schweiger von Dietldorf war
verärgert. Wieder waren die Schiffe durch Dietldorf gefahren und kein Erz
hatten sie ihm abgeladen, obwohl er die Fracht schon lange bezahlt hatte. Er beschloss,
sich selbst zu helfen.
Am nächsten Sonntag wartete er in Schmidmühlen auf die
Schiffe. Kaum hatte er sie erspäht, ritt er eilends zu seinem Hammer, öffnete
den Fall und ließ das aufgestaute Wasser ablaufen. Dann rief er seine Knechte,
hieß sie Schaufeln mitnehmen und zog den Schiffen entgegen. Inzwischen hatten
die Amberger den Fall von Pettendorf ohne Schwierigkeiten durchfahren. Doch was
war nur mit der Vils los? Immer mussten sie zu den Stangen greifen, um die
Schiffe von einer Sandbank zu drücken und in tiefes Wasser zu schieben. Das hat
es doch sonst nicht gegeben. Und dann saßen sie knapp vor Dietldorf endgültig
fest.
Sollte man's glauben? Gerade zur rechten Zeit kam Herr
Schweiger mit einer Schar Knechte und bot ihnen seine Hilfe an. Wie in alter
Zeit die Schiffszieher, so schleppten nun die Dietldorfer das erste Schiff ab.
Doch was sollte das? Bei der Erzschütt des Hammers hielten sie an und banden
das Schiff fest. Gar höflich bat der Hammerherr, das Schiff zu entladen. Mit
den 450 Zentnern Erz wollte er vorerst zufrieden sein.
Was blieb den Ambergern übrig? Sie machten gute Miene zum
bösen Spiel. Während sich das Erz am Ufer häufte, schwoll auch das Wasser
wieder an. Als das Schiff entladen war, schaukelte die Amberger Flotte wieder
munter in der aufgestauten Vils. Die Fahrt konnte weitergehen.
Der Rat der Stadt Amberg hat sich später mit dieser
Eigenmächtigkeit des Herrn Schweiger befasst und ihm einen scharfen Tadel
verpasst. Das hat den wenig gestört. Künftig hat er nie mehr über nachlässige
Erzzufuhr klagen brauchen.

Die Amberger Schiffe belieferten nicht nur ab Vilshofen die
Hämmer an Vils und Naab mit Erz, sie brachten dieses für die Werke an Laber und
Altmühl auch zur Erzschütt nach Mariaort. Ansonsten transportierten sie auch
Wein, Getreide, Fische und Stoffe nach Regensburg. Nach Amberg brachten sie
südliche Weine, Möbel, Obst und Kirchenpflastersteine.

60 Ztr. zusätzliche Fracht bedeutet. 400 bis 450 Ztr.
dürften die höchste Belastbarkeit dargestellt haben.
Bei 575 Ztr. Erz, wie Reß auf S. 98 im V 0 Band 91 angibt,
hätte ein Schiff 70 cm einsinken müssen. Eine solche Belastung ist theoretisch
möglich. Es gibt Berichte, die dartun, dass Donauschiffe einst so belastet wurden,
dass sie mittschiffs nur 20 cm über die Wasseroberfläche ragten.
Auf der Vils hat man aber auf Untiefen und Furten Rücksicht
nehmen müssen. Auch die Fahrt durch die engen Fälle wurde bei größer werdender
Lademenge immer gefährlicher.
Nun liegen Angaben vor, dass ein Schiff bis zu 50 Bergfuder
Erz laden konnte. Nachdem Reß ein Fudergewicht von 11,2 Ztr. annimmt, kommt er
tatsächlich auf 575 Ztr. es gibt aber Hinweise, dass damals ein Fuder nur rund
8 Ztr. wog. 50 Fuder entsprachen dann rund 400 Ztr. und das liegt im realen
Bereich der Belastbarkeit eines Vilsschiffes.
Sechs Schiffsleute reichten aus, um eine Fracht von bis 500 Ztr. nach Regensburg zu bringen
und das innerhalb von 12 Stunden. Bei der Talfahrt bewegten sich die Schiffe
schneller als die normale Strömung, denn bei jeder Fallöffnung wurde die
Geschwindigkeit beschleunigt. Am Sonntag arbeiteten weder Hammerwerke noch
Mühlen, und man konnte die Fälle jederzeit öffnen. Für 50 Fuder (Fuhren) zu je
8 Ztr. waren dagegen beim Transport auf der Straße 50 Wagen, dann 100 Pferde
und mindestens 50 Fuhrleute nötig. In 12 Stunden aber schafften sie die
Strecke. Amberg — Regensburg nie. Man war dann auf den miserablen Straßen
mindestens 2 Tage unterwegs, es war also eine Übernachtung, dann Futter für die
Pferde und entsprechende Verpflegung für 50 Knechte nötig. Die große
Rentabilität der Vilsschifffahrt ist aus diesen Angaben zu ersehen.
Weniger günstig war die Bergfahrt. Man fuhr nämlich ständig
gegen die Strömung und nach jedem Fall in immer seichteres Wasser. Am Montag
mussten die zwei Reitknechte mit vier Pferden je Schiff in Regensburg sein. Bis
weit ins 15. Jahrhundert jedoch mussten „Schiffszieher“ die Schiffe schleppen.
Nicht nur die Fälle, auch die Furten bereiteten mehr
Schwierigkeiten. Daher waren die Schiffe bei der Fahrt nach Amberg höchstens
mit 240 Ztr. Salz, also 160 Salzscheiben beladen. Vier Pferde zogen an einem
Schiff, 2 Reitknechte hatten sie zu leiten. Für die Salzladung aber wären auf
dem Landweg immerhin 30 Wagen, 60 Pferde und 30 Fuhrknechte nötig gewesen. Auch
für die Fahrt Regensburg - Amberg hat sich demnach der Schiffsverkehr noch gut
rentiert. Allerdings dauerte die „Afferfahrt" 4 Tage, während die
Fuhrwerke die Rückfahrt in 2 Tagen schafften.
Wahrscheinlich wäre auch die Bergfahrt rascher möglich
gewesen. Man nahm aber freiwillig Rücksicht auf die Arbeit der Hammerwerke,
obwohl keine Verpflichtung dazu bestand. Ein willkürliches Öffnen der Fälle
hätte jedoch häufig den Betrieb der Hochöfen unterbrochen, die Schiffsleute
warteten deshalb. In der Regel übernachteten sie bei der Rückkehr am Montag in
Etterzhausen, am Dienstag in Kallmünz und am Mittwoch in Ensdorf.
Dann versorgten sie ferner durch Sonderfahrten die Hämmer im
Passauer Bistum. Bei dem großen Erzbedarf konnten die Amberger Schiffe selbst
bei besten Willen nicht allen Wünschen rechtzeitig nachkommen. Nicht nur Herr
Schweiger aus Dietldorf hat auf sein Erz warten müssen. Eisen aber schafften Eisenschiffe
bis nach Ulm. Von dort aus fand das bayerische Eisen Verbreitung bis in die
Schweiz und nach Oberitalien. Sogar nach Ungarn fuhren lange Zeit Amberger
Schiffe.

Ehemaliger „Fall“ bei Ensdorf.
1557 – Eine Schifffahrt kann recht lustig sein, besonders wenn’s
talwärts geht. Nach jedem Fall, durch den man pfeilgeschwind gerissen wurde,
glitt man rascher dahin. Zu tun gab’s ja nicht viel. Man musste nur das Schiff
im rechten Fahrwasser halten.
Die sechs Mann des letzten Schiffes im Amberger Schiffszug
genossen dieses geruhsame Dahingleiten. Außerdem genossen sie auch das
mitgenommene Bier. In der Glut der Schiffsfeuerstelle brutzelten einige Fische,
die man nicht gekauft hatte. Nicht gekauft waren übrigens auch das Holz und die
Rüben neben dem Herd.
Mit Gejohle und Geschrei steuerten sie den Fall der
Ensdorfer Mühle an. Durch Stangenstöße beschleunigten sie die Fahrt. Der Müller
am Fallbaum hob beschwörend und warnend die Hände. "Hejo, stoßt den
Fettwanst ins Wasser!", rief einer und schon richteten sich drohend einige
Stangen gegen den Müller. Das Schiff wurde von der Strömung in den Fall
gerissen, prallte gegen die Fallwand, dass die Bohlen krachten und die
übermütigen Burschen durcheinander purzelten. Noch ein Aufprallen an der
Gegenwand, lautes Gejohle und dann schwamm das Schiff frei im Fluss.
Kopfschüttelnd und erbost schaute ihnen der Müller nach.
Ausgerissene Rüben, mitgenommenes Brennholz und gestohlene Fische, das hätte er
ihnen verziehen. Aber ihn zu beschimpfen und zu bedrohen und so verrückt in den
Fall zu fahren, dass man nicht wusste, war nun das Schiff oder der Fall zerschlagen,
das ging zu weit.
Die munteren Burschen bekamen es zu spüren. Schon am Tag
nach der Rückkehr ließ sie der strenge Rat vorführen. Zu beschönigen gab's
nichts. Ihre ganze Freizeit bis zur nächsten Fahrt mussten die zwei
Hauptschreier im Gewölbe des Nabburger Tores verbringen. Die anderen sechs
saßen bei Wasser und Brot im Dockenhansl.
Die
Schiffsknechte stammten meist aus den Dörfern rings um Amberg, während die Gespanne
von Amberger Fuhrleuten gestellt wurden. Die Amberger Schifffahrt beschäftigte
rund 45 bis 65 Leute, und war damit eines der größten Unternehmen in Amberg.
Die Knechte, die keinerlei Berufsausbildung brauchten, hatten einen Verdienst,
der dem der Handwerksgesellen entsprach. Der Salzhandel der Amberger versorgte
nicht nur die mittlere und nördliche Oberpfalz, sondern auch mittel- und
oberfränkische Gebiete mit dem lebensnotwendigen Salz.
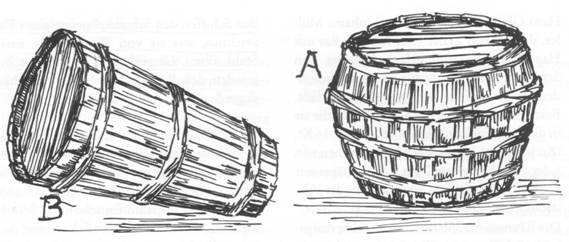 So
wurde einst Salz befördert. Das Salzfass
(A), auch Scheibe genannt, wog rund 1 1/2 Ztr., die Kufe (B) nur 80 Pfund.
So
wurde einst Salz befördert. Das Salzfass
(A), auch Scheibe genannt, wog rund 1 1/2 Ztr., die Kufe (B) nur 80 Pfund.
Schifffahrt im Krieg
Juni 1632 - Vier Amberger Schiffe, beladen mit 720 Ztr.
Salz, waren auf der Rückreise. Bislang hatten sie eine gute Fahrt gehabt,
obwohl das Wasser gering war. Bei der langen Furt, nahe Treidendorf, hatten sie
jeweils 8 Pferde vor ein Schiff spannen müssen, um diese Untiefe überwinden zu
können.
Der Wasserstand machte den Schiffern jedoch in diesen heißen
Tagen die geringste Sorge. Nicht umsonst begleiteten 27 bayerische Soldaten mit
ihrem Korporal die Zillen. Der Schwedenkönig stand bei Nürnberg, ja, wenn manche
Berichte stimmten, rückte er bereits gegen Sulzbach vor. Der Landesherr,
Kurfürst Maximilian, lagerte bei Schwandorf. In die nördliche Oberpfalz waren
Einheiten Wallensteins eingedrungen. Wirre Berichte von Kämpfen, Plünderungen
und Brandschatzungen hatten sie vernommen. Die Gerüchte wucherten üppiger als
die Schlingpflanzen in der Vils.
Nun näherten sich die vier Schiffe dem Markt Schmidmühlen.
Die Soldaten marschierten in Gruppen zwischen den Gespannen und genossen den
geruhsamen Dienst. – Halt! Was wollte der erste Schiffsreiter? Warum fuchtelte
er so aufgeregt gegen Norden? Rasch bemerkten es die Soldaten und Schiffsleute.
Ein Soldatenhaufen zog ihnen entgegen. „Die Schweden! Hilfe! Feindio!", so
scholl es durcheinander. Die Schiffe rückten zusammen, die Soldaten liefen vor
zum ersten Schiff und bildeten eine schwache Linie. Die Musketiere zündeten
ihre Lunten an, die Pikeniere senkten die Spieße. Doch dann lachten die
Soldaten lauthals:
„0, diese Amberger! Schweden sollen das sein! Kennen die
Dummköpfe keine bayerischen Soldaten?“ „Vivat Maximilian!“, schrie der
heranrückende Haufen, und „Vivat Maximilian!“, scholl's zurück. Dann begrüßten
sich die Soldaten und jetzt lachten auch die Schiffsleute, sie lachten leider
zu früh.
Es waren freilich bayerische Soldaten und gleich so viele,
dass die 28 Mann des Geleits in dieser Menge untergingen. Es währte nur wenige
Augenblicke, dann waren die Schiffsreiter aus den Sätteln gezerrt und die
Zugstränge durchschnitten. Mit 17 erbeuteten Pferden zogen die Soldaten ab. „Vivat
Maximilian!“, hörte man sie noch lange schreien. Verblüfft und verlegen schauten
ihnen die Geleitsoldaten nach. Nur allmählich begriffen die Schiffer das
Geschehen.
Bayerische Soldaten hatten bayerischen Schiffsleuten, die im
Schutz eines bayerischen Geleits fuhren, sämtliche Pferde geraubt. Ein Bote
eilte mit dieser Nachricht gen Amberg.
Neue Gespanne und eine sehr starke Wachmannschaft brachten
am nächsten Tag die wertvolle Salzladung nach Amberg. Dann bemühten sich die
Schiffsmeister um ihre Pferde. Bei Obristen und Generalen sprachen sie vergebens
vor. Erst als sie stattliche Trinkgelder hingelegt hatten, konnten sie einige
Erfolge buchen. Acht Pferde fanden sich. Die anderen neun blieben bayerische
Armeegäule.
Doch schon am nächsten Sonntag fuhr man trotz aller Gefahren
wieder nach Regensburg. Zu notwendig war das Salz und zu gewinnbringend der Salzhandel.
Wegen der Kriegsunruhen war bereits 1621 der Amberger
Erzbergbau eingestellt worden. Von den Vorräten der Amberger Erzschütt konnte
man noch lange die Hämmer beliefern. Die Salzversorgung wurde zum Hauptanliegen
der Schifffahrt. Salz war und ist lebensnotwendig. Trotz Gefährdung durch
eigene und feindliche Truppen wurde die Salzschifffahrt aufrecht erhalten und
brachte der Stadt große Gewinne. Sogar in der Pestzeit 1633/34 fuhren die
Schiffe. - An die einstige Schifffahrt erinnern Schiffbrücke, Schiffbrückgasse,
Schiffgasse, Salzstadelplatz und Salzstadelgasse.

Der Amberger Salzstadl in
Regensburg bei der steinernen Brücke um 1784

Nachgebautes Vilsschiff, allerdings
verkürzt.
Vor 500 Jahren! Die Martinskirche wurde gebaut. Baumeister
Zunter errichtete aus mächtigen Quadersteinen die neuen Mauern. Schon ragten
die gotischen Spitzfenster über die Bürgerhäuser hinaus. Je höher die Mauern
wuchsen, desto schwieriger wurde die Arbeit.
Der Bäckermeister beim Salzstadel hatte weniger Sorgen, Die
Maurer verdienten gut, und das Arbeiten machte hungrig. Da waren die Semmeln
schon weg, ehe sie kalt wurden, Oft schaute der Bäcker zu den fleißigen Maurern
hinauf. Er sah auch jeden Tag den Lehrbuben zu, welche die schweren Steine auf
einer Holztrage über die schwankenden Bretter hinauftrugen.
Wie die Burschen wieder einmal langsam und gebückt unter der
Steinlast hinaufstiegen, hielten sie auf halber Höhe inne und schauten hinunter
auf die Gassen. Das hätten sie nicht tun sollen. Schon rutschten die Steine von
der Trage ab und hinunter in die Tiefe. „Ihr Esel!" schreit der
Steinmetzmeister hinauf.
„Jawohl, noch dümmer als ein Esel, wenigstens dümmer als
meine zwei Esel, die hinten in meinem Stall stehen", sagte der
Bäckermeister. Er wollte auch gleich beweisen, dass seine Esel gescheiter waren
als die Lehrbuben und holte sie aus dem Stall. Der Bäckermeister ging zum Gerüst,
die Esel hinterdrein. Er stieg über die Stufen hinauf, seine guten Esel schön
langsam ihm nach. „Jawohl, das sind die rechten Steinträger", sagte der
Steinmetzmeister, „die sind nicht neugierig, sie schauen nicht übers Geländer
hinunter, die sollen fortan die Steine hochtragen!“ Und so geschah es auch. Unverdrossen
trugen nun Esel die Steine und jeden Tag um ein Stück höher, so wie die Mauern
wuchsen. Meister Zunter wurde alt, Meister Flurschütz nahm seine Stelle ein. Es
wurde weiter gemauert, weiterhin schleppten die Esel die Lasten. Endlich stand
Sankt Martin fertig da. Die Kirche wurde geweiht. Das war ein Fest. Der
Bürgermeister dankte allen, die mitgeholfen hatten am Bau, dem Baumeister, den
Steinmetzmeistern, den Maurern und den Zimmerleuten, auch dem Pfarrer und den
Ratsherren, die mitgesorgt hatten. Keinen hatte er beim Dank vergessen. „Nein,
Herr Bürgermeister, einige hast du doch vergessen!“ Am nächsten Tag ging
Meister Flurschütz über den Salzstadelplatz hinüber zum Bäckermeister. Der
stand gerade vor der Ladentüre Als ihm der Steinmetzmeister etwas ins Ohr
flüsterte, musste der Bäckermeister herzlich lachen.
Bald sahen die Amberger, wie der Steinmetzmeister an der
Ecke des Bäckerhauses saß und an einem Stein hämmerte und meißelte.
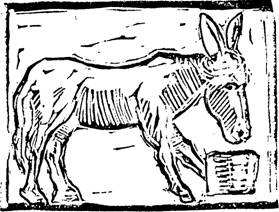 Was
soll da für ein Kunstwerk entstehen? Die Leute blieben stehen und rätselten
herum und fragten. Der Steinmetzmeister blieb stumm. Er verriet nichts. Aber
dann sahen sie doch, was da allmählich aus dem Stein herauskam: Ein Esel.
Was
soll da für ein Kunstwerk entstehen? Die Leute blieben stehen und rätselten
herum und fragten. Der Steinmetzmeister blieb stumm. Er verriet nichts. Aber
dann sahen sie doch, was da allmählich aus dem Stein herauskam: Ein Esel.
„Allen hat unser Bürgermeister gedankt, unsere Steinträger
hat er vergessen“, so sagte der Steinmetzmeister. Die Amberger freuten sich,
dass nun auch die braven Esel ein Denkmal bekommen hatten, und sie kauften noch
lieber als vorher ihre Semmeln beim Eselsbeck.
Dies ist natürlich nur eine
fantasievolle Sage. Kein Esel kann zentnerschwere Blöcke auf ein schwankendes
Baugerüst tragen. Die Quader der Martinskirche zeigen noch die Zangenlöcher, in
welche die Steinzange griff und die Steine festhielt beim Aufziehen mit dem
Kran. - Das Eselsbild aber ist das Hauszeichen der Glaserfamilie
"Esenböck", und zeigt einen „Eselsbock“, einen männlichen Esel.
Tatsächlich besaß die Glaserfamilie „Essenbeck“ bis 1570 das Anwesen, in
welchem dann über 400 Jahre verschiedene Bäckermeister ihr Brot gebacken haben.
– Kein Wunder, dass man „Essenbeck“ zu „Eselsbeck“ und Eselsbäcker machte.
„Das soll er mir büßen! Vertraut hab ich ihm wie meinem
besten Freund. Ich saß ruhig und ohne Sorgen hier in meinem Heidelberger
Schloss und wusste nicht, wie mich dieser Fuchssteiner betrügt. Einsperren
lasse ich ihn! Einen größeren Lumpen hat mein Amberger Gefängnis solange es
besteht, noch nicht gesehen!“
So schimpfte und tobte der Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz.
Er hatte auch allen Grund dazu, zornig zu sein. Für sein Amberger Land hatte er
den Dr. Johann von Fuchsstein als Kanzler bestellt. Und wie oft hatte er
gesagt:
„Auf den ist Verlass. Er macht alles recht“.
Was aber tat der Fuchssteiner? Er setzte sich mit Vertretern
der Reichsstadt Nürnberg an einen Tisch, zusammen und verschacherte die beiden
Ämter Lauf und Hersbruck mit den Dörfern und mit Wiesen, Feldern und Wäldern.
Ein Säckchen voller Goldstücke war der Verräterlohn für den ungetreuen Kanzler.
 Nun saß er im Schlossturm zu Amberg. Er
schaute durchs Gitter hinaus und sah die Wolken ziehen. Am Faschingsdienstag
1523 hatten sie den Fuchssteiner ins Gefängnis für Adelige im Schloss gesteckt,
und jetzt war schon Sommer geworden.
Nun saß er im Schlossturm zu Amberg. Er
schaute durchs Gitter hinaus und sah die Wolken ziehen. Am Faschingsdienstag
1523 hatten sie den Fuchssteiner ins Gefängnis für Adelige im Schloss gesteckt,
und jetzt war schon Sommer geworden.
Unter den Adeligen, die jeden Tag beim Kurfürsten waren,
hatte er aber immer noch Freunde. Die baten so lange für ihn, bis der Kurfürst
endlich sagte:
„Meinetwegen, lasst ihn heraus! Aber sehen will ich ihn
nicht mehr in meinem Land.“
Als man den Fuchssteiner aus dem Gefängnis holte, verließ
er, so schnell er konnte, die kurpfälzischen Lande. Er wusste genau warum.
4 Tage später sprengte ein Reiter von Heidelberg ins Schloss
und brachte einen Brief des Kurfürsten. Was stand darin? Die kurpfälzischen
Truppen hatten endlich die Burg Landstuhl des berüchtigten Franz von Sickingen
erobert. Der streitsüchtige Ritter war dabei ums Leben gekommen.
 Viel Schaden hatte Sickingen der Kurpfalz zugefügt.
Unter seinen Papieren aber fand man Briefe des Fuchssteiners. Dieser hatte insgeheim
den Friedbrecher beraten und unterstützt. Jetzt wollte der Kurfürst seinen
geldgierigen und verräterischen Kanzler streng nach dem Gesetz zur Rechenschaft
ziehen.
Viel Schaden hatte Sickingen der Kurpfalz zugefügt.
Unter seinen Papieren aber fand man Briefe des Fuchssteiners. Dieser hatte insgeheim
den Friedbrecher beraten und unterstützt. Jetzt wollte der Kurfürst seinen
geldgierigen und verräterischen Kanzler streng nach dem Gesetz zur Rechenschaft
ziehen.
Zu spät! Der Fuchssteiner war über alle Berge. Nur seinen
Namen hat er in Amberg gelassen, bis auf den heutigen Tag. „Fuchssteiner“
heißen die Amberger den Turm, in dem der Verräter längere Zeit eingesperrt war.
Nach seiner Flucht aus der Kurpfalz hat der Fuchssteiner ein
recht bewegtes Leben geführt. Im Bauernkrieg hat der beiden Seiten gedient und
beide Seiten verraten. Später stand er im Dienst des gewalttätigen Herzogs
Ulrich von Württemberg. Das Geschlecht der Fuchssteiner stammt aus dem
gleichnamigen Dörflein westlich von Amberg. Der ungetreue Kanzler war übrigens
kein armer Mann, er besaß nämlich die große Hofmark Ebermannsdorf. Der Fuchssteiner-Turm
hat auch später noch als Gefängnisturm gedient. Der vornehmste von allen
Gefangenen jedoch blieb der Fuchssteiner.
München die schönst’, Leipzig die reichst’, Amberg die festest’
Fürstenstadt
So hat man vor vielen Jahrhunderten in Deutschland gesagt.
Und der Bürgermeister Schwaiger hat's stolz um 1560 in seiner Chronik
aufgeschrieben. Wie kam Amberg zu diesem bemerkenswerten Ehrentitel?
Bei der Anlage der ältesten Stadtbefestigung waren die
Pfarrkirche St. Georg und der Bereich des späteren Bürgerspitals außerhalb der
Stadtmauer geblieben. Die älteste Stadt reichte nur vom Rossmarkt bis zum
Spitalgraben und von der Schiffbrücke bis zum Lederersteg. Dann wuchs Amberg,
denn Salzhandel, Erzbergbau und Eisenhandel gaben vielen Arbeit und Verdienst.
Auch außerhalb des ältesten Mauerrings baute man Häuser.
Ab 1300 musste man an die Vergrößerung der Stadt und an den
Bau einer neuen Befestigungsmauer denken. Wie König Ludwig seinen Ambergern bei
diesem Vorhaben geholfen hat, wissen wir schon. Unbekannt ist uns, wann die
Arbeiten begannen. Sicher jedoch ist, der Stadtgraben wurde zuerst angelegt.
Jahrelang mussten viele Tagwerker mit Hacken, Schaufeln und Schubkarren sich
plagen, ehe der breite und gut 2500 m lange Graben fertig war. Sehr tief
mussten sie ihn im Osten und Westen ausheben, denn man wollte ja das Wasser der
Vils um die Stadt leiten. Amberg sollte eine große Wasserburg werden und für
die Osthälfte schaffte man es auch. Das ausgehobene Erdreich warf man zur Stadt
hin auf, und so entstand hinter dem Graben ein Wall als weiterer, behelfsmäßiger
Schutz. 1326 arbeitete man bereits am ersten neuen Stadttor bei der
Georgskirche. Doch das Graben und Aufschütten, das Steineanfahren und Mauern
ging noch viele Jahrzehnte weiter.
Die Nachfolger Ludwigs des Bayern unterstützten ebenfalls
den "Stadtbau", und 1363 verzichtete Pfalzgraf Rupprecht für immer
auf die Zolleinnahmen vom Erzberg und in der Stadt zugunsten der
Stadterweiterung. 1404 übertrug König Rupprecht seinen Ambergern "die
Stadtgräben" zum ständigen Unterhalt, denn nach jedem Hochwasser mussten
diese geräumt werden. Dagegen gestattete er seinen Bürgern das Einsetzen von
Fischen. Die 5 Bürgermeister durften diese Wasserflächen, als einzige Vergütung
übrigens, für ihre Mühen im Dienst der Gemeinschaft abfischen.
Die Amberger mussten trotz aller Hilfe tief in ihr Säckel
greifen für die "neue Stadt". Die Steuereinnahmen des Stadtkämmerers
waren gottlob hoch. Es gab genug reiche Bergwerksbesitzer und Händler, und
selbst die Handwerker waren meist wohlhabend. Zugleich halfen Strafgelder beim
Mauerbau. Da hatte z. B. der Hans Klopfer 1455 den Stadtrat beleidigt. Zur
Strafe musste er einige Meter Stadtmauer bezahlen. Mehrere Bürger waren
nächtlicherweile lärmend durch die Stadt gezogen. Sie mussten Steine anfahren
lassen zum „Stadtbau“. Ähnliche Vergehen waren nicht selten und freuten den
Stadtkämmerer.
Die Türme der Befestigung dienten damals auch als Gefängnisse.
Den Dockenhansel sperrte man in so einen Turm. Was er angestellt hatte, weiß
kein Mensch mehr. Als er entlassen wurde, blieb sein Name dem Turm, und noch
heute heißt der massige Eckturm beim Nabburger Tor der
"Dockenhansel". Man sollte es nicht glauben, dieser Gauner ist uns
noch namentlich bekannt, während seine hochweisen Richter schon längst
vergessen sind.
Um 1500 waren die Befestigungsarbeiten weitgehend
abgeschlossen, aber jedes Jahr musste etwas getan werden, um größere Schäden
gar nicht aufkommen zu lassen.
Nun lag die Stadt sicher hinter einem breiten Wassergraben,
den man beim Zeughaus aufstauen und ablassen konnte. Die Wasserfläche begrenzte
die Zwingmauer, die in Amberg schon so hoch war wie anderorts die Hauptmauer.
Hoch ragte darüber die Stadtmauer mit dem überdachten Wehrgang und den vielen
Zinnen und Auslugscharten. 97 Türme verstärkten die Anlage. Den Zugang zur
Stadt bewachten besonders mächtige Tore. Dort, wo die Vils den Befestigungsring
unterbrach, hat man auf mächtigen Bögen den Wehrgang über den Fluss geführt.
Wie bei den Toren Zugbrücken im Notfall den Eingang sperrten, so konnten bei
der Stadtbrille und beim Vilstor schwere Fallgitter das Eindringen auf dem
Wasserweg verwehren. Man hatte wirklich an alles gedacht. Selbstverständlich
war die Stadt gut mit Waffen versehen.

Stadtbrille mit Fallgitter Schloss mit Tor und
Zugbrücke (um 1606 nach Schweigers Relief)
Fast alle Bürger besaßen Harnisch und Helm, Schwert und
Spieß. Manche konnten sich Rüstungen leisten, wie sie besser kein Adeliger
besaß. Die meisten verstanden mit Pfeil und Bogen und mit der Armbrust
umzugehen. Kaum waren die Feuerwaffen aufgekommen, hatten die Amberger einen
Büchsenmeister, und im späten 16. Jahrhundert übte jeder zweite Bürger mit
seinem eigenen Gewehr.
Drohte der Stadt Gefahr, flatterte vom Martinsturm die weiße
Kriegsfahne, dann eilten die Bürger auf die Wehrgänge und besetzten die Türme.
Die Zugbrücken schwangen hoch, und das Wasser im Stadtgraben schwoll an. Aus
der betriebsamen Stadt fleißiger Handwerker und wagemutiger Kaufleute war eine
waffenstarrende Festung geworden. Wer konnte da noch Angriffsabsichten haben?
Zu eindringlich sah jeder, dass jene Recht hatten, die Amberg als „die festeste
Fürstenstadt“ rühmten.
Aus dieser Geschichte ist zu sehen, dass eigentlich die
Wehrmauer die Stadt ausmachte. Hahnbach und Rieden sind Märkte, sie waren nie
von einer Mauer umgeben. Vilseck und Hirschau sind Städte, sie waren einst mit
Mauern und Türmen befestigt. Ambergs Befestigung hat sich in vielen Jahrhunderten
bewährt. In keinem der vielen Kriege vor 1700 hat man die Stadt auch nur
ernsthaft belagert. Amberg zählt zu den ganz wenigen Städten Deutschlands, die
während des 30-jährigen Krieges von Belagerung, Eroberung, Plünderung und Brand
verschont blieben. Erst 1703, als die Artillerie wirkungsvoller eingesetzt
werden konnte, musste sich die Hauptstadt der Oberpfalz das erste Mal nach
mehrwöchiger Belagerung und Beschießung einem kaiserlichen Heer ergeben.
Wer um die „Allee“ geht, entdeckt noch viel von der alten
Stadtbefestigung. Oft sieht man an den unverputzten Stellen der Mauer die
alten, später vermauerten Öffnungen zwischen den Zinnen. Als die Feuerwaffen
Bogen und Armbrust verdrängt hatten, wurden sie durch Rechteckscharten ersetzt.
An die 50 Türme und Turmreste sind noch vorhanden und „Hinter der Mauer“,
zwischen Nabburger Tor und Bahnhof blieb sogar der Wehrgang erhalten.
 Der alte Stadtgraben führt nun kein Wasser
mehr, dafür hat man schöne Spazierwege angelegt, die an den alten Mauern und Türmen,
aber auch an hübschen Baum- und Buschgruppen vorbeiführen. Aus den Befestigungsanlagen
der „festesten Fürstenstadt“ sind Stätten der Erholung geworden.
Der alte Stadtgraben führt nun kein Wasser
mehr, dafür hat man schöne Spazierwege angelegt, die an den alten Mauern und Türmen,
aber auch an hübschen Baum- und Buschgruppen vorbeiführen. Aus den Befestigungsanlagen
der „festesten Fürstenstadt“ sind Stätten der Erholung geworden.
Neutor – 1870 abgebrochen
Pfalzgraf Johann Kasimir, der als Vormund des Kurprinzen
Friedrichs IV. ab 1583 die Kurpfalz regiert hatte, war im Januar 1592 gestorben
und mit großem Prunk in Heidelberg beigesetzt worden. Am 26. Januar 1592 hatte
man in der Amberger Martinskirche dem Verstorbenen ebenfalls letzte, fürstliche
Ehren erwiesen. Dreimal waren alle Glocken geläutet worden. In großer Prozession
waren Schüler, Magister und Geistliche mit den Herren der kurpfälzischen
Regierung zur Trauerfeier geschritten, mit ernsten Mienen hatte man die
Trauerpredigt und die feierlichen Chorgesänge angehört.
Nun erfüllte Unruhe die Hauptstadt der Oberpfalz. Die
evangelischen Amberger und Oberpfälzer hatten sich seit gut 25 Jahren gegen die
religiöse Unduldsamkeit der kalvinischen Regierung wehren müssen. Bei jeder
Gelegenheit war versucht worden, den Kalvinismus in der Oberpfalz einzuführen
und zugleich die Rechte und Freiheiten des Landes zu schmälern. Dem Vormund
gegenüber konnten die Oberpfälzer ihr evangelisches Bekenntnis verteidigen. Wie
sollte es nun werden?
Der neue Herr galt als fanatischer Kalvinist. Zudem waren ihm
auch die Rechte und Freiheiten der Städte ein Dorn im Auge.
Die Amberger dachten an Neumarkt. Mit List und Gewalt hatten
sich kurpfälzische Truppen der Stadt bemächtigt. Ihre alten Rechte wurden
geschmälert und den Bürgern hat man kalvinische Prediger aufgezwungen.
Verärgert erinnerten sich die Amberger an das Wüten der Bilderstürmer in ihren
Kirchen. Altäre, Bilder und Figuren, die frühere Geschlechter geschaffen
hatten, waren zerstört worden.
Immer lauter wurden Befürchtungen geäußert. Sorge und Angst
wuchsen. Die Entrüstung stieg. Es erwachte schließlich der Wille zum Widerstand
und immer eindringlicher vernahm man: „Wir müssen unsere alten Freiheiten
verteidigen! Wir lassen uns den evangelischen Glauben nicht nehmen! Die
Jahrhunderte alten Rechte der Stadt dürfen nicht aufgehoben werden.“
Die Herren der Regierung dagegen waren sich ihrer Sache
sicher. Hinter den Forderungen des Landesherrn standen ja die Soldaten in
Neumarkt. Die Unruhe der Bürgerschaft schätzten sie gering ein. Erstaunt war
man im Schloss, als am 10. Februar die Herren des Rates bis Mitternacht im
Rathaus beisammen saßen. Was ging hier vor?
Am nächsten Tag wurde alles noch rätselhafter. Die Stadttore
blieben geschlossen. Alle Bürger eilten aufs Rathaus.
Dort ging es erregt zu. Man beschloss, der Kurfürst muss
alle Rechte und Freiheiten Ambergs bestätigen. Der Kurfürst muss versichern,
das evangelische Bekenntnis in Amberg nie zu unterdrücken. Erst nach diesen
Zusicherungen wird die Stadt ihn als Herren anerkennen. Da man einen Überfall
der kurpfälzischen Soldaten fürchten musste, wurde ausgemacht, die Schlossbrücke
über den äußeren Schlossgraben abzubrechen, damit nicht durchs Südtor
kurpfälzische Soldaten ins Schloss und von dort aus in die Stadt kommen konnten.
All dies teilte man dem Statthalter mit. Das gab eine Aufregung!
Dreimal lief der Kanzler ins Rathaus und protestierte und begehrte fast bittend
einen Aufschub des Brückenabbruchs. Doch gerade während dieser Verhandlungen
waren zwei mit Fässern beladene Fuhrwerke am Vilstor angelangt, die der
Michelfelder Richter nach Neumarkt beordert hatte. In den Fässern waren
Harnische und Waffen für die kurpfälzischen Soldaten. Die Ladung wurde sichergestellt,
die Verhandlungen des Kanzlers blieben erfolglos.

|
Leonhard Müntzer Stadtkämmerer
|
Ludwig Steinhauser
Innerer Rat
|
Dr. Paul Dienstbeck Stadtsyndikus
|
Am Nachmittag erschien alles, was in Amberg Waffen tragen
konnte, in bester Ausrüstung auf dem Marktplatz. 400 Schützen, dann Handwerker
mit ihrer Wehr, und zahlreiche Bürger in Harnisch zogen in Fünferreihen und in
bester Ordnung um das Rathaus. Ein stolzes Schauspiel bürgerlicher Wehrhaftigkeit.
Dann wurden die Tore neuerdings geschlossen und bewacht.
Kleinere Abteilungen umstellten das Schloss. Begleitet von einer starken
Schützenabteilung zogen Schmiede, Mauerer, Zimmerleute und Steinmetze aus dem
Wingershofer Tor. In kürzester Zeit war die Schlossbrücke abgebrochen. Niemand,
auch kein Soldat, konnte nunmehr ohne Willen und Genehmigung der Amberger ins
kurfürstliche Schloss oder aus der Stadt. Die Regierung war in einer bösen
Lage. Bei der allgemeinen Erregung war ein Sturm der Bürger aufs Schloss nicht
ausgeschlossen. Die hochmütige Drohung einiger der Herren, man werde mit den
Ambergern wie mit den Neumarktern verfahren und zudem einige Köpfe rollen
lassen, hatte die Bürgerschaft stark aufgebracht.
Nach acht Tagen fanden die Herren ihre Lage unhaltbar. Es
kam sie hart an, den Rat um die Erlaubnis zum Verlassen der Stadt zu bitten.
Die Bürgermeister versicherten zwar, die Herren hätten nichts zu befürchten,
man werde sie sogar gegen die Bürger schützen. Dennoch wollten die Herren Räte
weg. Bei schlechtestem Winterwetter verließen sie samt ihren Familien Amberg
und zogen nach Neumarkt.
|

|
|
Gabriel Plech
Innerer Rat
|
Bernhard
Büchelmeyer
Stadtschreiber
|
Hiob Schwaiger
Bürgermeister
|
|
|
|
|
|
|
Die Bürger setzten nunmehr ihre Stadt in Verteidigungszustand.
Das grobe Geschütz wurde aufgefahren, die Zugbrücken und Fallgitter überprüft,
die Wachen neu eingeteilt und die Wehrmauern des Schlosses besetzt. Vorsichtshalber
vermauerte man die Zugänge vom Schloss in die Stadt. Die Bürgerschaft war einig
wie nie zuvor. Die wenigen Kalvinisten hielten sich zurück und blieben unbelästigt.
Nur einmal musste die Stadtwache eingreifen, als ein Bürger seine Wut über die
Machenschaften der Regierung an einem jungen Kalviner auslassen wollte.
Ambergs Haltung stärkte den Widerstand der Oberpfälzer gegen
die beabsichtigten Neuerungen. Leider fand das geordnete Vorgehen der Amberger
nicht überall Nachahmung. In Nabburg erschlugen die Bürger ihren hochmütigen
herrischen Pfleger, und in Tirschenreuth ging es dem streitsüchtigen Oberhauptmann
ebenso. In Hahnbach verweigerten 1600 Bauern die Huldigung und gingen
schließlich mit Prügeln auf die Abgesandten des Kurfürsten los. Ähnliches
geschah in Hirschau.
In Heidelberg war man entsetzt. Friedrich IV. fürchtete, die
Amberger würden die kurpfälzische Herrschaft für immer abwerfen. Eindringlich
mahnte er jetzt seine Räte in Neumarkt zu Güte und Entgegenkommen. Man verhandelte,
doch die Amberger wichen nicht von ihren Forderungen. Im Juni 1593 einigte man
sich. Der Kurfürst bestätigte die Rechte und Freiheiten der Stadt und
versprach, niemand in Glaubenssachen zu bedrängen. Damit waren die Amberger
zufrieden und huldigten ihm.
Das mutige und kluge Vorgehen der Amberger hat damals
allüberall in Deutschland Aufsehen erregt. Als „Amberger Lärmen“ gingen die
Ereignisse von 1592/93 in die Geschichte ein.

Wappen Friedrich IV. und seiner Gemahlin Juliane von
Oranien am Landgerichtsgebäude
Amberg wurde ab 1521 allmählich eine evangelische Stadt. 1538
bekannte sich der Stadtrat zur Lehrmeinung Luthers, mit dem man mehrfach Briefe
wechselte. 15 Jahre bestanden beide Konfessionen nebeneinander. 1553 verbot das
evangelische Stadtregiment das katholische Bekenntnis.
In der Folgezeit hatte die Oberpfalz schwer unter der
religiösen Unduldsamkeit ihrer Herrscher zu leiden. Schon Ott-Heinrich (1556 - 59)
ordnete die Zerstörung von Altären und Bildwerken an und erregte damit den
Unwillen der Amberger. Friedrich III. (1559 - 76) war Kalvinist, er verwies die
evangelischen Geistlichen des Landes. Schon damals kam es zu Unruhen in Amberg.
Ludwig VI. (1576 - 83) war evangelisch und ging seinerseits streng gegen alle
Kalviner vor.
Das „Amberger Lärmen“ brachte keinen Dauererfolg. Kaum hatte
Friedrich IV. seine Macht gesichert, brach er alle seine Zusicherungen. 1597
entzog er der Stadt viele Rechte und Freiheiten. Wieder kam es zu Bilderstürmen.
Evangelische Geistliche mussten auswandern. An diese Zeit religiöser
Auseinandersetzungen erinnern leere Figurennischen an verschiedenen Kirchen und
der abgeschlagene Ölberg bei St. Georg.
Die Amberger Künstler von der Sitt und Deinfelder verehrten
1591 ihrer Vaterstadt den berühmten Amberger Liedertisch, das wertvollste Stück
unseres Heimatmuseums. Die Wappen der führenden Persönlichkeiten Ambergs im
Jahr 1592, die wir vorne sehen, schmücken dieses Kunstwerk. Der sechsstimmige
Liedsatz dürfte vom Amberger Komponisten Raselius stammen. Der Text weist auf
die damalige Notzeit hin.

Abgeschlagener Ölberg bei St. Georg (jetzt nicht mehr sichtbar).
|
„Weil Du Herr Christ an diesem Ort
Versammelt hast durch dein Göttlich wort
Ein Christlich kirch und Regiment
welch dich ehrt, lobt und fest bekennt,
So bitten wir durch die gnade dein
Wöllst bleiben bei diesem Häufleih klein.“
|
Am 12. Oktober 1619 ritt Kurfürst Friedrich von der Pfalz
durch die herbstbunten fränkischen Lande. 2 Läufer begleiteten ihn wie es
damals bei hohen Herren üblich war. Nach feierlichem Gottesdienst war er in
Heidelberg aufgebrochen, um nach Amberg zu reiten. Nun saß er schon Stunden im
Sattel, noch fühlte er keine Müdigkeit. Auch seine zwei Trabanten hielten sich
noch gut. Also weiter, denn es ging um sehr viel.
Die evangelischen Herren Böhmens, hatten ihn zum König
gewählt. Jetzt ritt er gen Amberg, um dort die Reise nach Prag vorzubereiten.
Angesichts der friedlichen Dörfer und der lachenden Fluren kamen ihm seine
alten Bedenken: „Muss ich wirklich die böhmische Krone haben? Kann ich nicht
mehr als zufrieden sein mit den gesegneten Landen an Neckar und Rhein und der
Oberen Pfalz mit ihren Bergwerken und Eisenhämmern? Wie schön ist Heidelberg!
Und die Residenz in Amberg kann sich auch sehen lassen. Ob es zum Kampf mit dem
habsburgischen Kaiser um Böhmen kommt?“
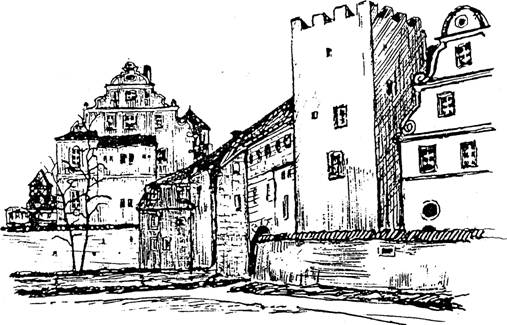 Südflügel
des Schlosses (umgebaut 1602) und Zeughaus (errichtet 1604) Bauten Christian
von Anhalts)
Südflügel
des Schlosses (umgebaut 1602) und Zeughaus (errichtet 1604) Bauten Christian
von Anhalts)
Doch was hatte ihm sein Statthalter in Amberg, Fürst
Christian von Anhalt, sein klügster Kopf in der Amberger Regierung immer wieder
beschwörend gesagt? „Kurfürstliche Gnaden, ihr seid nicht nur Herr der
Kurpfalz. Euch haben die evangelischen und reformierten Reichsstände zum
Anführer der Union gewählt. Dieser Bund steht hinter Euch. Wir haben Holland.
England, Savojen, Frankreich, Ungarn und vielleicht sogar die Türken zu Verbündeten.
Niemand kann uns etwas anhaben."
Bei so überzeugenden und erfreulichen Argumenten konnten die
Ablehnung seiner Bemühungen durch die Mehrzahl seiner Räte und die sorgenvollen
Warnungen seiner Mutter (eine Oranierin) kein Gewicht haben. Mehr Bedeutung
hatten für Friedrich schon ungewöhnliche Zeichen. So geschah es, dass Sekretär
Mauritius das Glückwunschschreiben des Führers der oberösterreichischen Stände
Baron von Tschernembl anlässlich der Wahl Friedrichs zum König von Böhmens,
unversehens mit dem Tintenglas statt der Streusandbüchse behandelte. Entsetzt
war Friedrich V., als er das ver- und abgewaschene Schriftstück sah. Und der
Anhalter nickte nur verständnisvoll und erklärte: „Euer Liebenden, dies
bedeutet, dass dies Werk ohne Trübsal nicht kann abgehen, doch kann man die
Schrift wohl lesen.“ – Also werden die guten Wünsche gelten und in Erfüllung
gehen. Überzeugender und klarer als sein Statthalter konnte keiner reden.
"Bedenkt, seid ihr König von
Böhmen, dann ist's mit der Macht des Kaisers und der Habsburger vorbei. Dann
hat aber auch die Reformation Luthers und Kalvins gesiegt, und die Macht des
Papstes ist endgültig gebrochen. Ihr wisst, wer König von Böhmen ist, wird
meist der nächste Kaiser. Greift, zu! Gott will es so!"
Der einsame Reiter dachte auch an
seine lebensfrohe, junge Gemahlin, die schöne Tochter König Jakobs von England.
„Du hast eine Königstochter geheiratet, nun mach sie zur Königin!", so
hatte sie ihn oft bedrängt und an die glanzvolle Hochzeit 1615 in London
erinnert. So sei es denn! Prag, die Goldene Stadt, soll die glanzvolle Residenz
seiner geliebten und verwöhnten Königin werden.
Unwillkürlich ließ er sein Bräunl mehr ausgreifen. Er fühlte
sich stark. So wie er jetzt bis Amberg durchhalten würde, so gewiss würde ihm
auch die böhmische Krone zufallen. Beides war zu schaffen. Die Läufer neben ihm
dachten schon lange nicht mehr. Gleich Maschinen bewegten sie sich. Die Sonne
versank hinter Friedrich, blutrot färbte sich der Himmel. Dann verblasste das
Rot allmählich, und der Horizont im Osten wurde dunkel. Die Dörfer am Weg
versanken in der Dämmerung, das Land wurde grau. Ein Hochgericht stand am Weg.
Krächzend flatterten die Raben vom Galgen hoch, aufgeschreckt vom Hufschlag des
Pferdes. Nachdem die Dämmerung die ferne Landschaft einhüllte, bemerkte
Friedrich beklommen, wie viele Kreuze, Galgen und Friedhöfe seinen Weg
begleiteten. Ein unheimlicher Ritt in eine ungewisse Zukunft!
Doch dann wurde es im Osten hell.
Der Mond steigt empor. Sein Silberlicht zeigte dem Kurfürsten ein verzaubertes
Land. Burgen glänzten auf steilen Höhen. Flussläufe blitzten, und leichte Nebel
schwebten über blinkenden Weihern. Wie hübsch sind die stillen Städtchen und
Dörfer. Im Osten, wo Amberg und das Goldene Prag liegen muss, segeln lichte
Wolken im kristallklaren, dunklen Nachthimmel. Mit neuer Zuversicht reitet der
Kurfürst durch seine oberpfälzischen Lande. - Die Läufer neben ihm nehmen von
dieser Pracht nichts wahr.
Der Mond sank bereits nieder, als
Friedrich die Türme von St. Georg und St. Martin erblickte. 250 km waren in 18
Stunden bezwungen. Vom Pferd und von den Läufern hatte der Fürst eine
unglaubliche Leistung gefordert. Das Georgentor wurde eben geöffnet, da
taumelte einer der Trabanten, schlug der Länge nach hin und tat seinen letzten
Atemzug. Vor dem Schlosstor brach der zweite Läufer röchelnd zusammen und
starb. Nachdem Diener den Kurfürsten beim Fuchssteiner aus dem Sattel geholfen
hatten, sank sein Pferd in sich zusammen und verendete.
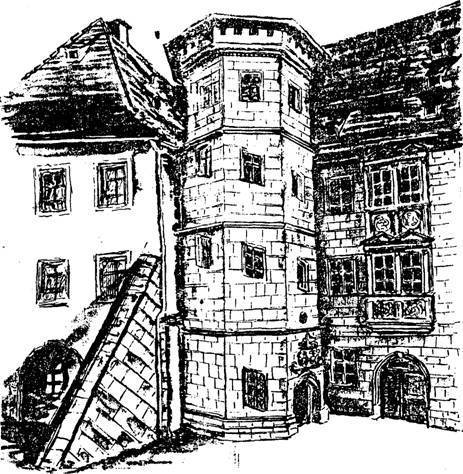
Erweiterungsbau der kurfürstlichen Kanzlei, errichtet
l601 und l610 unter Christian von Anhalt
Das bedeutet „nichts Gutes“, raunte man allgemein. Dem
Kurfürsten kamen bange Ahnungen. Fürst von Anhalt freilich sah es anders: „Herr,
dies zeiget, dass eine so wichtige Sache nicht ohne Ungelegenheiten abgehen
wird. Doch habet guten Mut!“
Und Friedrich ritt weiter nach Prag. Am 4. November 1619
wurde er mit größter Prachtentfaltung zum König gekrönt. Dann wurde regiert.
Aus dem Veitsdom und anderen Kirchen wurden Altäre, Bilder und Figuren entfernt
und zerstört, was den Prager Bürgern sehr missfiel. Die
kurpfälzisch-kalvinischen Kirchenräte besetzten Pfarrstellen mit Kirchendienern
ihrer Konfession, wodurch sie sich bei der mehrheitlich evangelischen
Bevölkerung verhasst machten. Ansonsten jagten sich den Winter über die
Festlichkeiten, und Elisabeth war überglücklich.
1620 aber lösten Landsknechtstrommeln und Kriegstrompeten
die Tanzmusik ab. Herzog Max von Bayern zog als Verbündeter des Kaisers gen
Prag. Am Weißen Berg stellte sich Christian von Anhalt zur Schlacht und wurde
vernichtend geschlagen. Rund ein Jahr nach der Krönung ritt Friedrich als
Flüchtling über die Grenze Böhmens. „Winterkönig!“ höhnten ihn seine Gegner.
1621 besetzten diese die Oberpfalz, 1622 die Rheinpfalz. Erst in Holland fand
Friedrich für seine Familie eine sichere Zuflucht. Prag und Amberg hat er nie
mehr betreten. 1632 starb er als Flüchtling, sein Grab ist unbekannt.
Der Gewaltritt Friedrichs ist
nicht nur sagenhafte Überlieferung. Das ausgestopfte "Bräunl" stand
z. B. noch vor 150 Jahren im Zeughaus. Eine Tafel am Fuchssteiner erinnert an
diesen Gewaltritt.
Fürst Christian von Anhalt war von 1595 bis l620 Statthalter
der Oberpfalz. Von Amberg aus leitete er die kurpfälzische Politik Er hielt
hier prächtig Hof. Das Schloss (Landratsamt) wurde vergrößert und bekam bis
1606 seine jetzige Gestalt. Das Zeughaus und die Regierungskanzlei mussten
erweitert werden, das Wagenhaus am Paulanerplatz und ein großes Ballhaus im
Zwinger beim Wingershofertor wurden neu errichtet. Nach dem Zusammenbruch
seiner Politik trennte sich der Anhalter von Friedrich V. und versöhnte sich
mit dem Kaiser.
Kurfürst Friedrich, geboren 1596 in Amberg, wurde in St.
Martin getauft. Oft und gern hielt er sich in Amberg auf. Der junge,
unerfahrene Herrscher überließ die Staatsgeschäfte zumeist seinen Räten. Er selbst
war ein leidenschaftlicher Jäger und ein ausgezeichneter Reiter.
Die Politik des Anhalters brachten nicht nur der Kurpfalz
Leid und Unglück. Aus dem böhmischen Krieg wurde der 30-jährige Krieg (1618 -
1648), eine verheerende Zeit für das deutsche Reich.
„Vor Krieg, Hunger und Pest verschone uns o Herr!“
Vieltausendfach wird im Dezember 1633 dieser Gebetsruf in der Oberpfalz
wiederholt. Den Krieg hat man kennen gelernt. Das gesamte Land bis zur Donau
und sogar die feste Reichsstadt Regensburg sind von den Schweden erobert
worden. Was hat dieses böse Jahr an Ruinen hinterlassen! Stillstehende
Hammerwerke, ausgebrannte Bauernhöfe und Hausruinen allüberall zwischen
Waldsassen und Neumarkt. - Unberührt vom Krieg liegt dagegen als bayerische
Insel im schwedischen Machtbereich die feste Stadt Amberg.
Der Hunger ist den Oberpfälzern nicht mehr unbekannt.
Bayerische, kaiserliche und schwedische Truppen haben plündernd das Land
durchzogen. Unzählige hat dieses schlimme Jahr zu Bettlern gemacht. Ausgeraubte
Ställe und Scheunen, mutwillig verdorbene Fluren und geplünderte Bürgerhäuser
allüberall zwischen Waldeck und Waldmünchen. Auf den Schüttböden der oberpfälzischen
Hauptstadt Amberg aber lagern noch stattliche Getreidevorräte. - Glückliches
Amberg!
Die Pest freilich, die im Gefolge von Krieg und Hunger ins
Land gezogen kam, ist nicht vor den Toren und Mauern Ambergs geblieben. Jetzt,
so scheint es, ist man mit ihr fertig geworden. Die Torwächter haben jedem den
Zutritt verwehrt, der nicht nachweisen konnte, dass er aus einem "Ort mit
gesunder Luft" kommt. Die Absonderung der Kranken ist auch gelungen. Entweder
hat man sie im Haus bei St. Katharina untergebracht, oder man hat sie in ihren
Häusern eingeschlossen und von den Zuträgern versorgen lassen. Die Totenträger
haben seit einigen Wochen nicht mehr viel zu tun. Auch naht der Winter,
erfahrungsgemäß wird die Pest bald erlöschen. Gott sei Dank!
Im Februar 1634 werden die Badstuben wieder geöffnet. Die
Stadt gilt als pestfrei. Nur für ein Haus ist die Sperrfrist von sechs Wochen
noch nicht abgelaufen. Das Leben könnte seinen gewohnten Lauf nehmen, doch die
Angst geht um und lässt die Bürger schlimme Dinge wahrnehmen. „Hört nur! Blaue
Lichter hab ich gesehen, viele, viele. Von der Stadt sind sie zum Katharinenfriedhof
gezogen. Am Martinsfriedhof sind gräusliche, schwarze Würmer herumgekrochen,
das bedeutet Unheil." Einer hat sogar den Pestvogel schreien hören: „Hui,
hui, ei, ei von hundert nur drei!“
Die Stadtverwaltung will der Gefahr vorbeugen! Die
Pestmandate werden verlesen. Alle Miststätten müssen bei Androhung schwerer
Strafe geräumt werden. Noch schärfer als sonst passt man auf, dass Urin und
stinkender Unrat nicht auf die Straße geschüttet werden, da verderbte Luft der
Pestilenz gar förderlich. Es wird scharf gerügt, dass die Metzger die
Fleischbänke schlecht reinigen, und die Bäcker die Schweine verbotenerweise auf
der Straße „weiden“ lassen. Man lässt Häuser, die von der Pest infiziert waren,
mit Seifenlauge reinigen und ausräuchern. Die Apotheker müssen sich mit
Medikamenten versehen. Den Bürgern empfiehlt man den Kauf von Riechbüchslein,
da stechende Kampfer- und Essigdämpfe ungesunde Luft fernhalten. Zum Räuchern
bietet man Wacholder an. Was kann man mehr tun?
Im März / April mehren sich die Todesfälle. Ist's die Pest,
ist's ein anderes Übel? Da stirbt ohne langes Krankenbett ein vornehmer Herr.
In der Franziskanerkirche wird er beigesetzt. Kurz darauf sind auch seine zwei
Kinder und die Magd tot. An den Leichen sieht man deutlich die schrecklichen,
schwarzen Beulen. Die Stadt setzt eine Pestkommission ein.
Im Mai 1634 schreibt die Regierung beschwörend, es möge,
alles unternommen werden, dass „diese leidige Sucht nicht weiter um sich
greift, sondern alsbald gedämpfet und gefangen wird.“ Die Pestkommission tut,
was möglich ist. Das Schlosserhandwerk hat Schlösser und Ketten für die Sperrung
der infizierten Häuser zu fertigen. Zuträger werden eingestellt. Sie müssen die
Eingeschlossenen mit Lebensmitteln versorgen. Bader verpflichtet man als
Seuchenärzte. Sie haben die Kranken aufzusuchen und deren Zustand dem Herrn
Stadtmedikus, der nicht mehr aus der Apotheke geht, zu beschreiben. Der
gelehrte Herr verordnet dann die Arzneien, der Apotheker mischt sie, und der
Bader bringt sie den Kranken.
Nichts wird besser. Man benötigt bereits vier Leichenträger.
Die Stadtkammer muss für alle Geldausgaben der Seuchenkommission aufkommen.
Schlimm steht es anfangs um die Seelsorge. Stadtdekan
Hantsch und Spitalpfarrer Gastl streiten sich, wer für die Betreuung der
Kranken zuständig ist. Sie schieben sich diese Aufgabe gegenseitig zu und tun
nichts. So kommt es, dass einige Bürger ohne die Tröstungen der Religion
sterben. Der Jesuitenpater Mannsdorfer, er hat kaum von diesem Missstand
gehört, da übernimmt er „freiwillig und gern“ diesen Dienst. Seine Ordensbrüder
helfen ihm. Sie sammeln Geld und Lebensmittel bei den Wohlhabenden. Mannsdorfer
kann damit vielen Hungernden helfen. Unverdrossen eilt er zu Kranken und
Sterbenden, bis ihn selbst der Schwarze Tod ereilt.
Mit der steigenden Sommerhitze nimmt die Zahl der Toten ständig
zu. Am 28. Juli 1634 werden z. B. neun Häuser als neu angesteckt gemeldet. Die
Stadtkammer hat allmählich Mühe, die Seuchenbekämpfung zu finanzieren. Während
die Einnahmen der Stadt immer mehr zurückgehen, werden steigende Forderungen an
die Seuchenkommission gestellt: Dr. Golla will acht Gulden pro Woche. Der Bader
von Lintach will als Seuchenarzt nur dann arbeiten, wenn man ihm drei Gulden
wöchentlich gibt. Einen Gulden fordern Zuträger und Totenträger.
Inzwischen sind schon acht Männer nötig, um die Toten des
Tages in der Nacht hinaus nach St. Katharina zu tragen.
Im August schaffen es diese acht auch nicht mehr. Sie
bringen die Leichen zunächst nur vor das Georgentor, das man unbedenklich offen
lassen kann. Dann tragen sie den Leichenhügel ab, soweit die Nachtzeit
ausreicht. Sie reicht häufig nicht aus, und der Hügel wächst. So geschieht es,
dass ein Wachtmeister bei der Rückkehr von einem Erkundigungsritt über die
entseelten Körper stürzt und betäubt zwischen ihnen liegen bleibt.
Bald muss ein Bagagewagen zum Leichentransport verwendet
werden. Die Räder hat man dick mit Filz beschlagen, um die Nachtruhe der
geängstigten Einwohnerschaft nicht zu stören. Bis zu 40 Tote werden in mancher
Nacht aus der Stadt gefahren.

Doch das Leben geht weiter. Salz hat gesundheitsfördernde,
heilende Kräfte. Die Salzschiffe holen deshalb die Gottesgabe bis von
Straubing, Händler kommen aus fernen Orten nach Amberg und zahlen dafür höchste
Preise. Auch Markttage finden statt. Aber Lebensmittel werden allmählich knapp,
und die Bauern der Nachbardörfer tragen hohe Gewinne heim. Mancher bringt so
die Pest mit in sein Heimatdorf.
Feierliche Beerdigungen gibt es dennoch. Was kam an Volk
zusammen beim Begräbnis des Herrn Kanzlers Baier! Doktor Spenholz hatte eine
unbedenkliche Todesursache bescheinigt, denn sonst hätte der hohe Herr ohne
Priester und Gesang und all die letzten irdischen Eitelkeiten unter die Erde
müssen. Gegen Geld leistet übrigens der Herr Doktor bereitwillig solche und
ähnliche Gefälligkeiten.
Die Isolierung der Kranken und der möglichen Krankheitsüberträger
gelingt nicht, denn Zuträger, Ärzte, Totenträger und ihre Angehörigen laufen zu
Händlern und Handwerkern. Noch immer sind Gaststätten offen, ja, Bierbrauer und
Weinhändler machen sogar gute Geschäfte. Bier und Wein schätzen viele als
Medizin. Auch die Soldaten des Herrn General Wahl halten sich nicht an die
städtischen Anweisungen. Willkürlich wechseln sie ihre Quartiere.
|

|
Bei der Katharinenkirche wurden die Opfer des
Pestjahres 1634 in Massengräbern verscharrt. Das Gebäude an der Kirche wurde
1588 als Krankenhaus errichtet und 1634 ebenfalls mit Pestkranken belegt.
|
In steigendem Maße befällt die Krankheit nun auch die
Amberger Garnison. General Wahl will den ihm anvertrauten letzten bayerischen
Waffenplatz in der Oberpfalz und die ihm unterstellten Truppen mit einem Schlag
von der Seuche befreien. Er befiehlt, dass alle Kranken und deren Angehörige Amberg
zu verlassen haben. Diese Anordnung wird mit brutaler Härte durchgesetzt. Rings
um die Stadt bauen sich die Vertriebenen Behelfshütten, Obst und Feldfrüchte
sind ihre einzige Nahrung.
Gleichzeitig entzieht General Wahl der Stadt die Leitung der
Seuchenkommission. Nur für die Kosten hat weiterhin die Bürgerschaft
aufzukommen. Doktor Spenholz und Rentmeister von Sickenhausen werden Direktoren
der Seuchenbekämpfung. Eine ihrer ersten Maßnahmen ist die Erhöhung des
Wochengeldes für Spenholz auf 18 Gulden. Doch auch Wahl denkt an sich. Trotz
aller Not erpresst er Tag für Tag ein Tafelgeld von rund 180 Gulden vom
Stadtkämmerer. Acht Ochsen entspricht dieser Betrag. Seine Offiziere bereichern
sich ihrem Rang entsprechend in ähnlicher Weise. Von allen Fuhrwerken, die Ambergs
Tore passieren, erheben sie Sondergebühren.
Ist's erstaunlich, dass bei solchen Vorbildern auch die
Soldaten zu etwas kommen wollen? Es vergeht keine Nacht, in der nicht leer stehenden Häuser erbrochen und
ausgeräumt wird. Tücher, Kleider, Betten und andere Habseligkeiten von
Verstorbenen und Ausgewiesenen werden zwischen den Kriegsknechten ausgetauscht,
werden in die Nachbarorte ver-
|
Das alte Leprosenhaus aus dem 14. Jahrhundert wurde
1522 Stadtkrankenhaus. In Seuchenzeiten - auch 1634 wurden hier bis zu 50 Infizierte
untergebracht. Heute ist dieses Gebäude Herberge für Obdachlose.
|

|
schachert und an Bauern, die trotz der Ansteckungsgefahr in
Amberg schanzen müssen, billig abgegeben.
Nun gestattet man den Ausgewiesenen wieder die Rückkehr. Allmählich
erlischt das letzte Vertrauen zur Obrigkeit. Sogar von den Medizinern erhofft
man nichts mehr. Die verordneten Arzneien stehen häufig unberührt neben den
Toten. Als die Lebensmittel knapp werden und man weder Zuträger noch Ärzte
finden kann, gibt man die Anweisung, dass jeder, der Geld hat, sich selbst mit
Nahrung, Pflegern und Arzneien versehen möge. Mancher, der die Pest hätte
überstehen können, muss an Entkräftung sterben. Schließlich fehlt es sogar an
Schlössern und Ketten, um verseuchte Häuser abzusperren. Doktor Spenholz
"bannisiert" daher die Kranken und deren Angehörige. Er zwingt sie
durch Androhung von Geld- und Gefängnisstrafen in den Häusern zu bleiben. Weil
die Versorgung der "Bannisierten" ganz ungenügend ist und niemand
verhungern will, hat dieser Bann wenig Wirkung. Trotz willkürlicher Geldstrafen
wird die Sperre kaum mehr beachtet.
Ein Schimmer von Zuversicht kommt auf, als Pater Hell, der
Rektor der Amberger Jesuiten, den Bau einer Marienkapelle auf dem Amberg
anregt, um so die Fürsprache der Gottesmutter für die bedrängte Stadt zu erlangen.
Er stiftet ein Marienbild und trägt es am 5. September auf den Berg. Nur einige
Offiziere und wenige Bürger begleiten Hell. Der alte Wachturm wird zur Marienkapelle.
Das erhoffte, befreiende Wunder aber bleibt vorerst aus. Das Sterben geht
weiter, und Anfang Oktober liegt auch Pater Hell tot in seiner Zelle.
Erst im November gehen Neuansteckungen und Todesfälle
merklich zurück. Endlich, im Dezember erlischt die Pest. Nur einige Häuser hat
sie verschont, aber viele Familien gänzlich ausgerottet. Viele Häuser, ja ganze
Straßen sind ausgestorben wie die Ziegelgasse und die Untere Nabburger Straße
Alle Bewohner des Franziskanerklosters, des Bürgerspitals und des Leprosenhauses
liegen nun draußen bei St. Katharina. Im Februar 1635 bedeckt man die Toten in
den Massengräbern mit einer Kalkschicht und füllt halbmannshoch Erde auf.
Die Überlebenden erfassen erst nach und nach, dass kein
Pestwagen mehr fährt und keine Pestfeuer mehr qualmen. Bürger, die von der
Seuche verschont blieben, noch mehr freilich jene, die durch Narben am Körper
an die schwarzen Beulen und die überstandene Seuche erinnert werden, erachten
das Leben als neu geschenkt. Für sie wird das Ende des großen Sterbens ein
Wunder, das sie, je mehr sie das Ausmaß des Verderbens überblicken können,
nicht zu fassen vermögen.
Von all den verheerenden Seuchen, die Amberg seit 1096
heimgesucht hatten, war keine so folgenschwer gewesen, wie jene des Jahres 1634.
1635 berichtet die Stadtverwaltung, dass weit über 1/3 der
Bevölkerung an der Pest starb. Noch im März 1635 waren 40 ausgestorbene Häuser
nicht gesäubert und ausgeräumt. Von den 20 Amberger Jesuiten erlagen 14 dem
Schwarzen Tod.
1634 wütete die Pestilenz übrigens nicht nur in Amberg und
der Oberpfalz, ganz Bayern war von ihr heimgesucht. Die Oberammergauer
Passionsspiele wurden damals gelobt.
Es dauerte viele Jahrzehnte bis Amberg sich von den
Verlusten des Jahres 1634 erholt hatte. Noch um 1700 standen Häuser leer,
andere waren Ruinen und manche waren sogar abgerissen worden. Gärten wurden auf
ehemaligen Hausgrundstücken angelegt. Der große Pfarrgarten von St. Martin
entstand so.
An General Wahl erinnert eine Straße bei der
Kaiser-Wilhelm-Kaserne (jetzt Fachhochschule). Gegen ihn, Dr. Spenholz und dem
Rentmeister Sickenhausen wurde übrigens 1635 ein Strafverfahren eingeleitet.
Wahl wurde strafversetzt. Dem Rentmeister wurde vorgeworfen, er habe „mehr auf
den privaten als den allgemeinen Nutzen gesehen … sich der Untertanen nicht
angenommen … es mit dem Kommandanten und den Offizieren gehalten … bei der
Pestdirektion ganz versagt, so dass in Amberg fast alle Häuser angesteckt
wurden.“
Eine Straße beim Krankenhaus ist dem Andenken Pater Hells
gewidmet. Der von ihm angeregte Neubau einer Kirche auf dem Berg wurde sofort
begonnen. Vorbild war das Pantheon in Rom. Der Krieg und die allgemeine Not
verzögerten die Vollendung der Rundkapelle. Als sie 1641 benutzt werden konnte,
war der „Amberg“ schon eine bekannte Wallfahrtsstätte geworden. Zwar brannte 1646
die Kapelle völlig aus, doch das tat der Wallfahrt keinen Abbruch und 1649
wurden die Brandschäden beseitigt. – Der Wachturm mit dem Gnadenbild war vom
Feuer ohnehin verschont geblieben.
Doch schon ab 1696 mussten Turmkapelle und Kirche, die zu
beliebten und bekannten Wallfahrtsstätten geworden waren, dem Bau unserer
jetzigen Bergkirche weichen. Zwei Deckengemälde von Asam erinnern an das große
Sterben 1634. Nicht nur das prachtvolle, barocke Gotteshaus, auch das schönste
unserer Heimatfeste, das Bergfest, geht auf das Pestjahr 1634 zurück.

So sah unsere Bergkirche 1725 aus. Hospiz und Mesnerhaus,
die hier mit abgebildet sind, wurden in der nachfolgenden Zeit beträchtlich
erweitert.
Sorgfältig prüft der Wächter am Nabburger Tor die Papiere
eines Mannes, dem man auf den ersten Blick den ehemaligen Soldaten ansieht. Da
ist die Bescheinigung, dass der Jörg Rauch Feldschmied im bayerischen Heer gewesen
und nunmehr ausgemustert ist. Hier ist die Anzeige, dass er aus einem Ort
kommt, wo - Gottlob - keine Pest herrschte. Man muss gut aufpassen, vorm Tor
treibt sich genug Gesindel im Land umher. Die entlassenen Landsknechte sind oft
schlimme Burschen.
Neugierig schaut der alte Soldat durch den Torbogen in die
Stadt. Vor gut 20 Jahren ist er mit den Pappenheimern in der oberpfälzischen
Hauptstadt gelegen, und die wohlhabende, schöne Stadt hat ihm, dem blutjungen
Schmiedegesellen, nicht schlecht gefallen. „Schaut etwas heruntergekommen aus,
dieses Amberg. Zerstört aber ist nichts, muss also den großen Krieg gut überstanden
haben“, sinniert der Jörg.
„Was habt ihr vor?“ Die mürrische Frage des Wächters reißt
ihn aus seinen Gedanken. Zögernd kommt seine Gegenfrage:
„Meint ihr, ich könnte für ein paar Tage hier Arbeit finden?“
Dazu weiß der Wächter keine rechte Antwort. In letzter Zeit sind Bürger sogar
aus der Stadt gezogen, um sich als Bauern auf dem Lande niederzulassen, weil
das Leben in der Stadt gar so schwer geworden ist. „Wer arbeiten will, kann ein
bescheidenes Auskommen finden“, meint der Wächter etwas barsch.
Jörg geht durchs Tor und weiter zur Goldenen Gans. Manch
fröhlichen Umtrunk hat er dort mit seinen Kameraden gehabt. Doch jetzt ist die
Wirtsstube leer, und der Hausherr ist wenig gesprächig. Das Bier jedoch mundet
dem Jörg. „Das Brauen haben sie an der Vils nicht verlernt“, denkt er.
Dann schaut sich Jörg in der Stadt um. 0 je, wie sehen die
Straßen aus! Häufig erblickt er leer stehende Häuser. Wie unordentlich sind die
Miststätten in Gassen und Straßen. Hühner und Schweine rennen überall herum wie
in einem Bauerndorf. Am Marktplatz ist's nicht besser. Sogar neben dem Rathaus
stehen Häuser mit vernagelten Türen und leeren Fensterhöhlen.
Nur vier Bauern sitzen am Markt. Kritisch prüfen einige
Hausfrauen Hühner und Eier. Was war da einst für ein Leben und Treiben! Ein
altes Weiblein reibt und bürstet vor der Ratstrinkstube armseliges Kleiderzeug
im Waschzuber. Ob die etwas weiß von früheren Bekannten?
Jörg nennt Namen und Berufe, die Frau jedoch erzählt immer
wieder von der schlimmen Seuche, die 1634, als der Schwed’ bei Nördlingen
geschlagen wurde, viele Bürger hingerafft hat. Sie erinnert sich auch an
verschiedene Familien, die 1629 die Stadt verlassen haben, weil sie nicht
katholisch werden wollten. Der Schiffmeister Puechner ist damals nach
Regensburg gezogen, die Familie Salmuth nach Ansbach und einer der Stiefsöhne
des Herrn Bader ist damals gar zu den Indianern über das große Meer.
Nachdenklich schlendert Jörg um die Martinskirche zum
Salzstadelplatz. Eines der vier Salzschiffe wird gerade entladen. Die Schröter
schleppen die schweren Salzscheiben in den Salzstadel, Fuhrwerke warten auf
ihre Ladung. Trotzdem, es ist nicht so wie damals. Ein Schiffsknecht erzählt
ihm, dass in Amberg schon lange kein Erz mehr gefördert wird und die meisten Hammerwerke
an Vils und Naab öd und verfallen sind.
Er geht zur Goldenen Krone. Mein Gott, wie schauts hinterm
Eselsbeck aus! Das Kreuzwirtshaus und zwei andere Bürgerhäuser

Blick über den Pfarrgarten auf St. Martin. Am Ende
des Gartens standen einst das Kreuzwirtshaus und zwei Bürgerhäuser.
sind Ruinen, auf denen Büsche und kleine Bäumlein wachsen.
Beim Kronenwirt erfährt er dann, dass 1640 diese drei Häuser niedergebrannt
sind. Er hört ferner, dass der Nachbar, der Regierungsrat Dr. Ulrich, wegen
seines evangelischen Glaubens nach Nürnberg ins Exil gegangen ist. Das Haus gehört
ihm noch, und der Herr Stadtpfarrer Dr. Hantsch bewohnt es als Mieter. Die
Herren Jesuiten haben nämlich den alten Pfarrhof bei St. Georg vom Kurfürsten erhalten
und einen eigenen Pfarrhof hat man in Amberg noch nicht erworben. Die Gäste
erzählen ihm von der Beschießung der Stadt anno 1648 durch den schwedischen
General Königsmarck, von den häufigen Einquartierungen, den hohen Kriegssteuern
und immer wieder vom Pestjahr 1634 und vom Auszug vieler Mitbürger um des
evangelischen Bekenntnisses willen. Immer mehr interessiert den Feldschmied,
der in den Kriegsjahren auch viel erlebt hat, das Geschick dieser Stadt. Man
schildert ihm den Brand des Schlosses 1644: Während eines schrecklichen
Gewitters schlug der Blitz ein, und trotz aller Löschversuche brannten alle
Gebäude völlig aus. Ein schreckliches Schauspiel! So groß war die Hitze, dass
sich die Kanonen mit lautem Donner selbst entluden und in der Stadt große Verwirrung
entstand, weil man glaubte, der Feind stehe vor den Mauern. Man fürchtete, das
Feuer könne über die Stadtbrille aufs Zeughaus überspringen. Da hat man den
Pulverturm vorsichtshalber ausgeräumt und viele Zentner Schießpulver in die Vils
gekippt. „Der Herr soll sich nur ansehen, was von dem schönen Schloss geblieben
ist.“
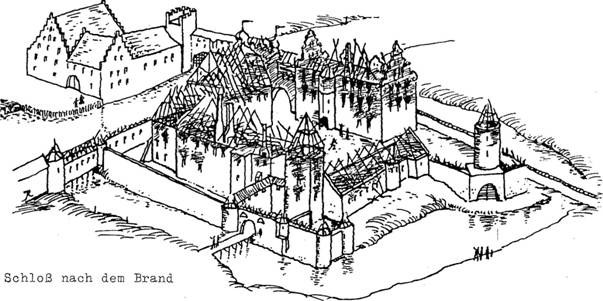
Das tut er auch. Sind diese kahlen, zerrissenen Mauern wirklich
einst das schöne und prächtige Schloss gewesen, in dem die pfälzischen
Kurfürsten residiert haben? - Es wird allmählich Abend.
Beim Schmied am Rossmarkt, wo er einst gelegentlich
gearbeitet hat, bittet er nach altem Handwerksbrauch um Herberge und Arbeit.
Der Meister, er ist der dritte seit 1625 auf dieser Schmiede, nimmt ihn gerne
auf. Am nächsten Tag schon steht Jörg am Amboss und hämmert an einer
Pflugschar.
Was ist noch viel zu erzählen? Die Arbeit gefällt ihm und
die Stadt auch. Nach einigen Wochen lässt er sich die seit Jahren leer stehende
Schmiede am Vilstor vom Stadtrat überschreiben. Zahlen braucht er fast nichts,
denn herrenlose Häuser hat die Stadt genug. Froh ist man im Rathaus über jeden, der sich in Amberg
niederlässt. - Jörg Rauch hat in Amberg eine Heimat gefunden.
Die Verhältnisse in Amberg waren 1649 wirklich so schlimm,
wie sie Jörg Rauch, eine erfundene Person allerdings, erfahren hat. 1621, als
der Bayernherzog Maximilian Amberg besetzte, hat allein das Salzamt 40 000
Gulden an Kriegskosten abliefern müssen. Bergbau, Erz- und Eisenhandel kamen im
gleichen Jahr zum Erliegen. 1628/29 verließen gegen 140 Bewohner vielfach mit
ihren Familien die Stadt, um nicht ihren Glauben wechseln zu müssen. Die
meisten dieser Auswanderer gehörten zum wohlhabenderen Teil der Bürgerschaft
und nahmen gut ein Viertel des steuerpflichtigen Vermögens mit ins Exil. Dann
kamen Einquartierungen und hohe Kriegssteuern, auch deshalb verließen manche
Bürger ihre Vaterstadt. 1648 waren 66 Häuser herrenlos und teilweise
eingefallen. Noch 1680 konnte man für 1 Gulden Jahreszins, den erbrachte
bereits ein Kapital von 20 Gulden, ein Haus erwerben. Ja, schon durch die
Übernahme der Reparaturkosten konnte man Besitzer eines verlassenen Hauses
werden. Selbst um 1700 waren so stattliche Gebäude wie der Eichenforst noch unbewohnt.
Nicht besser sah es rings um Amberg aus. Leerstehende,
eingefallene und niedergebrannte Bauernhöfe gab es 1648 nahezu in jedem Dorf.
Manche Ortschaft, z. B. Schlauderhof mit 4 Höfen, war völlig verlassen. Viele
Felder und Wiesen waren ab 1634 zu Wald geworden. Nur sehr langsam erholte sich
die Oberpfalz und Amberg von den verheerenden Auswirkungen des Dreißigjährigen
Krieges.
Wie dem Jörg Rauch ist es seitdem vielen ergangen, die
zufällig nach Amberg kamen und blieben. Manche, die gegen ihren Willen nach
Amberg mussten, verließen später die Stadt ungern. Bei Staatsbeamten galt der
Spruch: „Zweimal weint jeder, der nach Amberg versetzt wird, einmal wenn er
ankommt und dann, wenn er weg muss.“ Übrigens, die letzte Schmiede in Amberg,
es war jene, die unser Jörg erworben hat, wurde erst 1980 aufgegeben. Man
findet das schöne Fachwerkhaus beim Vilstor an der Ecke Jesuitenfahrt / Vilsstraße.
Der hochwürdige Herr Nikolau Dorn hatte schwierige Aufgaben
übernommen, als er 1646 in den Wirren des großen Krieges Pfarrer von Amberg wurde.
Es war für ihn kein Pfarrhof vorhanden, es fehlte an Geistlichen, und die
Gläubigen waren arm. Sehr grämte er sich über seine Pfarrkirche St. Martin. In
den Zeiten der Bilderstürmer waren alle Figuren, Altäre und Bilder entfernt
worden. Als Hochaltar diente ein gewöhnlicher Holztisch mit einem großen Kreuz,
hinter welchem ein roter Teppich hing. Wohl hatte die Regierung den Jesuiten
schon 1627 für die Errichtung eines großen, würdigen Altares eine stattliche
Summe versprochen, doch dann waren die schlimmen Kriegsjahre gekommen, und das
Geld war für Waffen und Söldner verwendet worden.
25 Jahre sind inzwischen vergangen und die „vürnehmste und
Hauptkirche in der Oberen Pfalz“ ist immer noch leer und schmucklos. Dekan
Bayer kann nichts unternehmen, denn das Kirchenvermögen ist dahingeschmolzen
und von den verarmten Pfarrkindern kann er nicht viel erwarten.
Um so mehr ist der Dekan überrascht, als er 1653 aus München
erfährt, dass tausend Gulden für die Errichtung eines Hochaltars zur Verfügung
stehen. Mit der Stadtverwaltung und mit den Herren in der Regierungskanzlei
kann sich der Pfarrer rasch einigen. Eifrig plant man, doch dann kommt kein
Geld. Drei Jahre vergehen, und nichts geschieht für St. Martin.
Da erhält im November 1656 der Botenmeister Schmauß den
Befehl, 1.500 Gulden beim Zahlamt München abzuholen und diese stattliche Summe
für den Hochaltarbau aufzubewahren. Sogleich plant man wieder. Ein großer Altar
soll's werden, ein Werk, welches das hohe Kirchenschiff bis zur Decke ausfüllt.
Ein wertvolles Bild will man, und deshalb verhandelt man mit den Erben des
bedeutendsten Künstlers Europas, Peter Paul Rubens in Antwerpen. Als aber diese
Erbengemeinschaft 2.000 Brabanter Taler forderte, das entspricht 1.200
bayerischen Gulden, kriegen die Amberger Bedenken.
Da bietet ein anderer Maler, Caspar de Crayer nennt er sich,
den Ambergern seine Dienste an. Er hat nicht nur bei Rubens gelernt, sondern
auch viele Jahre in dessen Werkstatt mitgearbeitet. An manchem Rubensgemälde
hat er mehr gemalt als der große Meister. Nein, es muss kein teuerer Rubens
sein! Für 900 Gulden will dieser tüchtige Rubensschüler ein Riesengemälde von
20 Schuh Höhe und 15 Schuh Breite liefern. Lange Verhandlungen braucht's da
nicht. Crayer erhält von der Regierung der Oberpfalz den Auftrag für das Hochaltarbild
der Martinskirche. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
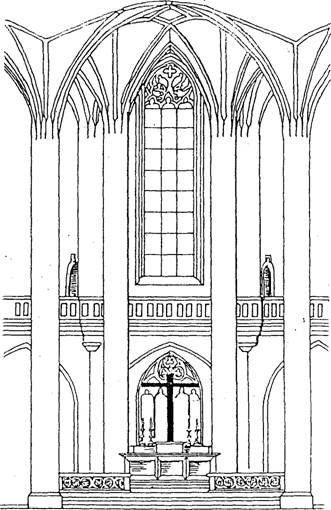
Im Januar 1659 holt der Amberger Malermeister Loots das
große Gemälde, auf dem alle in Amberg besonders verehrten Heiligen und die
Krönung Mariens durch die Heilige Dreifaltigkeit dargestellt sind, in
Antwerpen ab. Wohlbehalten bringt er die zusammengerollte Leinwand nach Amberg.
Erfreut bestaunen Dekan Dorn, der Kirchenrat und die Herren der Regierung das
herrliche Bild; ein größeres und schöneres hat Amberg noch nie gesehen.
Die ausgeräumte Martinskirche
Für den Altaraufbau verpflichtet man den Schreinermeister Wirsching
von Neumarkt. Für 900 Gulden will dieser einen mächtigen Altar mit zwei gewundenen
Säulen und vielem Schnitzwerk fertigen. Schon im Dezember 1659 erhält Dekan
Dorn einen Brief, dass 8 bis 10 Fuhrwerke zum Abholen von fertigen Altarteilen
nach Neumarkt kommen möchten, doch solle man gutes Wetter abwarten. Das tut
man. Im Januar 1660 können weitere 6 Fuhren nach Amberg gebracht werden. Im
städtischen Salzhaus stapeln sich allmählich Bretter, Balken, Gesimsteile und
Säulen. Obwohl der Neumarkter Meister mit 6 Gesellen arbeitet, dauert es noch
viele Monate, ehe alle Engel, Ornamente und Blumengebinde geschnitzt sind.
Im Januar 1661 fordert Wirsching wieder 10 Fuhrwerke an,
doch möge man abwarten, bis die Straßen besser befahrbar sind. Er wünscht
ferner einen Aufseher beim Aufladen und Abladen der Schnitzwerke und mahnt, die
Arbeiten ja gut zu lagern. Im Juni 1661 kommen endlich die letzten Stücke nach Amberg.
Die Aufstellung des Altars wird für Amberg eine kleine
Sensation. Für Holzgerüste hat die Kirchenverwaltung bereits gesorgt, und rasch
wachsen die Säulen und Altarwände fast bis zum Scheitelpunkt des Gewölbes
empor. Dann soll das farbenprächtige, große Crayerbild eingefügt werden.
Doch welche böse Enttäuschung! Ist der bayerische Schuh größer
als der von Brabant? Hat sich Crayer beim Messen geirrt? Das Bild ist zu kurz
und füllt nicht die Höhe des freigelassenen Mittelfeldes. Was ist zu tun?
Man wagt in Amberg keine Entscheidung und wendet sich an die
kurfürstliche Regierung in München. Von dort kommt der knappe Befehl, das Bild
ist unten ein Stück anzusetzen. Wer sollte das tun? Soll man das Bild wieder
nach Antwerpen schicken? Da übernimmt der Amberger Malermeister Loots diese
schwierige Arbeit. Sie gelang ihm so vortrefflich, dass heute niemand diese
Ergänzung des Crayerbildes bemerkt.
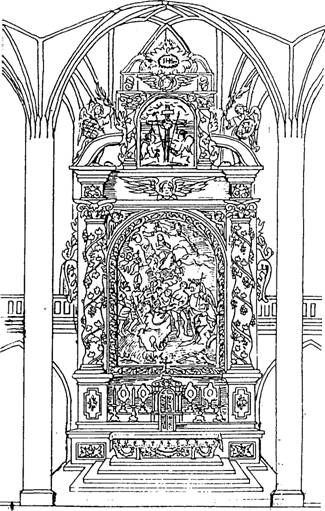
Gott sei Dank, der Altar steht.
Schwierigkeiten bereitet inzwischen die Finanzierung. Die
1500 Gulden sind schon lange aufgebraucht, und der Kirchenverwalter ist nicht
in der Lage, Loots die Transportkosten zu erstatten.
Natürlich muss er auch auf die Bezahlung der Vergrößerung
des Crayerbildes warten. Dekan Bayer versucht, durch einen Opferstock der Finanzmisere
abzuhelfen. Doch nur gut 50 Gulden kommen im Lauf der Monate zusammen, und
damit sind noch nicht einmal Loots Reisekosten gedeckt.
Da weiß die Regierung eine bessere Geldquelle. Mit
Strafgebühren soll der Hochaltar bezahlt werden. Wer sich in der Oberpfalz
Raufhändel, irgendwelche Unbotmäßigkeiten oder den Bruch kirchlicher Gebote, z.
B. des Fastens, der Sonntagsheiligung oder gar einen Ehebruch leistet, muss
jetzt besonders kräftig zahlen, denn der Hochaltar in der Hauptkirche der oberpfälzischen
Hauptstadt ist teuer. So können durch Strafgelder Schulden getilgt werden. Der
Altar verbleibt jedoch vorerst ohne Farbe und Vergoldung.
Wieder vergehen 5 Jahre. Erst 1664 kann der Amberger
Schreiner Allers den Tabernakel fertigen. Für das Bekrönungsstück über dem
großen Gemälde liefert Maler Loots ein Bild mit den Leidenswerkzeugen Christi.
Auf seinen Lohn in Höhe von 96 Gulden muss er allerdings wieder einige Zeit
warten. 1667 stirbt Dekan Dorn, der sich 12 Jahre mit dem Hochaltar der
Martinskirche beschäftigen musste, vollenden konnte er ihn nicht. Diese Arbeit
musste er seinem Nachfolger Christoph Bayer überlassen.
Im Sommer 1670 verpflichtet man Meister April von Stadtamhof
für die Fassarbeiten am Altar. Dunkelbraun soll die Grundfarbe sein, nur die
Rückseite ist gelb zu bemalen. Alles Schnitzwerk dagegen, auch die großen Säulen
und die Engel müssen mit Blattgold gefasst werden. Gesichter, Arme und Füße der
Engel sollen fleischfarbig eingefärbt werden. Schließlich verpflichtet sich
April, ganz oben den Namen Jesu und einen Strahlenkranz in Blattgold
anzubringen und die Schilde der großen Engel auf den Gesimsen mit dem bayerischen
Wappen zu schmücken. Im November 1670 kann Meister April seine Arbeit beenden.
Für Löhne und Material zahlt man ihm 1200 Gulden.
Vom Baugerüst befreit steht nun der Altar mit dem prächtigen
Crayerbild und den goldglänzenden Schnitzwerken vor der staunenden Amberger Bürgerschaft.
– „Gut Ding braucht Weile“, denkt Dekan Bayer, denn immerhin sind 43 Jahre
vergangen seit dem ersten Entschluss zur Errichtung eines Hochaltars. 17 Jahre
hat man an diesem größten Barockaltar der Oberen Pfalz gearbeitet und über
4.200 fl ausgegeben.
Das Bild Crayers, es ist über 30 m² groß, ist über dem
Sakristeieingang der Martinskirche auf der Empore zu sehen. Bis heute blieb es
das größte Gemälde Ambergs.
1658 wurde übrigens eine langjährige Verbindung zwischen
Amberg und Kaspar Crayer, dem großen Künstler aus Antwerpen (gestorben 1691), angebahnt.
Die Martinskirche erhielt noch zwei Bilder dieses Meisters, das große Gemälde
der Enthauptung des heiligen Johannes ist jetzt im Turmgewände aufgehängt, ein
kleineres Bild, das Maria im Kreis vieler Heiliger zeigt, ist neben dem
Sakristeizugang zu bewundern. Auf diesem letzten Bild hat sich der Meister samt
seiner Familie selbst dargestellt. Drei Altarbilder der Georgskirche (Kreuzabnahme,
St. Ignatius und Franz Xaver) sind von ihm und das prächtige Gemälde mit der
Himmelfahrt Mariens im Kongregationssaal ebenfalls.
Das große Bild in St. Martin hat allerhand erlebt. 1703, bei
der Belagerung Ambergs, wurde es von einer österreichischen Kanonenkugel völlig
zerfetzt. Der heute vergessene Amberger Malermeister Wilhelm hat das Werk eines
der besten Rubensschüler so zusammengeflickt und restauriert, dass der Schaden
heute sogar Fachleuten nicht mehr erkennbar ist.
Der große Altar Wirschings wurde 1871, als die Martinskirche
ihre jetzige, dem gotischen Charakter der Kirche angepasste Ausstattung
erhielt, abgebrochen und leider vollständig zerstört. Ein Engelskopf im Museum
dürfte der letzte Rest dieses großen, barocken Werkes sein.
Ähnlich wie den Amberger Regierungsräten und dem Dekan im
Jahr 1661 erging es den Jesuiten 1768 mit ihrem Hochaltarbild in St. Georg. Der
Münchner Hofmaler Schöpf hatte ein neues Altarbild geschaffen. Als man dieses
in den vorhandenen Altar einsetzen wollte, war es zu hoch. Die Patres standen
vor der Wahl, entweder den Drachen zu Füßen des Kirchenpatrons oder die Hl.
Dreifaltigkeit über dem heiligen Georg abzuschneiden. Sie entschieden sich für
die 2. Möglichkeit. Der abgeschnittene Bildteil ist im Maltesergebäude
aufbewahrt. Der Hochaltar der Georgskirche entspricht übrigens annähernd jenem,
den Wirsching für St. Martin schuf.

1703 kämpfen der Kaiser und seine Verbündeten gegen Ludwig
XIV. von Frankreich und Kurfürst Max Emanuel von Bayern um die vielen Länder,
welche der kinderlos verstorbene König Spaniens hinterlassen hat. Über ganz
Europa weitet sich dieser Erbfolgekrieg aus, und unsere Oberpfalz bleibt nicht
verschont. Ende August 1703 rückt der kaiserliche General Herbeville von Böhmen
her in die Oberpfalz ein. Das Städtchen Furth im Wald kapituliert nach kurzer
Beschießung. Cham leistet länger Widerstand, doch Anfang Oktober muss die
Besatzung von 250 Mann die Stadt übergeben. Ohne Gegenwehr rückt Herbeville
gegen Westen, denn Kurfürst Max Emanuel liegt mit seinem Heer in Schwaben und
denkt nicht daran, seinen oberpfälzischen Untertanen zu helfen. Die
Kaiserlichen fühlen sich schon als die Herren des Landes und sind sehr
erstaunt, als der Stadtkommandant von Amberg, Graf San Bonifacio, sich weigert,
Amberg zu räumen.
Während die kaiserlichen Truppen rings um Amberg Quartier
beziehen, reitet General Herbeville mit einigen Offizieren auf den
Mariahilfberg, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Erfreut ist er nicht über das, was er durch sein Fernrohr
sieht. Will man die Stadt erobern, muss man erst Palisaden und spanische Reiter
im Vorfeld wegräumen. Dann hat man den Vorwall zu stürmen, ehe man zum tiefen
Wallgraben kommt, hinter dem der große Hauptwall droht. Ist der gewonnen, dann
steht man vor dem wassergefüllten Stadtgraben. Wie soll man den durchwaten,
wenn hinter der Zwingermauer, auf dem Wehrgang der Hauptmauer und in den vielen
Türmen entschlossene Verteidiger stehen? Eine richtige Festung, dieses Amberg!
Man muss schweres Geschütz haben, um diese Mauern zu bezwingen. Sogleich
schickt der General einen Offizier nach Nürnberg, um Pulver und
Belagerungsartillerie von der Reichsstadt anzufordern. - Gelegentlich kracht
unten ein Schuss. „Sind recht aufgeregt, diese Amberger, und haben anscheinend
zu viel Pulver“, spötteln die Offiziere.
General Herbeville hat genug gesehen. Nachdenklich wendet er
sich zum Gehen und nimmt erst jetzt so richtig die schöne, große
Wallfahrtskirche wahr. Langsam steigen die Österreicher die Stufen hinauf und
verweilen andächtig vor dem Bild Mariahilf. Als sie gehen wollen, nähert sich
etwas verlegen der Prior Pater Bonaventura und bittet die Herren, ins Kloster
zu kommen.
Im kleinen Refektorium isst man gerade, und es bedarf keiner
langen Rede, dann sitzen die Österreicher mit den Patres vor der dampfenden
Schüssel mit Hühnersuppe. Während des Essens plaudert man über die Wallfahrtskirche
und ihre Geschichte,
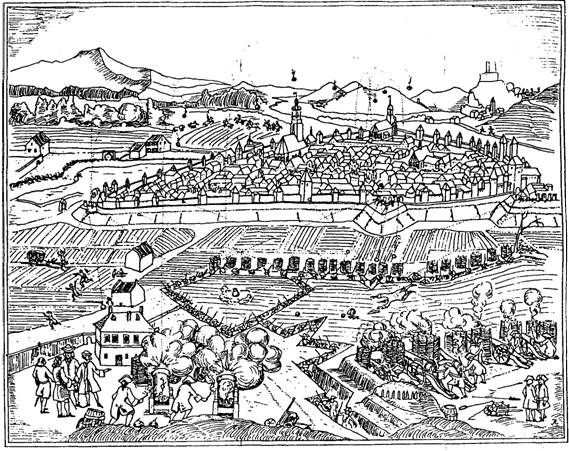
In der Wallfahrtskirche Fronberg bei Hahnbach befindet
sich dieses Votivbild, das die Belagerung des Jahres 1703 in vielen
Einzelheiten zeigt.
über die noch fehlenden Altäre und die so wertvollen
Votivgaben. Der Prior nutzt diese Gelegenheit und bittet den General um ein
Wachkommando für Kirche und Kloster. Herbeville ist ungehalten über diesen
Wunsch, denn er kommandiert schließlich keine Räuberbande. Unwillig winkt er ab.
Dann kommt das Gespräch auf die bevorstehende Belagerung.
Was erzählen die Franziskaner? 2500 Soldaten und 1000 Mann des bewaffneten Landvolks
sollen in der Stadt sein. Der General schaut ernst drein. „Was, 60 Geschütze
sollen auf den Wällen stehen? So viele haben wir nicht“, meint der General
nachdenklich. „Dazu kommt die Bürgerwehr!“, trumpft Pater Bonaventura auf. „Sind
tüchtige Leute und wissen sogar mit ihren Geschützen wie richtige Kanoniere
umzugehen.“ Doch da kann der General nur lachen: „Aber Herr Pater, von Bäckern,
Metzgern und Köchen, die gelegentlich zu Fronleichnam einen Böller krachen
lassen, hat die kaiserliche Armee sicherlich nichts zu fürchten.“
Da, ein scharfes Sausen in der Luft, splitterndes Glas,
polternde Steine, aufplatzendes Gemäuer und Schreie des Entsetzens! Nachdem
sich der Staub in der Stube verzogen hat und sich einige Herren die Hühnersuppe
aus den Augen gewischt haben, sehen alle die Bescherung. Da liegt zwischen
Scherben der Suppenschüssel und Putzbrocken und Steinen eine glänzende schwarze
Kugel auf dem Tisch.
Niemand ist verletzt. Der General fasst sich zuerst. Als er
die aufgeregten und erschrockenen Gesichter seiner Umgebung sieht, zwingt er
sich zu besonderer Gelassenheit: „Recht habt Ihr, Hochwürden, schießen können
diese Metzger und Gastwirte.“

So unfreundlich haben die Amberger 1703 dem
kaiserlichen General Herbeville einen besonders harten Knödel zur Hühnersuppe
serviert.
Er klopft sich den Staub vom Uniformrock. Pater Bonaventura,
noch etwas blass vom Schrecken, antwortet hastig und aufgeregt:
„Ja, da haben Euch diese Böllerschützen einen hübschen
Knödel zur Suppe serviert. Seht Euch vor, die haben noch mehr von dieser Art.“
Der General nickt und drängt zum Aufbruch. Als er sich an der Pforte vom Prior
verabschiedet, überkommt ihn angesichts der glücklich vorübergegangenen Gefahr
der Wunsch,
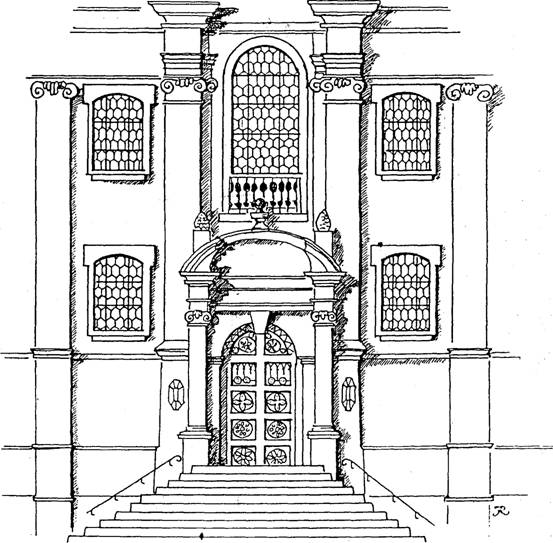
Über .dem Portal der Bergkjrche hat man die
Kanonenkugel, die 1703 die Mahlzeit der Österreichischen Offiziere störte, als
Schmuck angebracht.
aus Dankbarkeit jemandem eine Freude zu bereiten. Recht froh
fühlt er sich. „Pater, für Eure gut gemeinte Gastfreundschaft sollt Ihr die
erbetene Wache haben“, versichert er und fährt schmunzelnd fort, „doch sorgt
dafür, dass diese Amberger Schützen Eure Wächter, Euch selbst, Euer Kloster und
besonders diese schöne Kirche nicht weiter mit Knödeln traktieren. Übrigens,
den Knödel dort, den schenke ich Euch.“ Pater Bonaventura verspricht: „Herr
General, den werde ich als Andenken an Eueren Besuch gut aufheben.“ Das tat der
Pater. Die schwarze Kugel ist noch immer über dem Kirchenportal zu sehen.
Die Geschichte um diese Kanonenkugel ist eine schöne
Erfindung. Schon schießtechnisch war damals so ein gezielter Schuss nicht
möglich. Man hat zwar 1704 das Dach der Bergkirche, das versehentlich von den
Ambergern getroffen wurde, ausbessern müssen, aber nichts am Kloster. Auch ist
in der Chronik des Klosters dieser Wunderschuss nicht vermerkt. Und was geschah
wirklich im November 1703?
Nachdem schweres Geschütz aus Nürnberg eingetroffen war,
ließ General Herbeville am Martinstag die Stadt mit glühenden Kugeln und mit pulvergefüllten
Hohlkugeln „bombardieren“. 40 Wohnhäuser und 80 Nebengebäude brannten völlig
aus. Sogar der Martinsturm stand in Flammen, doch gelang es einem Franziskanerpater,
das Feuer zu löschen.
Die Schäden am Turm waren jedoch so schwer, dass man ihn
1720 bis zum Glockenstuhl abbrechen musste. Beim Neuaufbau erhielt der
Martinsturm seine jetzige Gestalt und Höhe (92 m).
Die Kaiserlichen begnügten sich mit diesem einen
Bombardement. An einer Zerstörung Ambergs lag ihnen nichts, an einem
Winterquartier dagegen sehr viel. Sie begannen anschließend die Stadtmauer
dort, wo jetzt das Kaufhaus Whörl steht, niederzuschießen. Bei der geringen
Treffsicherheit der damaligen Geschütze wurden dabei im Laufe des Novembers viele
Gebäude beschädigt. Die Belagerer arbeiteten sich in den nächsten Wochen in
mehreren Sturmgräben fast bis an den Hauptwall heran. Einem Generalsturm, der
für die Stadt die schlimmsten Folgen haben musste, stand nichts mehr im Wege,
nachdem ein Stück der Stadtmauer zusammengestürzt war und die Mauertrümmer
teilweise den Graben füllten.
Am 28.11.1703 gewährte General Herbeville der Stadt und der
Besatzung eine überaus ehrenvolle Kapitulation. Die bayerischen Truppen durften
mit allen Waffen, Fahnen und klingendem Spiel nach Regensburg abziehen. Den
Bürgern wurde größte Schonung und Rücksichtnahme zugesichert. Die Herren der
Regierung konnten in kaiserlichen Dienst treten, sie durften aber auch mit all
ihrem Hab und Gut zum bayerischen Kurfürsten ziehen oder in Amberg
privatisieren. Die Soldaten des Landaufgebots, zumeist waren dies Bauern der Umgebung,
durften sofort heimkehren. Allerdings musste die Stadt 20 000 Gulden
Kriegssteuer zahlen.
Die Belagerung von 1703 hat auf beiden Seiten keine großen
Verluste verursacht. In Amberg fanden 27 Beerdigungen statt, also nicht mehr
als in Normalzeiten. Nur zwei Soldatenbegräbnisse stehen im Sterbebuch. Die Schäden
an den Gebäuden waren schwer. Kaum ein Haus war verschont geblieben. Am
Gasthaus Schießl, am Walfischhaus und am Einwohneramt erinnern Kanonenkugeln an
das Jahr 1703. Erst 1714, nachdem der Friede von Rastatt den großen Krieg
beendet hatte, wurde Amberg wieder bayerisch.
Schustermeister Hans-Georg Haider war ein großer Freund und
Verehrer des Hl. Sebastian. Diesen tapferen, edlen römischen Offizier, der als
großer Helfer in Pestzeiten galt, schätzte er besonders. Seit seiner Kindheit
war er gerne hinaufgegangen zur Sebastianssäule über der Hockermühle, wo vor 200
Jahren schon eine Kapelle dieses Heiligen gestanden hatte. Leider war sie 1566
von den Bilderstürmern zerstört worden. Alle, die mit ihm zu tun hatten,
wussten von seiner großen Verehrung für St. Sebastian. Seinen größten Wunsch,
die abgebrochene Sebastianskapelle wieder erstehen zu sehen, den konnte und
wollte jedoch niemand erfüllen.
Die Jahre vergingen, Georg Haiders Kinder wuchsen heran. Die
Kriegszeit von 1703 brachte ihre Nöte und Sorgen. Dann ging einer seiner Söhne
zum Studium der Theologie nach Rom. An einen Wiederaufbau der Sebastianskirche
dachte der Schuster kaum mehr.
Da geschah 1708 etwas ganz Unerwartetes. Ein dicker Brief
kam aus Rom von seinem Sohn, und was dieser schrieb, das war wirklich nicht zu
glauben. Der oberpfälzer Sohn eines Handwerkers war mehrmals von einem vornehmen,
würdigen Kurienkardinal eingeladen worden. Der hohe Kirchenfürst hatte bald
Gefallen an dem jungen Amberger gefunden und nun verband beide eine enge
Freundschaft. Der alte Haider schüttelte darüber verwundert den Kopf. Doch der
Brief war noch nicht zu Ende. Sein Sohn hatte dem vornehmen Römer von der
abgebrochenen Amberger Sebastianskirche erzählt und von seinem Vater, der so
gerne diese Kirche aufgebaut sähe. Was nun folgte, musste der Schuster zweimal
lesen. Zwei vollkommene Ablässe hatte der Kurienkardinal vom Heiligen Vater
Klemens für die künftige Sebastianskirche erwirkt.
Da lagen nun die beiden wertvollen Dokumente, sorgfältigst
geschrieben von der päpstlichen Kanzlei, versehen mit dem päpstlichen Siegel
und unterschrieben vom Heiligen Vater. Kaum anzurühren wagte der Schuster diese
Dokumente. „Jetzt muss die Sebastianskirche wieder gebaut werden“, freute sich
der Schuster.
Doch so einfach ging es nicht. Sicher, die hochwürdigen
Herren am Ordinariat zu Regensburg waren über die beiden Ablassbriefe sehr
erfreut und gratulierten Amberg zu diesem päpstlichen Gnadenverweis. Sie wiesen
aber darauf hin, dass der Bau der Kapelle eine Angelegenheit der Amberger sei.
Dekan Tatzmann zeigte recht wenig Interesse an einem
weiteren Kirchenbau in Amberg und zweifelte sogar die Echtheit der beiden
Ablassbriefe an. Der Verwalter der Mess-Stiftungen wurde fast böse, als er von
der Möglichkeit der Wiederaufrichtung des Sebastiansbenefiziums erfuhr. Da
müsste ja ein neuer Benefiziat aufgestellt und bezahlt werden! Gegen den
Kirchenbau selbst hätte er nichts. Die Herren des Stadtrates waren natürlich
erfreut über die Ablässe und die Möglichkeiten einer Winterwallfahrt in Amberg.
Gerne wollten sie die Kirche aufbauen lassen, nur Geld wollten sie dafür nicht
aufwenden. Auch die Regierung der Oberpfalz in Amberg begrüßte es sehr, dass
St. Sebastian, der allseits verehrte bayerische Landespatron, eine eigene
Kirche erhalten werde. Tun könne sie dafür leider nichts. Kurz, alle wollten
St. Sebastian jede nur denkbare Ehre erweisen, die dafür nötigen materiellen
Opfer aber sollte jeweils eine andere Instanz bringen. Georg Haider konnte es
nicht fassen, dass sich in den nächsten 12 Monaten gar nichts tat, außer, dass
bei den verschiedenen Behörden Akten über den Fall Sebastianskapelle angelegt
wurden.
Da machte er sich selbst ans Werk. Mit einigen freiwilligen
Helfern begann er den arg verwachsenen Platz der einstigen Sebastianskapelle
abzuräumen. Zwischen Schutthügeln legte er die Fundamente der abgebrochenen
Kirche frei und diese Mauern waren so massiv, dass man ohne Gefahr auf ihnen
weiterbauen konnte.
Dann stellte Haider einen Opferstock an der Straße nahe der
Sebastianssäule für den Bau der neuen Sebastianskirche auf. Ganz besonders
freute er sich, wenn immer wieder Bürger zu ihm kamen und ihm auch Geld für den
künftigen Kirchenbau brachten. Bald verfügte der bescheidene Schuster über
Geldsummen, mit denen er bisher nie zu rechnen hatte. Doch er wusste, Bauen war
teuer. Deshalb ging er immer wieder mit einer Opferbüchse durch das
Landrichteramt Amberg und sammelte bei den Bauern für seine Kirche. Schließlich
legte er am Hohenburger Weg mit Erlaubnis des Grundbesitzers einen Steinbruch
an. Freiwillige Helfer stellten sich ein und mit wenig Mitteln konnte man
Baumaterial gewinnen. Von all diesen Eigenmächtigkeiten nahmen die Herren der
Regierung und des Stadtrats keine Notiz. Immerhin wurde dem Schuster nichts
verboten.
Trotz dieser vielen Tätigkeiten hatte der Schuster immer
wieder bei Behörden schriftlich angefragt, gemahnt und gedrängt und sich
schließlich sogar deutlich beschwert. Endlich wies die hohe Regierung der
Oberpfalz in Amberg den Stadtrat an, sich ernstlich mit dem Tun und Treiben Haiders
zu befassen. So kam am 10. Juli 1710 eine Konferenz zusammen.
Was die Herren Stadträte hier erfuhren, konnten sie kaum
begreifen. Sauber abgeräumt war der Bauplatz. 76 Fuder guter, großer
Quadersteine waren aus dem nahen Steinbruch herangeschafft worden. Der
Steinbruch war so gut erschlossen, dass man noch alles übrige Baumaterial hier
gewinnen konnte. Dann kam die Spendenabrechnung. 150 Gulden hatten Wohltäter
dem Schuster ins Haus getragen. 100 Gulden konnte er aus dem Opferstock
entnehmen. Fast 180 Gulden hatte Heider bei seinen Bettelgängen über Land von
den Bauern erhalten. Man konnte nicht mehr zurück, die Sebastianskapelle musste
gebaut werden.
Ein Baumeister wollte Georg Haider jedoch nicht werden, er
wollte als Schuster lieber bei seinem Leisten bleiben. Froh war er deshalb,
als Herr Samuel Hetzendorfer, Mitglied des Inneren Rates, Schwarzfärber und
Besitzer des Walfischhauses, die weitere Leitung des Bauvorhabens übernahm.
Hetzendorfer, ein begeisterter Liebhaber der Baukunst begann sofort mit den
Arbeiten. Eng arbeitete er mit Maurermeister Beimbl zusammen, dem Baumeister
unserer Bergkirche.
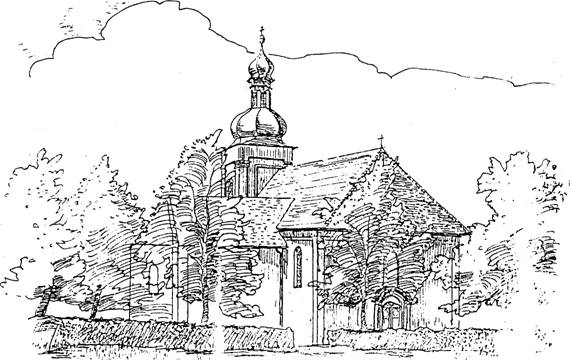
St. Sebastian, erbaut 1711 Der Anbau gen Norden
entstand 1755
Doch für Haider war damit sein Wirken für St. Sebastian
nicht zu Ende. Geld brauchte man weiterhin, und so zog er mit entsprechenden
Bescheinigungen und Empfehlungen der Stadt und des Pfarrers durch ganz Bayern
und bettelte für den Kirchenbau. Von Waldsassen bis Mühldorf am Inn klopfte er
bei Pfarrherren, Stadträten, Märkten und Adeligen an, um einige Kreuzer zu erhalten.
40 bis 50 Gulden brachte er im Durchschnitt von jedem seiner zwölf Bettelgänge
heim. Ungefährlich waren diese Reisen nicht, und 40 Gulden in Kleingeld hatten
zudem ein schönes Gewicht.
Ein besonderes Erlebnis hat Haider immer wieder erzählt. Im
Spätsommer 1712 war's. Er war mit seinem Begleiter, dem Christian Steinmüller
bis Wasserburg gekommen. Demütig trugen sie Bürgermeister und Stadtschreiber ihr
Anliegen vor und baten in bescheidenen Worten um ein Bauopfer. Die beiden
Herren prüften gar kritisch die Bescheinigung der beiden. Dann entfernte sich
der Bürgermeister. Zum Erstaunen der beiden Bittsteller kam er mit zwei
Stadtknechten wieder und ließ die beiden Amberger abführen. Von Schwindlern und
Urkundenfälschern hörten sie noch etwas, und dann saßen sie in finsteren
Zellen. Bei der Vernehmung erzählten sie ihre Geschichte und wiesen sogar die
Ablassbriefe vor. Doch nichts glaubte man ihnen. Der Papst soll einem
Schusterssohn zwei Ablässe haben zukommen lassen, und diese Ablässe für eine
nichtvorhandene Kirche ausgestellt haben? Das war einfach unglaublich. Die
beiden waren für die Wasserburger raffinierte Lügner und Fälscher, die selbst
Urkunden des Heiligen Vaters nachmachen konnten. Nun, der Scharfrichter von
Wasserburg würde Arbeit bekommen um sie zum Reden .zu bringen.
Bevor man aber in peinlicher Befragung auf der Folterbank
von den vermeintlichen Spitzbuben ein Geständnis erpresste, schickte man einen
Boten nach Amberg. Er sollte exakte Auskunft bringen. Zwölf Tage war dieser unterwegs
und so lange saß Haider mit seinem Gefährten im Wasserburger Gefängnis bei
Wasser und Brot. Der Brief aus Amberg bestätigte natürlich ihre Aussagen, und
ihre Unschuld war erwiesen. Mit einer bescheidenen Gabe für die Sebstianskirche
ließ man sie wieder ziehen.
Mit großer Freude sah Haider, wie im November 1712 der Rohbau
der Kirche völlig unter Dach kam. Noch 1712 konnte er die erste Messe in der
kleinen Kirche besuchen und zu Sebastiani 1713 wurde erstmals der Ablass verkündet.
Schon 1712 hatte der Bischof ein Benefizium für diese Kirche genehmigt. Der Haiderschuster
hatte für den Heiligen Sebastian wieder eine Kirche in Amberg erstehen lassen.
Diese unwahrscheinliche Geschichte ist völlig durch
Archivalien belegt. Man kann freilich die Haltung des Pfarrers Tatzmann bis zu
einem gewissen Grad verstehen. Immerhin waren in Amberg ab 1690 die Kirchen der
Franziskaner und Jesuiten prächtig neu ausgestattet worden, dann hatten die
Salesianerinnen ein neues Kloster samt Kirche erhalten und auch die Paulaner
bauten fest an ihrem Kloster. Ab 1696 war die Wallfahrtskirche Mariahilf neu
gebaut worden und in allen anderen Kirchen Ambergs besonders in der
Martinskirche, hatte man viel für eine gediegene Inneneinrichtung geopfert.
Ab 1703 herrschte Krieg. Die Schäden der Belagerung konnten
nur allmählich behoben werden, denn Einquartierungen und Kriegsabgaben
gelasteten die Bürger noch lange. Erst 1715 erhielt die Kapelle ihren Hochaltar
und erst 1722 bekam sie Seitenaltäre und Kirchenbänke.
 Nach der
Vollendung des Neubaus der jetzigen Sebastianskirche erfahren wir nichts mehr
von Hans-Georg Haider. Auf dem Gedenkstein über dem Kirchenportal werden die
Leistungen des Ordinariats, des Stadtrats und der Regierung gerühmt. Haiders Namen suchen wir vergebens. Schließlich hat
er ja gerade nur ein Drittel der Gesamtbauausgaben beigebracht.
Nach der
Vollendung des Neubaus der jetzigen Sebastianskirche erfahren wir nichts mehr
von Hans-Georg Haider. Auf dem Gedenkstein über dem Kirchenportal werden die
Leistungen des Ordinariats, des Stadtrats und der Regierung gerühmt. Haiders Namen suchen wir vergebens. Schließlich hat
er ja gerade nur ein Drittel der Gesamtbauausgaben beigebracht.
Lange Zeit standen die Sebastianskirche und ihr Mesnerhaus allein
und einsam zwischen den Feldern und Wiesen über der Hockermühle am alten Weg
nach Hohenburg bzw. Velburg. Inzwischen sind ab 1920 nicht nur einzelne Häuser,
sondern ganze Wohnviertel und eine große Kaserne – inzwischen eine Wohnablage -
hier errichtet worden. Nach der kleinen Kirche heißt das südlich anschließende
Wohngebiet heute Sebastiansviertel. Die Kirche selbst wurde 1982/85 gründlich
restauriert.
Das Kriegsjahr 1744, das 4. des großen Krieges um das
Habsburger Erbe, ging zu Ende. Die preußische Armee, die im August in raschem
Siegeslauf Böhmen erobert hatte, lag nun nach verlustreichen Rückzugskämpfen
mit den Truppen der habsburgischen, ungarischen Königin Maria Theresia in
Schlesien im Winterquartier. Die mit Friedrich II. von Preußen verbündeten
Bayern und Franzosen hatten ab August 1744 nach und nach fast kampflos jene
Gebiete Süddeutschlands besetzt, welche die kgl. ungarische Armee, die aus
österreichischen, böhmischen und ungarischen Einheiten und Scharen von Panduren
und Kroaten bestand, freiwillig geräumt hatte. Am 20. September hatte Graf
Nadasti mit 600 Kroaten Amberg, das die Truppen Maria Theresias seit 1743
besetzt hatten, verlassen, nachdem er durch die Androhung der Plünderung 4000
fl von den Bürgern erpresst hatte.
Die österreichischen und ungarischen Verbände, die zuerst im
Laufe des Jahres über den Rhein und weit in Frankreich vorgerückt waren, dann
aber in Eilmärschen quer durch Süddeutschland nach Böhmen gegen Friedrich II.
ziehen und kämpfen mussten, richteten sich in Schlesien und Böhmen für den
Winter ein. Nur das Korps Bärnklau kehrte anfangs Dezember nach Bayern zurück
in das Gebiet zwischen Regen und Donau, das die Österreicher erst vor knapp
drei Monaten verlassen hatten. Um die Weihnachtszeit besetzten Panduren sogar
Burglengenfeld.
In Amberg, der stark befestigten Hauptstadt der Oberpfalz,
machte man sich wegen der Kroaten und Panduren Bärnklaus keine Sorgen. Seit 3.
Dezember lagen 300 Hohenzollern-Dragoner, 350 Morawitzky-Grenadiere und 400
Kommandierte des Regiments Comte de Sax in Amberg. Stadtkommandant war General
d'Envie. Alle Bürger waren bereit, ihre Stadt zu verteidigen. Auch 80 Studenten
des Jesuitengymnasiums hatten abenteuerlüstern Schreibzeug und Bücher mit
Flinte und Säbel vertauscht und übten eifrig mit diesen Waffen.
Eifrig besserte man Schanzen und Mauern aus. Besonders
bemühten sich die Bürger um die Kanonen, welche die abziehenden Ungarn im
September in den Stadtgraben gekippt hatten. Man wollte gerüstet sein. Mit
Kämpfen während des Winters rechnete jedoch niemand. Voll Zuversicht sah man
dem kommenden Jahr entgegen, denn der bayerische Kurfürst und Landesherr,
Kaiser Karl-Albrecht, war an der Spitze seiner Truppen wieder in seine
Hauptstadt München zurückgekehrt. 40000 Mann zählte die kaiserliche
Streitmacht, die gegen Inn und Donau vorrückte und in Ingolstadt einen Teil der
kgl. ungarischen Armee einschloss. Nach der Winterruhe musste 1745 die
Entscheidung zu Gunsten des Wittelbachers fallen.
An Silvester jedoch überschritt das Korps des Generals von
Thüngen, rund 16000 Mann stark, von Böhmen her die Grenze. Es sollte in der
Oberpfalz Winterquartier beziehen und die Verbindung mit der kgl. ungarischen
Besatzung in Ingolstadt herstellen.
Auch Bärnklaus Husaren rührten sich. Am 2. Januar 1745
besetzten sie Hirschau und ritten gen Amberg. Zur gleichen Zeit wollten
Dragoner der Amberger Garnison die Lage in Hirschau erkunden. Bei Steininglohe
trafen die Reiter aufeinander. Die Vorhut der Ungarn wurde zersprengt. Dann
trabten stärkere Husarenhaufen an und hetzten in wilder Jagd durch Ammersricht
und über den Galgenberg hinter den Kaiserlichen her.
Tags darauf ritten die Rotmäntel Bärnklaus gegen das
Nabburgertor und wechselten Schüsse mit der Wache, bis die Dragoner ausrückten.
Diesmal waren die Husaren die Gejagten. Erst bei Lengenfeld endete die
Verfolgung.
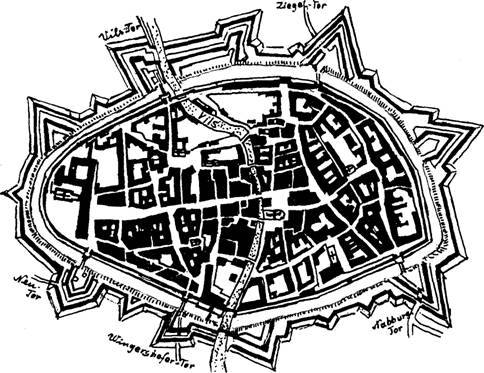
Amberg galt schon im 16. Jahrhundert laut Michael Schwaigers
Chronica als „festeste Fürstenstadt" im Reich. Der bayerische Kurfürst Max
ließ im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) rund um die Altstadt ausgedehnte Erdwerke,
also Schanzen, Wälle, Gräben und Bastionen errichten und Amberg zur stärksten
Festung Nordbayerns ausbauen. Hunderte von Bauern aus der gesamten Oberpfalz
mussten monatelang Hand- und Spanndienste leisten, und auch Bürger und Soldaten
waren zum Schanzen verpflichtet. Und der Erfolg? Amberg war eine der wenigen
Städte Bayerns, die im Dreißigjährigen Krieg nicht einmal belagert wurden.
Im Spanischen Erbfolgekrieg wurden Mauern, Türme und
Erdwerke von 1701 bis 1703 gründlich überholt, und die Stadt konnte über vier
Wochen einer Belagerung durch kaiserliche und fränkische Truppen widerstehen.
Nachdem Bayerns Kurfürst Max-Emanuel nichts unternahm, um den Belagerungsring
zu sprengen, konnte die Garnison ehrenvoll kapitulieren.
Eine letzte, sehr aufwändige Erweiterung der Erdwerke ließ
im Österreichischen Erbfolgekrieg Kurfürst Karl-Albrecht von 1741 bis 1743
durchführen. Sie bewährte sich bei der Belagerung 1745, von der hier berichtet
wird.
Am 4. Januar blieben Ambergs Tore geschlossen und die
Zugbrücken aufgezogen. 16 Geschütze wurden in Stellung gebracht. Zwei hatte
d'Envie nebst vielen Kugeln und reichlich Pulver von der bayerischen Festung
Rothenberg nördlich Hersbruck, holen lassen. Es wurde ernst. Von Thüngen rückte
gegen die Naab vor.
In Amberg blieb man gelassen. Kaiser Karl-Albrecht hatte
jede mögliche Hilfe zugesagt. 16 französische und zwei pfälzische Bataillone
und 16 Eskadrons Kavallerie sollten zwischen Kelheim, Hemau und Neumarkt aufmarschieren,
Amberg notfalls zu Hilfe kommen und die Einschließung Ingolstadts sichern.
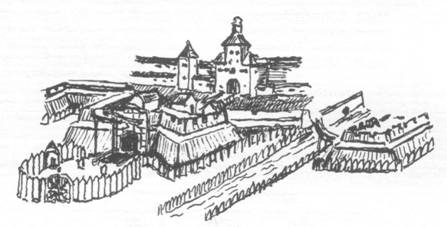
Wingershofertor um 1745
Vor der mittelalterlichen Stadtbefestigung, also vor
Stadtmauer, Zwinger, Stadttor und Stadtgraben war um 1640 die große
Wingershofertorschanze errichtet worden. Mit dem Tor war sie durch eine
Zugbrücke verbunden. Wie bei allen Amberger Toren befanden sich in dieser
Bastion das Wachlokal der Soldaten und das städtische Zollhäuschen. Dann war
noch Platz für die Aufstellung von Geschützen, und für Ausfälle konnten sich
hier die Soldaten versammeln. Auch die Schanze war von einem tiefen, breiten
Graben umgeben. Durch ein gemauertes Tor im Hauptwall und über eine weitere
Zugbrücke kam man in den Vorhof der ein einfaches Tor hatte und von Palisaden
begrenzt war. Palisaden begrenzten übrigens die gesamten Erdwerke und bildeten
das erste Hindernis für den Angreifer. Zwischen 1741 und 1743 mussten viele
Tausende fester Pfähle aus den Wäldern um Amberg geholt und auf der gegen drei
Kilometer langen Strecke in den Boden gerammt werden.
Am 5. Januar bezog von Thüngen Quartier in Pfreimd, und am
6. überschritten seine Verbände die Naab. Am Nachmittag ritt er selbst mit
vielen Offizieren über Galgenberg und Mariahilfberg nach Drahthammer, um Amberg
in Augenschein zu nehmen. Er sah, dass an den Schanzen emsig gearbeitet wurde,
besonders an jenen bei St. Georg. - Ambergs schwächste Stelle? - Man zählte die
Geschütze und wurde nachdenklich. Selber hatte man nur leichte Feldstücke.
Allen war klar, kein Offizier von Ehre konnte einen solchen Platz kampflos
übergeben. In Steiniglohe bezog man Quartier.
Vom Martinsturm hatte man diesen Erkundigungsritt gut
beobachten können. Herrn d'Envie war klar, was der oberpfälzischen Hauptstadt
bevorstand.
Am 7. Januar rückte das kgl. ungarische Korps Thüngens gen
Amberg. Am Hang des Mariahilfbergs entstand das Hauptlager. Man hob Erdgruben
aus, deckte sie mit Astwerk und Stroh ab, bezog Gartenhäuschen und quartierte
sich in den Kellern am Bergweg ein. Das Dragonerregiment Ballayra hatte das
Belagerungskorps gegen Überraschungsangriffe der Neumarkter Garnison
abzusichern. Über die Brücke bei Drahthammer, alle anderen waren auf Befehl
d'Envies zerstört worden, zogen die Reiter ab, Ziel: Ursensollen.
Inzwischen hatte der französische Stadtkommandant in
Neumarkt vom Vormarsch Thüngens gegen Amberg erfahren. Am 6. bekam er die
Anweisung, die Garnison in Amberg zu verstärken. Noch am Spätnachmittag rückte
Oberst Cocheret mit 900 Grenadieren ab und dürfte in Trautmannshofen die Nacht
verbracht haben. Bei grimmiger Kälte und miserablen Wegverhältnissen war's ein
beschwerlicher Marsch. Am 7. Januar, als die Sonne schon tief im Westen stand,
erreichten die Franzosen die Albhöhe bei Ursensollen. Sie sahen den Mariahilfberg,
das Wahrzeichen Ambergs. Nur 1 1/2 Stunden Marsch trennten die müden
Marschierer von ihrem Ziel. Cocheret ahnte keine Gefahr und ließ seine Soldaten
in Ursensollen, Ullersberg und anderen nahe gelegenen Orten Quartier
nehmen.
Es war eine böse Überraschung für die ungarischen Dragoner,
die sich in Ullersberg und Ursensollen gerade häuslich einrichteten, kochten
und die Pferde fütterten, als unvermutet französische Grenadiere über sie
herfielen. Kurz war der Kampf, allgemein das Flüchten, dann konnten die Sieger
sich über die erbeuteten Pferde, Waffen und Monturen freuen und in die schon
vorgewärmten Quartiere rücken. Endlich ausruhen! - Zwischen den Häusern lagen
einige tote Dragoner, die ersten Opfer.
Noch bei Dämmerlicht sprengten königlich-ungarische Reiter
in die Dörfer, stachen und hieben auf die überraschten Franzosen ein,
verfolgten die Fliehenden und machten 50 Gefangene. Viele Tote blieben auf dem
weiten Gefechtsfeld. Nur noch knapp 400 seiner versprengten Leute konnte Oberst
Cocheret im Schutz eines Waldes sammeln. Eiligst führte er sie gen Westen.
Die Ballayra-Dragoner waren schneller. Noch vor Kastl
stellten sie die Schar Cocherets. Der Oberst deckte mit einigen Soldaten den
Rückzug der Seinen, bis er tödlich getroffen zusammenbrach. Was den Reitern
entkommen konnte, sammelte sich in der alten Kastler Klosterburg. Am Morgen des
8. Januars kapitulierten die Letzten der Einheiten Cocherets. 11 Offiziere und
173 Soldaten mussten nach Pilsen ins Gefangenenlager marschieren.
D'Envie in Amberg wusste zu dieser Zeit bereits, was
geschehen war. Ein Bauer hatte ihm vom Anmarsch der Franzosen berichtet. Der
General hatte erwartet, Cocheret würde bis Amberg durchmarschieren und hat ihm
als Geleit die Amberger Dragoner entgegengesandt. Diese hatten im Plechholz nahe
Atzlricht gewartet und waren, als sie Gefechtslärm vernahmen, gegen Ursensollen
geritten, um festzustellen, dass niemand mehr da war, dem sie helfen konnten.
Wie durch ein Wunder konnten sie unerkannt zwischen gegnerischen Kolonnen in
der Nacht wieder in die Festung Amberg zurückgelangen.
Groß war die Enttäuschung der Amberger, als im Laufe des 8.
Januars die Kunde vom blutigen Geschehen bei Ursensollen und Kastl
durchsickerte. Siegeszuversicht weckte dagegen die Nachricht von den Kämpfen am
7. und 8. Januar bei den Verbänden der ungarischen Königin Maria-Theresia.
Am 8. Januar rückten vormittags erstmals kgl. ungarische
Truppen über den Galgenberg stadtwärts. Sie erlitten einige Verluste, als die
Ziegeltorbatterie das Feuer eröffnete. Am Nachmittag wurde d'Envie zur Übergabe
der Stadt aufgefordert, prompt folgte die Ablehnung. Kurz darauf ließ der
Stadtkommandant durch seine Dragoner die Ziegelei vor dem Ziegeltor, die den
Belagerern leicht als Unterkunft und Deckung hätte dienen können, zerstören und
niederbrennen.
Von den Flammen alarmiert eilten Panduren und Kroaten der
Brandstätte zu. Wieder donnerten die Amberger Kanonen. Ohne Verluste kehrten
die Dragoner zurück. Es kam die Nacht. Während in der Ruine der Ziegelhütte das
Feuer allmählich verlosch, flammten rings um die Stadt allüberall Lagerfeuer
auf, an denen sich frierende Soldaten wärmten.
Am 9. Januar besserten die Soldaten Thüngens die Obersdorfer
Brücke aus und arbeiteten den ganzen Tag und noch lange in die Nacht hinein an
Geschützstellungen beim Kellerweg und bei St. Katharina. 14 leichte Regimentsstücke,
zwei Achtpfünder und drei Sechspfünder wurden in die Schanzen gebracht.
Am 10. Januar begann früh um acht Uhr die Beschießung der
Stadt. Fünf Geschütze donnerten gegen die Stadtmauer bei St. Georg. Alle
anderen Kanonen schossen glühende Kugeln in die Stadt.
Die städtische Feuerordnung bewährte sich. Sauste so ein
Feuerball in ein Gebäude, dann rannte man mit Löscheimern los, um durch
Wassergüsse ein Unheil zu verhindern. Fehlte es an Wasser, tats auch Mist von
der nächsten Düngerstätte. Mit Jaucheschöpfern holte man die tückischen
Geschosse aus Scheunenecken und Dachgewinkel.
Das „Feuereinwerfen" sollte den Widerstand der Bürger
brechen. Allerdings wollte von Thüngen 1745 nicht die Zerstörung der Stadt,
die er als Winterquartier für seine Truppen vorgesehen hatte. Mit großem
Einsatz und wohl auch einigem Glück verhinderten die Bürger 1745 bei zwei
Beschießungen den Ausbruch größerer Brände. Mit Wassereimern, Mistladungen,
Jauchschöpfern und Hacken gingen sie gegen die glühenden Kanonenkugeln vor.
|

|
Rasch waren die Bürger mit diesen Löscharbeiten vertraut. In
eifriger Betriebsamkeit riefen sich die Löschmannschaften die Zahl der
abgekühlten „Knödel" zu. Allgemeine Heiterkeit gab es, als Halbwüchsige
die abgelöschten Kanonenkugeln zu den bayerischen Geschützen auf den Wällen
schafften, und die Kanoniere die österreichischen Geschosse unter Blitz und Donner
an die Absender zurücksandten.
Hunderte glühender Eisenkugeln schlugen in die Stadt, keine
Feuersbrunst entstand. Durchlöcherte Dächer, angeschlagene Hauswände aber gab
es in jeder Gasse. Arg ruiniert war das Dach des Schlosses. Schlimm sah es beim
Schwanenwirt und beim Türkenwirt aus. Besonders häufig war das Jesuitengebäude
getroffen worden. Fast unbeschädigt hatte dagegen die davor liegende
Stadtmauer den Tag überstanden. Die leichten Geschütze konnten von St.
Katharina her nichts ausrichten. Einige Sturmkolonnen näherten sich zwar der
Georgsschanze, die Artillerie der Amberger zwang sie zum Rückzug.
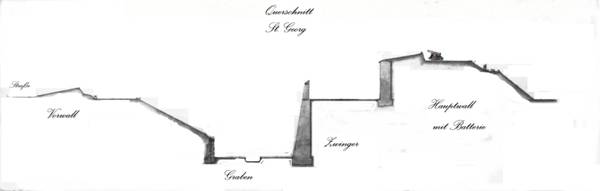
Die Batterie auf dem Georgsfriedhof ist noch weitgehend
erhalten.
Es dämmerte stark, als die letzten Feuerkugeln wie böse
Sterne in die Stadt stürzten. Dann brachten die österreichischen Kanoniere die
Geschütze zurück in das Hauptlager. Dort war man sehr unzufrieden mit den
Ergebnissen dieses Tages.
Nochmals bot Thüngen eine ehrenvolle Kapitulation mit freiem
Abzug an: Erneute Ablehnung.

Wache in der Stadt
Bei „erschröcklicher Winterskälte" wurden neben den
Soldaten der Garnison auch die bewaffneten Bürger und sogar die knapp
16jährigen Studenten des Jesuitengymnasiums „mit Leibs- und Lebensgefahr"
als Wachen eingeteilt. Pechpfannen hatten nachts in der Stadt die Straßen zu
erhellen.
In Amberg wurden die Fenster rasch dunkel, höher aber
loderten rings um die Stadt die Lagerfeuer, und über Stadt und Land funkelten
in seltener Klarheit die Sterne einer kalten Winternacht.
Am Morgen des 11. Januars sahen die Bürger, dass alle
Geschütze vor der östlichen Stadt zusammengezogen waren. Sollte hier wie 1703
Bresche geschossen werden?
Dann meldete der Türmer, dass im Lager draußen Sturmpfeiler
zusammengenagelt wurden und Fuhrwerke voll Leitern aus den Dörfern eintrafen.
Leitersturm also! Das hieß Kampf Mann gegen Mann und - falls dem Ansturm nicht
standgehalten wurde - Plünderung, Brand und Tod in der Stadt. Angst und
Mutlosigkeit erfasste viele Amberger. Das Wasser im Stadtgraben war gefroren
und war kein Hindernis mehr.
D'Envie aber vertraute auf die Festigkeit und Höhe der
Stadtmauer und die Stärke der eigenen Artillerie, Bürger und Studenten ließ er
auf die Wehrgänge rücken, die Soldaten sammelten sich als Eingreifgruppen von
je 200 Mann bei den Toren. Bei angespannter Aufmerksamkeit verging der Tag.
Schlimmer wurde die Nacht. Unruhig flackerten draußen die
vielen Lagerfeuer. In der Stadt qualmten auf Befehl d'Envies allüberall
Pechpfannen und jagten unheimliche Schatten durch die Gassen. Angestrengt
starrten und lauschten die Posten in die Finsternis. Laut ging’s zu vor den
Schanzen. Eine Frau verlor schließlich die Nerven. Schreiend flüchtete sie
durch die Stadt und löste beinahe eine allgemeine Panik aus.
Die Morgensonne des 12. Januar beendete alle Ängste der
Nacht und alle Besorgnisse. Sie beschien einen menschenleeren Berghang. Jetzt
wusste man die Ursache der nächtlichen Unruhe vor den Schanzen. Gegen Mitternacht
waren die österreichischen Einheiten abgerückt. Die Franziskaner vom
Bergkloster konnten davon berichten.
Erst kaum fassbar, dann aber um so erfreulicher fanden die
Bürger diesen Wechsel. War’s ein Wunder? Wer hatte das bewirkt? War’s die
eigene Tapferkeit? In gehobener Stimmung befolgte man die Befehle d'Envies und
verbrannte im ehemaligen Lager alles, was brennbar war, vom Sturmpfeiler bis
zum Strohbüschel. Dann hieb man alles nieder, was die freie Sicht behindern
konnte: Bäume, Hecken und Zäune, Hopfengärten und Gartenhäuser. Keine Deckung,
kein Unterkommen, ja nicht einmal Brennholz sollten die Soldaten
Maria-Theresias bei einer Rückkehr vorfinden. Viel Holz brachte man in die
Stadt, denn bitter kalt war es. Kaum vorstellbar, dass Kroaten und Panduren
noch mal in Eis und Schnee vor Amberg biwakieren würden.
Während die Amberger alle Ängste aus der Erinnerung an die
kurze Belagerung verdrängten und sich als kühne Verteidiger fühlten, zog von
Thüngen mit 6000 Mann und einigen Geschützen gen Neumarkt. 1600 Franzosen
zählte die dortige Garnison. Würden sich die anderen Truppen des kaiserlichen
Landesherrn, die schon im Altmühltal standen, mit der Neumarkter Streitmacht
vereinen, dann war eine weitere Belagerung Ambergs unmöglich, dann konnte der
Blockadering um Ingolstadt nicht durchbrochen werden.
Schnee und Frost erschwerten den Marsch der kgl. ungarischen
Truppen. Am 12. Januar erreichte man gerade Kastl. 6000 Soldaten drängten in
die Häuser des Marktes. Am 13. war man in Pilsach, ein noch beengteres Nachtquartier.
Dennoch besser als das Schneefeld vor Amberg.
Im festen Neumarkt dachte man an keine Gefahr. Die
Garnisonen in Dietfurt und Beilngries fühlten sich sicher. Man wartete auf
besseres Wetter und nahm an, Thüngen verhielte sich ebenso.
Doch am 14. Januar stand Thüngen vor Neumarkt und forderte
die Übergabe der Stadt. Man lehnte ab. In der Nacht zum 15. brachten die
Angreifer in aller Stille ihre Kanonen in das Kapuzinerkloster, kaum einen
Steinwurf vor der Stadtmauer. Am frühen Morgen begann aus geschützter Stellung
und ganz kurzer Entfernung das Brescheschießen. Gegen Mittag klaffte eine breite
Bresche in der Mauer. Jetzt kapitulierte die Garnison. 1600 Soldaten zogen in
Gefangenschaft, mehrere Fahnen, über 400 Pferde und reichlich Vorräte an Waffen
und Verpflegung fielen in die Hände der kgl. ungarischen Armee.
Am gleichen Tag mussten französische Truppen Hemau den
Soldaten Bärnklaus übergeben. Der Rückzug der Kaiserlichen und Franzosen über
die Donau war die Folge dieser beiden Ereignisse. Der Weg nach Ingolstadt war
frei für Bärnklaus Reiter.
Amberg war nun neben der Veste Rothenberg der einzige
Waffenplatz des Kaisers und seiner Verbündeten in Nordbayern, eine Insel
inmitten des Habsburger Machtbereichs, kaum erreichbar für
bayerisch/französische Verbände und völlig auf sich gestellt.
Die Regierung in Amberg und der Stadtkommandant erfuhren
rasch von dieser entscheidenden Änderung der Lage, verheimlichten sie aber der
Bürgerschaft und der Garnison.

Ungarische Wachposten
Sehr zu leiden hatten bei der grimmigen Winterkälte die
Soldaten der kgl. ungarischen Armee. Viele mussten die Nächte unter freiem
Himmel verbringen. Um mächtige Lagerfeuer, die Hopfenstangen, Obstbäume und
Zäune verzehrten, lagerten die Wachen.
Die Untertanen holzten also weiterhin voll Siegeszuversicht
ihre eigenen Obstgärten ab und ruinierten befehlsgemäß ihre Gartenhäuser.
Begierig wartete man auf Erfolgsmeldungen.
Thüngens Korps marschierte inzwischen bei klirrender Kälte
über Kastl nach Sulzbach. Dort ergänzte man die Munitionsvorräte. Schweres
Belagerungsgeschütz fand Thüngen nicht vor, er musste sich mit einigen Mörsern
begnügen.
Allgemeine Bestürzung in Amberg, als am 19. Januar völlig
unerwartet die gefürchteten Husaren die Stadt blockierten. D'Envie hätte nun
doch gerne gewusst, ob die Stadt weiterhin verteidigt werden solle. Einer
seiner Offiziere, Oberleutnant von Bernzoll, erbot sich, aus München neue
Anweisungen einzuholen. Am 20. Januar, kurz bevor die Stadt ganz von der
Außenwelt abgeschnitten war, brach er als Bauer verkleidet, zu seinem gefährlichen
Botengang auf.
Am 21. begannen die Belagerer zwischen der Ruine der
Ziegelei und dem Kellerweg, kaum 100 Schritte vor der Stadtmauer, ein mühsames
Graben und Pickeln. Steinhart der Boden! Der Wall erreichte keine ausreichende
Höhe, auf einen Deckungsgraben musste man verzichten. Bis tief in die Nacht
schufteten die Soldaten. Die Schanze blieb auch am 22. unvollendet. Schanzkörbe
wurden als Notbehelf aufgestellt, doch womit sollte man sie füllen? Tief
durchgefroren war das Erdreich. Mit einigen Fuhren Mist aus den nahen Dörfern
behalf man sich schließlich.
In der Stadt herrschte Wachsamkeit. Die Schanzarbeiten der
Belagerer störte man durch überraschende Feuerüberfälle. Was konnte man noch
tun? Ein Befehl d'Envies ließ Glockengeläute, Uhrenschlag und Nachtwächter verstummen.
Die Zeit stand trotzdem nicht still.
Am 23. Januar morgens schafften die österreichischen Kanoniere
sieben Geschütze in die Schanze und begannen mit der Beschießung der
Stadtmauer. Gleichzeitig schleuderten andere Kanonen glühende Kugeln vorwiegend
in die untere Stadt links der Vils. Mörser verschossen Bomben von rund 70
Pfund.
Mit den glühenden Kugeln wussten die Bürger umzugehen. Die
Bomben aber, diese mit Pulver gefüllten Hohlkugeln, brachten Verwirrung. Sie
durchschlugen nicht nur Dächer und Zimmerdecken, sie zerfetzten bei ihrer Explosion
Dächer, Riegelwände, Fenster und Zimmereinrichtungen. Frauen und Kinder suchten
angsterfüllt in den massiven Gewölben der Klöster Schutz. - Glücklicherweise
sah man die Bomben beim Heranfliegen und konnte in Deckung gehen.
Wieder hatte man Erfolg, nur einige Häuschen beim Türkenwirt
brannten aus. Beschädigte Häuser gab es freilich in jedem Stadtviertel. Auf der
Wart war fast jedes Gebäude mehrmals getroffen worden. Den Schwanenwirt hatte
es auch diesmal erwischt.
Über 1000 Bomben und Kugeln schlugen in die Stadt, doch
hätte es keine Verluste gegeben, wäre nicht ein geltungsbedürftiger Soldat bei
einer Bombe stehen geblieben, um die Explosion abzuwarten.
Verlustreicher war der Tag für die Belagerer. Die Amberger
hatten Geschütz- und Gewehrfeuer besonders auf die vorgeschobene, ungenügend
ausgebaute Geschützstellung konzentriert. Im Laufe des Vormittags fielen dort
zwei der Geschütze aus. Unter Lebensgefahr mussten Sanitäter 30 tote oder verwunderte
Kanoniere aus der Schanze holen. Gegen 12 Uhr stellten die restlichen fünf
Geschütze das Feuer ein. Es fehlte an Artilleristen. - Die Stadtmauer wies kaum
Schäden auf.
Nein, Amberg war nicht wie Neumarkt mit leichter
Feldartillerie zur Übergabe zu zwingen. Zwar hatte Thüngen schwere Geschütze in
Passau angefordert, und bis Schwarzenfeld waren sie schon gebracht worden. Wegen
der Schneeverwehungen war es jedoch völlig ungewiss, wann sie vor Amberg
eingesetzt werden konnten. Durfte man die Belagerung fortsetzen? Durfte man die
Soldaten länger in Eis und Schnee kampieren lassen? Die Kälte hatte bereits
mehr Todesopfer gefordert als die Kugeln der Amberger. - Die Lage war bedenklich.
Die Lage wurde kritisch. Um 4 Uhr senkte sich die Zugbrücke
des Ziegeltors, und 200 Freiwillige, und zwar Dragoner und Grenadiere, Bürger
und Studenten, erstürmten die österreichische Geschützstellung. Die schwache
Besatzung floh. Alle Geschütze waren schon vernagelt und unbrauchbar, als man
im Lager endlich Alarm schlug. Trotz heftiger Angriffe von Panduren und Kroaten
gelang auch der Rückzug, denn die Amberger Geschütze beherrschten das Feld. Nur
sieben der Freiwilligen waren verwundet worden.
Jubel in der Stadt! Wann hatte die kaiserlich-bayerische
Armee in diesem unglückseligen Krieg ähnliche Erfolge errungen? Grund zum
Trinken, Grund zum Feiern! Noch im Laufe des Nachmittags entstand ein langes
Gedicht vom erfolgreichen „Lerchenfang" der „heldenmütigen bayerischen
Löwen".
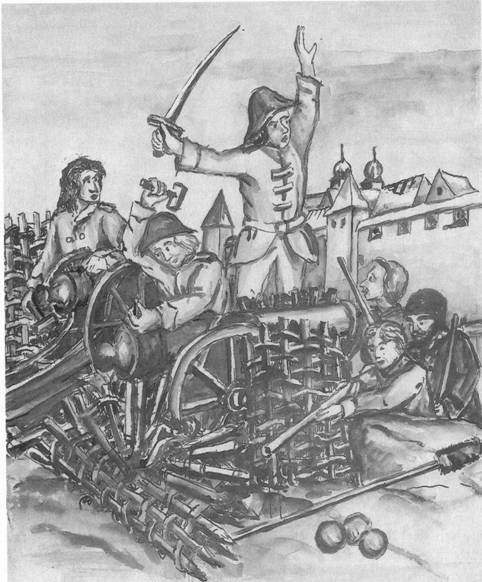
Am Nachmittag des 23.1.1745 überfielen die Amberger
die österreichische Geschützstellung und vernagelten fünf Kanonen.
Ab 6 Uhr abends verschossen die Belagerer ihre restlichen
Bomben und verdarben bis 2 Uhr nachts die Nachtruhe bzw. die Siegesfeier der
Bürger. Während dieses Spektakels ließ Thüngen die unbrauchbaren Geschütze nach
Ammersricht schaffen.
Gegen Morgen wurden auch die Mörser abtransportiert.
Gleichzeitig rückten die ersten Einheiten der kgl. ungarischen Armee in bessere
Quartiere ab. In Amberg bemerkte dies niemand.
Thüngen erachtete ein weiteres Ausharren vor den Wällen
Ambergs als sinnlos. Eine Blockade der Zufahrtsstraßen musste vorerst genügen.
Ausschlaggebend für den Abbruch der Belagerung war neben den Misserfolgen des
23. eine Nachricht, die dem österreichischen General am Abend dieses schlimmen
Tages von einer Eilstaffette ins Bergkloster gebracht worden war. Kaiser
Karl-Albrecht war tot. Das Ableben dieses Wittelsbachers, dessen Ehrgeiz den
Krieg entfacht hatte, konnte zu Friedensverhandlungen führen, und die wollte
man in anständigen Unterkünften abwarten.
Am 24. ließ Thüngen durch zwei Franziskaner des Bergklosters
d'Envie von diesem wichtigen Todesfall unterrichten. Misstraute der
Stadtkommandant dieser Botschaft? Er behielt diese Mitteilung für sich und ließ
durch Wachen verhindern, dass die Patres mit Bürgern sprechen konnten. Bürger
und Soldaten sollten diese schlimme Botschaft nicht erfahren.
Am Nachmittag befahl der Stadtkommandant einen Ausfall gegen
den Kellerweg und ließ ein Gartenhaus am Berghang abbrennen. Seltsam! Einige
Rotmäntel beobachteten zwar diese Aktion, aber Widerstand leistete niemand.
Wieder fühlten sich die Amberger als Sieger, denn ohne Verluste konnten sie in
die Stadt zurückkehren. Am Abend näherten sich Soldaten des Regiments Kolowrat
den Toren der östlichen Stadt. Wieder blitzte und donnerte es von den Wällen
Ambergs. Wieder ein Erfolg, die Soldaten Maria Theresias, der Königin von
Ungarn, zogen sich eiligst zurück.
Die kriegerische Begeisterung in der Stadt schwoll nach den
Erfolgen dieser Tage mächtig an. In den Wirtshäusern hatten die Strategen des
Biertischs bereits die Oberpfalz befreit. Generalausfall! Sturm auf das
gegnerische Lager! Offene Feldschlacht mit den kgl. ungarischen Truppen! So
überboten sich die kühn gewordenen Bürger. Alles wollte man wagen und einsetzen
für den Kaiser und Landesherrn. - Der aber lag prunkvoll aufgebahrt in der
Münchner Residenz, allen irdischen Nöten und Wünschen entrückt. - Vor Ambergs
Wällen lagen dürftig mit Stroh und Kiefernzweigen bedeckt unter hohem Schnee
die Opfer der letzten Tage. Ein ordentliches Begräbnis war im gefrorenen Boden
nicht möglich.
Rückblickend waren Anstrengungen und Opfer beider Seiten
während dieser zweiten Belagerung tragische Nutzlosigkeiten. Noch bevor General
von Thüngen mit dem Brescheschießen und „Feuereinwerfen" am 23. 1. beginnen
ließ, war ihm Amberg bereits vom bayerischen Oberkommando überlassen worden.
Ehe d'Envie durch den kühnen Ausfall am 23.1.1745 die Belagerer so schwächte,
dass sie nicht mehr mit einer raschen Eroberung Ambergs rechnen konnten, hatte
man in München für ihn und seine Soldaten den Marschbefehl nach Niederbayern
ausgefertigt.
Oberleutnant von Bernzoll kam am Morgen des 25. Januars mit
den angeführten Anweisungen aus München zurück. Eine unglaubliche Leistung übrigens.
Einen Teil der Gesamtstrecke hatte er zu Fuß unter ständiger Gefahr der
Entdeckung durch österreichische Streifen bewältigen müssen. Erst zwischen
Donau und der Residenzstadt hatte er in raschem Wechsel Armeepferde benutzen
können. Bei schneidender Kälte und tiefem Schnee aber war das Reiten kein Vergnügen.
Vom Tod des Kaisers hatte d'Envie jetzt volle Gewissheit,
von ihm selbst aber erwartete man, dass er die Amberger Garnison der
bayerisch-französischen Armee in Niederbayern zuführe.
Es wurde ein aufregender Tag. Um 5 Uhr nachmittags
Regierungskonferenz; bedenkliche Mienen bei den Herren Räten, als sie die
neueste Lage erfuhren. Um 6 Uhr Appell für die Soldaten auf dem Marktplatz.
Marschbereit! Die Soldatenfrauen hatten mit ihren Kindern und ihrem Gepäck in
den Quartieren zu bleiben. Dann Appell für die bewaffneten Bürger. Frohgemut
und wohlbewaffnet fanden diese sich ein. Es war so weit! Generalausfall! Vertreibung
der Belagerer! - Dachten sie.
Erschüttert waren Bürger und Soldaten, als ihnen der Tod des
Kaisers mitgeteilt wurde. Entsetzt waren alle, als der Befehl zum Abmarsch der
Garnison kam. In Eile wurde das Notwendigste von den Soldaten verpackt. Alle
Kanonen bis auf drei, die man mitnehmen wollte, ließ d’Envie vernageln. – Mit
bangen Erwartungen übernahmen die Bürger und Studenten noch mal die Wachdienste.
Mitternacht! - Durchs Wingershofertor rückte die Garnison
aus, zog zum Neutor und weiter nach St. Katharina. Voran die Dragoner, dann die
Grenadiere. Die Mitte der Kolonne bildeten drei Kanonen, mehrere Bagagewägen
und die Kutsche des Generals. Grenadiere folgten, Dragoner beschlossen den Zug.
Kaum ein Laut. Man hatte vorsorglich sogar die Räder der Kanonen und Fahrzeuge
mit Lumpen umwickelt.
Bald hatte man Eglsee erreicht, umstellt und 20
österreichische Kürassiere aus den Schlafstuben geholt. Ähnlich verfuhr man bei
allen Orten an der Marschroute. Die Zahl der Gefangenen wuchs und wuchs.
Sehr spät erfuhr Thüngen vom Ausmarsch der Garnison.
Alarmierte Husaren konnten bei Hersbruck 25 kaiserliche Dragoner der Nachhut
gefangen nehmen. D'Envie aber erreichte mit seiner Truppe und den Gefangenen -
von 300 berichtet Wiltmeister - am Vormittag des 26. Januars die bayerische
Festung Rothenberg.
Ungefähr zur gleichen Zeit verlangten die Panduren und die
Kroaten die Öffnung der Tore Ambergs. 400 Mann besetzten die Stadt, ließen sich
trefflich verpflegen, bezogen die Quartiere und waren vorerst mit 900 fl
zufrieden. 69 kranke Franzosen wurden Kriegsgefangene. Amberg stand wieder
unter österreichischer Verwaltung.
Die Bürger Ambergs, die wochenlang im ständigen Wechsel
zwischen Furcht, Hoffnung, Angst, Entschlossenheit und Begeisterung ihre
Pflicht getan hatten, fügten sich schicksalsergeben den neuen Verhältnissen,
ja, sie empfanden es als Erleichterung nicht mehr im Brennpunkt der Geschichte
stehen zu müssen.
Den Österreichischen Erbfolgekrieg hat man in Bayern nahezu
vergessen. Fruchtlose Bemühungen, verlorene Schlachten verzeichnet man nicht
gerne in vaterländischen Geschichtsbüchern. Amberg hat in diesen schlimmen
Jahren noch mal seine militärische Bedeutung beweisen können, hat aber neben
der geschilderten Belagerung noch viel Schweres miterleben und erdulden müssen.
Da mussten zu Kriegsbeginn durch Scharwerker die Schanzen
erweitert werden. Viele Bürger verloren dabei ihre Gärten. Dann hatte man für
die gegen Böhmen ziehenden französischen Heere Magazine und Feldbäckereien
anzulegen. Ab 1741 lagerten immer wieder starke französische Verbände, einmal
sogar 30.000 Mann, in und um Amberg. Im Armeelazarett im Jesuitenkolleg das die
Padres hatten räumen müssen, starben 1742 gegen 12.000 verwundete Franzosen als
Opfer von Seuchen. Auch 400 Bürger wurden hinweggerafft. - Die Massengräber an
der Köferinger Straße sind heute völlig vergessen.
Am 15. Juni 1743 überließ Stadtkommandant Oberst Vallade
Amberg kampflos der kgl. ungarischen Armee. 1744 lagerten längere Zeit 20.000
bis 40.000 Soldaten der Königin Maria Theresia am Galgenberg.
Ungemein drückend waren die Forderungen der Militärs. Die
österreichische Verwaltung hat gegen 100.000 fl von der Stadt erpresst, die
verbündeten Franzosen verlangten wahrscheinlich noch mehr.
Nun zu den Hauptakteuren im blutigen Drama „Amberg
1745". - Es gelang d'Envie, seine Soldaten über Nürnberg und Donauwörth
nach Niederbayern zu bringen. Auch Max-Josef III., der kurfürstliche Nachfolger
Karl Albrechts, hoffte, durch einen Angriff auf Wien die Vormacht Bayerns zu
besiegeln. Doch auch ihm kam die kgl. ungarische Armee am 21. März zuvor, sie
überrannte die verstreut stehenden bayerisch / französischen Verbände, siegte
bei Paffenhofen und besetzte in vier Wochen Bayern. Im Frieden von Füssen gab
Bayern seine Großmachtpläne endgültig auf.
General von Thüngen konnte seinen erschöpften Soldaten rund
drei Monate Ruhe in der Oberpfalz gönnen. Am 5. Mai führte er sein Korps nach
Schlesien zum Kampf gegen die Preußen. Am 5. Juni 1745 fiel er in der Schlacht
bei Hohenfriedberg.
Benutzte Quellen: Oberpfälzische Chronik von Johann Kaspar
von Wiltmaister, Sulzbach 1783. -„Der Österreichische Erbfolgekrieg",
herausgegeben vom k. u. k. Kriegsarchiv, Band 5, 6, 8, Wien 1901/02. - Tagebuch
des Franziskanerklosters Amberg von 1744/45, in Abschrift im Kloster auf dem
Mariahilfberg. - „Wiener Diarium" 1744/45 - Zeitungsband, Hofbibliothek
Wien. - „Krieg und Heerwesen", „Amberger Büchl" Nr. 2 von Generalmajor
Anton Dollacker, Amberg 1920.
Professor in Freising
Was geht im würdigen Festsaal des Gymnasiums vor? Hat man
ihn in eine Werkstätte verwandelt? Da hämmern einige Gymnasiasten Latten zusammen,
andere sägen Balken zurecht, wieder andere schwingen mit viel Eifer Malerpinsel
über gespannte Leinwandflächen. In einer Ecke scheinen sich Schneider
niedergelassen zu haben, und einige angehende Gelehrte hantieren mit Rollen und
Zahnrädern wie Mechanikerlehrlinge. Nun? Pater Desing bereitet mit seinen
Schülern ein Theaterspiel für die Faschingszeit vor.

Im Nebenraum sitzt er inmitten der Spieler und probt.
Zwischen Unterrichtszeit und Chorgebet hat er in klassischem Latein eine
Komödie geschrieben. Nun lässt er die Spieler ihre Rollen vorlesen, er
verbessert die Aussprache und Betonung, übt Gesten ein und übernimmt
gelegentlich auch selbst eine Theaterrolle. Dann lässt er die Buben die Texte
lernen und eilt in den Saal.
Zufrieden stellt er fest, dass die Maler und Schneider keine
Probleme haben. Schreiner, Zimmerleute und Mechaniker jedoch schauen ziemlich
ratlos drein. In dieser Komödie soll ein Geist über die Bühne schweben und dazu
braucht man ein Flugwerk. Pater Desing hat seinen Schülern zwar einen genauen
Plan gezeichnet, aber den begreifen die Herren Studenten nicht recht. Da ruft
der Herr Professor seine Handwerker zusammen. Er erklärt ihnen an dieser
Theatermaschine die Wirkungsweise des Flaschenzugs, führt vor, wie die
Zahnradübersetzung funktioniert, und zeigt, wie das Gerüst so aufgebaut werden
kann, dass der Geist auch wirklich nicht abstürzt. Er doziert erst lateinisch,
und die Buben haben dann in ihrer Muttersprache seine Ausführungen zu
wiederholen. Dann wechseln sie um. Schließlich kann die Arbeit am Gerüst und
Flugwerk ohne ihn fortgesetzt werden.
Rasch zeichnet Desing für seine Schneider noch einige
Entwürfe für Theaterkostüme und greift selbst zu Nadel und Schere. Und siehe,
seine Nähte sind ebenso vorbildlich wie seine lateinischen Sätze! Recht
zufrieden ist er mit seinen Schülern, und diese finden ihren Unterricht auch
überaus angenehm.
Halt, er muss ja noch einen Gedenkstein auf eine Kulisse
malen. Mit raschen Strichen entstehen sechs Stufen und darüber die Steinsäule.
Mit dunkler Farbe setzt er die Schatten ein und nach kurzer Zeit steht das
Denkmal in vollendeter räumlicher Ansicht auf der Kulisse. Natürlich hat der
malende Lateinprofessor nichts dagegen, dass immer mehr seiner Schüler ihm zuschauen.
In lateinischer Sprache erklärt er ihnen zwischendurch die Grundsätze der
Perspektive.
Doch nun muss er zu seinen Musikanten. Ob sie mit den
Musikstücken, die er eigens für diese Komödie komponiert hat, zurecht kommen?
Während im Saal weiterhin an der Bühne gearbeitet wird und die Schauspieler
sich ihre Rollen einprägen, ergreift Desing den Taktstock und lässt sein
kleines Orchester geigen, flöten, trompeten und pauken.
Dann wird es Zeit, wieder nach den Handwerkern zu schauen.
Als Desing in den Saal tritt, empfängt ihn betretenes Schweigen. Der erfahrene
Lehrer erfährt rasch, was geschehen ist. Die Ursache der Verlegenheit ist
übrigens gut zu sehen. Ein Schüler hat Professor Desing gesuchte. Eilig rannte
er über die Bühne und wollte ausgerechnet über die Treppe zum Denkmal
hinaufsteigen. Nun klafft in der Kulisse ein großer Riss. Zur Verwunderung der
Schüler lacht Desing herzlich. Er freut sich, dass ihm die räumliche Darstellung
der Treppe so gut gelungen ist. In griechischer Sprache erzählt er den Buben
vom Maler Zeuxis, der Weintrauben so naturgetreu malen konnte, dass Vögel sie
wegpicken wollten.
Die Glocke verkündet das Unterrichtsende. Die Schüler
bedauern, dass dieser Schultag schon wieder zu Ende ist. Pater Desing aber
sitzt kurze Zeit später in seinem Zimmer, um weiter an einem Lehrbuch für
Geschichte zu arbeiten.
Um 1740 ist Salzburg die berühmte Universität der
bayerisch-österreichischen Benediktiner. Über 100 Klöster schicken ihre Leute
zum Studium dorthin. Der berühmteste Professor der hohen Schule aber ist Pater
Anselm Desing aus Amberg. Für Vorlesungen über lateinische Dichtkunst hat man
ihn von seinem Konvent Ensdorf erbeten, dann hat er zusätzlich Mathematik
übernommen, schließlich noch Geschichte und dann sogar Ethik. Nebenbei wurde er
selbst Doktor der Philosophie. Außerdem schreibt und schreibt er fast ununterbrochen
Bücher für den Unterricht in Algebra, Geometrie und Anatomie. Das sind Fachgebiete,
die bislang in Salzburg wenig Gewicht hatten. Seine Vorlesungen sind gut
besucht, seine Bücher finden Anklang, und allgemein ist sein Rat begehrt und
geschätzt.
Eben sitzen zwei Pater des berühmten Klosters Kremsmünster
bei ihm. Die Abtei will eine Akademie aufbauen. Desing soll Ratschläge für
Gliederung, Leitung und Lehrpläne dieser Einrichtung geben. Auf Naturwissenschaften
soll er besonderen Wert legen.
Bewundernd blicken die beiden Besucher auf die vielen
physikalischen Geräte, die ihnen meist fremd sind. Interessant finden sie die
verschiedenen Weltkugeln, an denen Professor Desing ihnen die Entstehung der Jahreszeiten
erklärt. Erstaunt schauen sie drein, als sie erfahren, dass Desing diesen
Globus selbst entworfen und auch selbst gebaut hat. Schmunzelnd berichtet er,
dass er schon in Freising einen riesigen Globus geschaffen hat. Leider musste
er ihn dort lassen, weil er nicht durch die Tür gebracht werden konnte.
Für Geschichte und Erdkunde empfiehlt Desing gründliche
Arbeit an Karten. Er zeigt seine Geschichtsmappen, selbst entworfen, gestochen
und ausgemalt. Feldzüge, Schlachtorte, Festungen, Straßen, Grenzveränderungen,
Herrschafts- und Verwaltungsbereiche zeigen sie.
Er hat aber noch eine besondere Überraschung. Da steht ein
schwarzes Kästchen. Er entzündet einige Öllämpchen in dessen Innern und zieht
die Vorhänge zu. Geheimnisvoll dämmrig ist der Raum. Dann einige Handgriffe, an
der weißen Zimmerwand ist groß und deutlich ein Plan des Salzburger Landes zu
sehen. Verdutzt sehen sich die Pater aus Kremsmünster an. Die Karte
verschwindet, ein Plan der Stadt Wien ist zu sehen. Weitere Karten folgen und
zuletzt lässt dieser Zaubermeister sogar Blumen und Früchte erscheinen.
Zwar erklärt Desing seinen Gästen ausführlich, wie er dieses
Bildgerät gebaut hat, aber so ganz begreifen die Pater diese Hexerei nicht.
1746 ist Desing eifrig mit der Neuordnung des Passauer
Archivs beschäftigt. Hunderte von Urkunden hat er schon abgeschrieben. Er ist
glücklich, sich endlich ohne andere Verpflichtungen den historischen
Forschungen widmen zu können. Eigentlich lenkt ihn nur der tägliche
Briefverkehr etwas ab.
Eben öffnet er einen Brief aus Kremsmünster. Erfreulich, was
sich dort tut. Eine große wissenschaftliche Sammlung hat man geschaffen, und
für diese will man ein eigenes Gebäude mit Arbeits- und Ausstellungsräumen
bauen. Dann hat Abt Alexander vor, eine Sternwarte auf dem Dach errichten zu lassen.
„Eine gute Idee!“, murmelt Desing, wendet das Blatt, liest weiter und schüttelt
ungläubig den Kopf. Da steht es eindeutig: „... bitten wir Euch, die Planung
und Bauleitung für diesen Turm der Wissenschaften zu übernehmen und ganz nach
Eurer bewährten Einsicht zu verfahren.“
So wird Desing zum Architekten, Statiker und
Bausachverständigen. Er studiert bauwissenschaftliche Bücher, befragt
Maurermeister und Zimmerleute, und es entstehen Entwürfe und Pläne. Schon nach
kurzer Zeit kann er die ersten Bauskizzen vorlegen. Er fertigt sogar ein
maßstabgetreues Holzmodell der Sternwarte. 1749 kann der Grundstein für den Bau
gelegt werden.
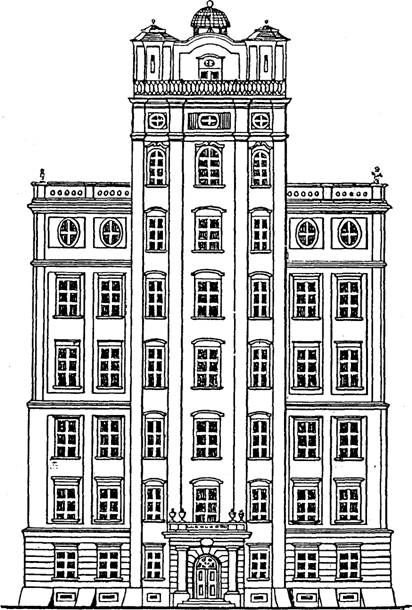
Die Sternwarte von Kremsmünster. Das erste Hochhaus
Europas, ein Bauwerk Anselm Desings.
Doch nun gibt's Schwierigkeiten. Manche Konventualen meinen,
dass dieser Bau über die finanziellen Kräfte des Klosters gehe, andere sprechen
gar von einem babylonischen Beginnen, von einer sündhaften Überschätzung der
Wissenschaften. Tatsächlich zwingt Geldmangel bereits 1750 zur Einstellung der
Arbeiten am Turm.
Es kommt noch schlimmer. Als man die Arbeiten wieder
aufnimmt, glaubt der Maurermeister, am Material und an der Mauerstärke sparen
zu müssen. Er weicht von Desings Planungen ab. Da stürzt im Mai 1755 das weit
fortgeschrittene Bauwerk teilweise ein. Von einer Fügung des Himmels, von einem
Gottesurteil sprechen die Kritiker, obwohl der Maurermeister freimütig sein
Verschulden eingesteht. Mehr als Abt Alexander sind dessen Stiftsuntertanen von
diesem Unglück betroffen, hat doch der Bau vielen Verdienst und Arbeit gegeben.
Pater Desing überlegt sofort, wie die Schäden auf einfachste
und sicherste Art zu beheben seien. Die Finanzierung wird neu durchgerechnet.
Gemeinsam mit dem Abt kommt er zu dem Ergebnis, dass die Fortsetzung des
Turmbaues das Kloster weniger hart belasten würde, als die Einstellung der
Arbeiten den vielen Handwerkern und Hilfskräften schaden muss. Nicht nur der
Wissenschaft soll der Bau dienen, auch den armen Bürgern und Bauern des Stiftes
soll er Arbeit und Brot geben.
Und man baut weiter nach den Vorschlägen Desings. Ohne
weitere Zwischenfälle wird 1758 die große Sternwarte vollendet. 28 m mal 18 m
misst seine Grundfläche, und 60 m hoch ist der gewaltige Block. Das erste und
lange Zeit auch das größte Hochhaus Europas, den großartigsten und
zweckmäßigsten Ausstellungsbau der je für eine Schule errichtet wurde, und die
eindruckvollste Sternwarte, die sich bislang ein Kloster erbaut hat, dieses
stolze Wahrzeichen von Kremsmünster schuf der Amberger Anselm Desing, ein
einfallsreicher und kluger Baumeister.
Am 15. März 1699 wurde der spätere Abt von Ensdorf, Anselm
Desing, in Amberg geboren. Sein Vater, Regierungsadvokat und Hofrichter, starb
schon 1703. Bei Verwandten wuchs der Bub auf, und besonders sein Onkel Anton
Herdegen, der Pfarrer von Arnbruck, förderte die natürliche Begabung des Buben.
Von 1710 bis 1715 besuchte er das Gymnasium der Jesuiten in Amberg. Dem
damaligen Bildungsziel entsprechend, hat man vorwiegend die lateinische Sprache
gepflegt, während Geschichte und Erdkunde, Mathematik und Physik nahezu
bedeutungslos waren. Doch durch Eigenstudium kam Desing zu einem umfassenden
Wissen in diesen Fächern. Gründlich und erfolgreich beschäftigte er sich mit
Kompositionslehre, Kupferstechen und Malerei. 1717 trat er in das
Benediktinerkloster Ensdorf ein.
Seit 1761 war Desing Abt des Klosters Ensdorf. Die Pflege
der Wissenschaft und die Sorge um die Schule waren auch hier seine besonderen
Anliegen. So entstand in Ensdorf die erste Lehrerbildungsanstalt in der oberen
Pfalz. Für seine Untertanen sorgte er besonders im Hungerjahr 1771 in
vorbildlicher Weise. Bis zuletzt schrieb und forschte er. Am 17.12.1772 fand
man ihn tot an seinem Schreibpult, das mit Büchern und Heften bedeckt war, die
Schreibfeder noch fest in der Hand.
Pater Anselm Desing ist in Amberg fast vergessen, obwohl
eine Straße im Dreifaltigkeitsviertel nach ihm benannt ist. Noch heute stellen
seine Urkundensammlungen einen wertvollen Bestand der Münchner Universitätsbibliothek
dar. In Kremsmünster aber kennt jeder den Abt Desing von Amberg. Sein Bild
hängt in seinem Turm, und über hundert seiner Briefe verwahrt man als besondere
Kostbarkeit.
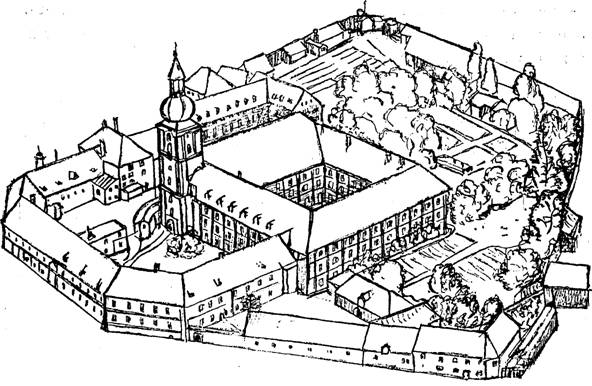
Kloster Ensdorf - letzte Wirkungsstätte und
Begräbnisplatz Anselm Desings.
Am Silvestertag 1770 notiert sich der Rentkammerrat Kaspar
Wiltmaister für seine Chronik gewissenhaft die Ereignisse und Besonderheiten
des zu Ende gehenden Jahres. Tief taucht er die Gänsefeder ins Tintenfass und
schreibt:
Es ist im Frühjahr das Hungerbrünnlein (die Quelle am Fuß
der Lindenallee) so stark gelaufen, dass ein kleines Bächlein neben dem
Raigeringer Fußsteig zum Lindenbrünnlein floss. Hat jedermann eine schlechte
Ernte erwartet, ist aber das Getreide gut geraten. Item hat sich in den
Kellern der Bürgerhäuser und sogar in den Gewölben der Jesuiten oft Wasser
gezeigt, obwohl die Vils gar seicht gewesen.

Weiß niemand, was das bedeuten soll. Es leuchtet auch im
Herbst mehrere Nächte der Himmel im Norden ganz rot und selbst die ältesten
Amberger haben noch nie so ein geheimnisvolles Licht gesehen. Einige Greise haben
gemeint, es sei dies das Nordlicht, von dem man in ihrer Kindheit erzählt hat.
Schlechte Zeiten soll dieser rote Schein anmelden.
Nun, viel hat's nicht gebracht dieses Jahr. Streusand
drüber! - Über die nächste Seite malt er groß 1771.
Das neue Jahr lässt sich gut an. Im Mai steht das Getreide
hoch im Halm, und man darf mit einer guten Ernte rechnen. Auch Herr Wiltmaister
hat keine Bedenken, als die oberpfälzische Regierung die landesherrlichen Getreidevorräte
verkaufen will. In den nächsten Tagen leeren sich rasch die Schüttböden des
Schmalzkellers, des Wagenhauses und des Zehentstadels.
Dann kommt der Juni. Er beginnt mit Regen und endet mit
Regen. Die trockenen Tage kann man an einer Hand abzählen. Die Felder sind
grundlos, die Halme liegen wie niedergewalzt am Boden. Der Juli ist kaum
besser. Im August faulen die Halme und die Körner keimen in den Ähren. Als
endlich Erntewetter kommt, hat man nichts mehr zu ernten. Die Äcker geben kaum
die Aussaat zurück. „Hab' noch nie einen so schlechten Sommer erlebt“, notiert
Herr Wiltmaister.
Bereits im September steigt der Brotpreis. Die Regierung hat
keine Getreidevorräte und kann nicht helfen. Die Räte überlegen, ob man aus
Böhmen, Schwaben oder Franken Getreide holen soll. Doch diese Überlegungen sind
müßig. Kein Fuhrmann ist bereit, auf den schlechten Straßen Gespann und
Fahrzeug zu ruinieren. Aus Prag kommt zudem die Meldung, dass für das
Königreich Böhmen eine Ausfuhrsperre für Getreide verfügt wurde. Man fürchtet
dort, erhöhte Getreidelieferungen in die Oberpfalz könnten den Brotpreis im Königreich
in die Höhe treiben.
Bei einem Spaziergang sieht Wiltmaister, wie Männer, Frauen
und Kinder auf den Feldern keimende und angefaulte Ähren zusammensuchen. „Die
trocknen wir auf dem Ofen, und zerquetscht kann man die Körner noch gut in der
Suppe essen“, antworten sie ihm, als er wissen will, ob denn die Hühner dieses
Getreide noch mögen. „Was bleibt dann noch für meine Hennen?“, sinniert der
Herr Rat. Das erfährt er daheim rasch. Seine Frau schlachtet eben Hühner und
Gänse, obwohl Martini und Weihnachten noch weit sind. Mit dem bescheidenen
Getreidevorrat kann man kein Geflügel halten. In den Dörfern werden gleichzeitig
Schweine und Rinder geschlachtet und an Fleisch fehlt es nicht.
Der Regierung wird berichtet, dass die Bäcker das Brot schon
um den doppelten Preis verkaufen. Die Bauern geben das Viertel Weizen nicht unter
5 Gulden ab. Die Bäcker mischen Gersten und Hafermehl in den Brotteig, ja, es
gibt sogar Gerstenbrote zu kaufen. Billig aber ist dies auch nicht. Dann kann
der Eselsbeck einige Tage nicht mehr backen, weil ihm das Mehl ausgegangen ist.
Die Bauern haben keine großen Vorräte, Bäcker und Müller müssen bei vielen
Höfen anklopfen, ehe sie Geschäfte machen können. Man weiß allerdings, dass
einige Bauern recht volle Getreideböden haben, aber nichts abgeben, weil ihnen
die hohen Preise zu niedrig sind. Im Dezember zahlt man schon den dreifachen Normalpreis,
also 7 1/2 Gulden für ein Viertel Weizen.
Taglöhner und Bürger ohne eigenen Feldbau hungern bereits.
Wenn um 4 Uhr die Bäcker einheizen, stellen sich Frauen vor den Bäckereien an
und warten. Kommt nach Stunden das frische Brot und wird der Laden geöffnet,
dann beginnt ein Drängen und Quetschen und Stoßen. Es gibt zerrissene Kleider
und Beulen. Doch nur selten reicht das Brot für alle.

Wo gibt es Brot?
Frau Wiltmaister hat einmal bei drei Bäckern vergebens gewartet.
Gelegentlich bringen Bauern und Bäcker bis von Kastl und Vilseck Brotlaibe auf
den Markt und verkaufen ihre Waren zu den in Amberg üblichen hohen Preisen.
Dieses teure Brot wird ihnen beinahe aus den Händen gerissen. Mit stattlichen
Gewinnen können die Brotlieferanten heimgehen.
Wiltmaister ärgert sich über diesen Wucher auf Kosten der
Armen. Arg erbost ist er über einige Bürger und angesehene Herren, die, wie der
Löwenwirt, noch beachtliche Getreidemengen im Lager haben und nichts verkaufen,
sondern auf höhere Preise warten.
Es gefällt dem Herrn Rat nicht, dass er für einen Roggenlaib
von zehn Pfund einen halben Gulden zahlen muss, aber er kann ihn sich kaufen.
Viele Taglöhner aber verdienen gerade das, was sie für ihren Tagesbedarf an
Brot ausgeben müssen.
Mancher Bürger erinnert sich an Erzählungen der Alten, dass
man im großen Krieg Baumrinden zerrieben und unter das Mehl gemischt hat.
Immer häufiger sieht der Herr Rentkammerrat abgekratzte Baumstämme, wenn er auf
den Mariahilfberg geht. Andere suchen Flechten an Bäumen und Steinen. Als Brei
schmecken sie eigenartig säuerlich, doch sie füllen den Magen.
Viele Freunde gewinnen die Kartoffeln. Diese fremden
Pflanzen, die viele Bürger wegen ihrer seltsamen Blüten in ihren Ziergärten
pflegen, hat man bislang bestenfalls an Schweine verfüttert. Jetzt kocht und
röstet man sie und rühmt ihren Wohlgeschmack. Auch Herr Wiltmaister lässt sich
zu einem Kartoffelessen einladen. Daheim erzählt er: „Man kann sie wirklich
essen, doch mich haben sie sehr rasch satt gemacht“, und dabei schneidet er
sich einen großen Kanten Brot ab.
Im März notiert der gewissenhafte Chronist, dass ein Viertel
Weizen zehn Gulden kostet, das ist ein sündhafter Preis. Der Schuster, der sich
um das Schuhwerk der Wiltmaisterschen Familie kümmert, kommt verlegen und
verschämt zum Herrn Rat und bittet ihn um ein Darlehen. Er kann von seinem
Verdienst nicht mehr das nötige Brot für seine Familie kaufen, denn er hat kaum
Arbeit, weil alle für das tägliche Brot sparen müssen. Gerne hilft der Herr
Rat. Wie dem Schuster geht es vielen. Häufig reicht der Taglohn nicht für den Bäcker,
viele haben bereits ihre bescheidenen Ersparnisse angreifen müssen. Der
Löwenwirt freut sich über die hohen Preise und verkauft nichts. „Noch teuerer
muss das Getreide werden“, erklärt er höhnisch.
Die Bauern streuen im Frühjahr ihr sorgsam gehütetes
Saatgetreide aus. Banges Hoffen und innige Gebete begleiten diese Arbeit. In
den Dörfern rings um die Stadt wird das Getreide nun auch knapp. Während in der
Stadt die Polizei den Brotverkauf bei den Bäckern überwachen muss, um Schlägereien
zu verhindern, müssen die Bauern bei den Backöfen Wache halten, sobald die
Laibe eingeschossen sind. Man hat es ja erlebt, dass Unbekannte die Backöfen
ausgeräumt hatten, ehe die Backzeit abgelaufen war.
Leute wie den Löwenwirt gibt es noch mehr. Ein Lengenfelder
Bauer hat bisher jeden Bäcker und Melber weggeschickt. „Ihr zahlt mir in vier
Wochen noch mehr, und von meinen Körnern läuft keines weg. Hab oft für viel Weizen
nur wenig Geld bekommen, jetzt will ich mit wenig Weizen viel verdienen.“ Der
Kochbauer von Gailoh hat die teuere Gottesgabe gar in Fässern und Kisten
versperrt. Der Geizkragen gönnt sich selbst kaum Brot, denn in seiner
Vorstellung verwandeln sich die Körner alle in Goldstücke.
Im Mai bieten Bäcker und Melber 15 Gulden für das Viertel
Weizen. Gott sei Dank, wachsen reichlich Pilze. „Viel Schwammer, viel Jammer!“
klagen die Leute, aber ohne die Schwämme wäre der Jammer noch größer. Das Wachstum
der Feldfrüchte begleiten Bittandachten und Flurumgänge, und die Vaterunserbitte
ums „tägliche Brot“ wird besonders innig gebetet.
Aufgebracht ist man über jene, die sich noch immer nicht von
ihren Vorräten trennen wollen. Da empfindet man es als gerechte Strafe, dass im
Hof des geizigen Lengenloher Bauern Feuer ausbricht und das Anwesen vernichtet.
Was von dem hartnäckig zurückgehaltenen Getreide übrig bleibt, mögen nicht
einmal die Hühner. Der Löwenwirt wird unsicher. Er ist bereit, einige Viertel
Korn abzugeben. Freilich, statt 1 3/4 Gulden Normalpreis verlangt er neun. Als
jedoch zwei Tage später ein Bäcker kommt und dieses Geschäft machen will, hat
sich's der Löwenwirt anders überlegt. Zehn Gulden verlangt er, und der Kauf
unterbleibt.
Kurz darauf endet die Notzeit unvermutet rasch. Von auswärts
wurde Getreide nach Amberg gebracht. Überall erwartet man eine gute Ernte. Der
Getreidepreis geht zurück. Nun liefern die Bauern der Umgebung noch rasch ihre
letzten Vorräte auf den Markt, um an der Teuerung zu verdienen. Daraufhin sinken
die Preise weiter. Wie ärgert sich der Löwenwirt. Er will sein Getreide
loswerden, aber nun nimmt ihm keiner etwas ab. Spöttisch deuten ihm auf der
Straße die Leute nach.
Ende Juni schreibt Wiltmaister eine schreckliche Begebenheit
auf. Dem Kochbauern von Gailoh hat die Geldgier den Verstand weiter verwirrt,
und jetzt, da seine Erwartungen jäh zunichte werden, verliert er völlig den
Kopf. Dort, wo er auf dem Dachboden seine Getreidekisten und Fässer verwahrt
hat, macht er seinem Leben ein Ende. Der Scharfrichter muss kommen und ihn vom
Strick schneiden. Auf dem Schinderkarren schafft er ihn zur Richtstätte und
verscharrt ihn unter dem Galgen.
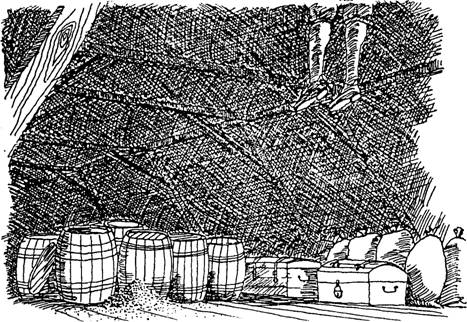
So endete der Kochbauer
Ende Juni beginnt die Ernte. Der erste Erntewagen wird
festlich geschmückt in die Stadt gefahren. Froh und glücklich begleiten ihn
viele Bürger zum Marktplatz. Dort bleibt er stehen, während in der Kirche eine
Dankandacht mit feierlichem Te Deum gefeiert wird.
Im August ist der Getreidepreis wieder auf seinen normalen
Stand gesunken. Erst jetzt bringt der Löwenwirt sein Korn an. Nur 1 1/4 Gulden
bekommt er für das Viertel, das er einst für neun Gulden nicht hat hergeben
wollen. Mit Schadenfreude vermerkt der Chronist, dass der Löwenwirt „anstatt
des gesuchten übertriebenen Gewinns einen sehr beträchtlichen Schaden davongetragen
hat“.

Danket, danket dem Herrn.
Zum Jahresende 1772 beschließt Wiltmaister seine
Eintragungen über die große Hungersnot und fügt an: „Der Herr verschon' uns
fürderhin vor solcher Missernte.“
Hungersnöte hat es in der Vergangenheit öfter gegeben, die
Ursachen waren unterschiedlich.
1557 kamen Heuschrecken in solchen Mengen, dass sie die
Sonne verdunkelten und fraßen alles ab, was grün war. Drei Jahre dauerte diese
Plage, die Menschen und Tieren die Nahrung schmälerte.
1415 hat ein sehr nasser Sommer alle Erdgewächse verdorben,
auch den Weinstock. Alle Wiesen waren vom Wasser überschwemmt und alles Gras
verwüstet.
1495 haben sich den Sommer über grausame Donnerwetter
allenthalben ereignet und in vielen Orten ungemeinen Schaden getan, wie dann
der Hagel in Amberg und in den benachbarten Orten das Getreide in den Boden
geschlagen." Es sind auch Raupen in ganz Deutschland eine häufige Plage
gewesen, welche die Früchte abgefressen und alles vergiftet. Es haben am Korn
kleine Würmlein den Halm abgefressen, dass er umgefallen."
1571 war es so kalt, dass die Flüsse und Bäche alle
zugefroren waren und keine Mühle mehr arbeiten konnte und überall Mangel an
Mehl war.
1590 ließ ein heißer Sommer fast alle Wasserläufe
austrocknen. Man hat das Wasser teuer kaufen müssen. Wegen Futtermangel hat man
überall das Vieh abtun müssen.
1740 hat eine große Kälte bis Mitte Mai gedauert und nach
der schlechten Ernte musste man das Getreide um den dreifachen Preis kaufen.
1762 erfror bei großer Kälte zu Pfingsten die Kornblüte und
überdies hat es vom 29. März bis 2. Juni nicht geregnet. Der Getreidepreis stieg
auf das Vierfache. Böhmen, Franken und Sachsen hatten ebenfalls unter einer
Missernte zu leiden. Aus Bayern dagegen konnte man Getreide einführen und so
die größte Not lindern.
1817 kam es nach einem sehr nassen Sommer zu einer
allgemeinen Missernte in ganz Bayern. Auch in diesem Jahr hatte man eine
verfehlte Vorratshaltung betrieben und wieder durfte aus Böhmen kein Getreide
ausgeführt werden. Die Hungersnot dieses Jahres hat endgültig die Kartoffel zur
bevorzugten Feldfrucht der Oberpfalz werden lassen. Seitdem wurde unsere Heimat
nicht mehr vom Hunger heimgesucht, wenn wir von den Kriegszeiten absehen.
Die Erdäpfel oder Erdbirnen hat der Amberger
Regierungskanzler Pistorini übrigens schon 1725 aus den Niederlanden bezogen
und als Zierpflanze gehalten. Erst im Laufe der Jahrzehnte hat man sie zur
Schweinemast verwendet und zu Wiltmaisters Zeiten galt sie als Nahrung des „gemeinen
Mannes“. Die höheren Stände schätzten sie mehr als Grundstoff für Kleiderstärke
und Haarpuder. Lange Zeit war die Regierung gegen jede Ausweitung des Kartoffelanbaues,
denn man fürchtete Mangel an Brotgetreide. Schließlich erkannte man allgemein,
dass die Kartoffel in unserer Oberpfalz besonders gut gedeiht. Nach 1817 wurde
unsere Heimat von den Nachbarn im fruchtbaren Niederbayern als Erdäpfelpfalz
bezeichnet.
Übrigens, alle Angaben - außer jenen für 1817 - hat der
Chronist Kaspar von Wiltmaister zusammengesucht und überliefert. Er wurde 1706
in Neumarkt geboren, heiratete 1755 eine Amberger Apothekerstochter und wurde
1759 kurfürstlicher Rentkammerrat. Für seine umfassende Chronik Ambergs konnte
er die reichhaltige Sammlung seines Kollegen Dreer verwenden. Druck und
Herausgabe seiner Chronik hat Wiltmaister 1782 gegen den Widerstand seiner
Regierungskollegen veranlasst. 1784 starb er. Die Wiltmaisterstraße beim
Krankenhaus erinnert an ihn.
Im Franziskanerkloster in Amberg
sitzt ein Pater nachdenklich vor dem leeren Blatt auf seinem Tisch. Er will für
die Chronik des Konvents das schlimmste Geschehen des Jahres 1784 festhalten.
Er schreibt alles auf was ihm noch in Erinnerung ist und was ihm glaubhaft
berichtet wurde, und wir können noch heute in der Klosterchronik des
Franziskanerklosters und über das schlimmste Hochwasser in Amberg informieren:
„Zu Anfang Januar fiel ein so
häufiger Schnee, dass dadurch den 27. und 28. Februar bei einfallendem Tau- und
Regenwetter über die halbe Stadt unter Wasser gesetzt wurde, also zwar, dass
solches fast zwei Schuh höher stieg als 1782, in welchem Jahr seit alters hier
die größte Wasserhöhe angemerkt wurde. Kurz, das Wasser reicht in der oberen
Stadt bis gegen den Rossmarkt und in der unteren bis gegen die Spitalkirche.
Man konnte sogar über die Krambrücke mit Schiffen fahren. Die Brücken außer der
Stadt, wie auch die obere und untere Mühlbrücke, sind vom andrängenden Eis und
Holz gänzlich abgerissen. Krambrücke, Schulbrücke, Schiffbrücke und die obere
Mühle samt ihrem Wehr sind sehr beschädigt.
Die Untere Mühle, dann die Loh-
und Schleifmühle sind vollkommen ruiniert und unbrauchbar gemacht worden. Die
Unkosten für die Stadtkammer werden auf 30.000 Gulden geschätzt.
Ferner sind in der Pfarrkirche St.
Martin alle Kirchenstühle von der Gewalt des Wassers hochgehoben und unter sich
und über sich gekehrt. Das Pflaster ist meistenteils aufgerissen und auch
einige Totengrüfte sind geöffnet.
In den kurfürstlichen Salzstädeln
sind etliche tausend Salzscheiben im Wasser zerschmolzen.
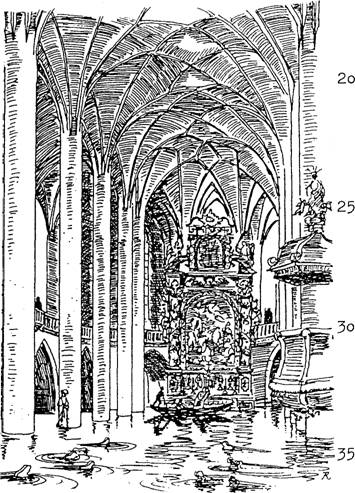
Hochwasser in der Martinskirche
Das kurfürstliche
Regierungsgebäude hat sich nach Verlaufen des Wassers an etlichen Orten zerspalten und gleichsam zum
Sturze geneigt. Zur Herstellung muss viel Geld aufgewendet werden. In .der
Apotheke der hiesigen Klosterfrauen soll sich der Schaden auf 3.000 Gulden
belaufen. Von den Einzelpersonen der Stadt hat den größten Schaden erlitten der
hiesige Materialist Herr Mazillis, dem ein ganzes Fass Arsenikum, etliche
Fässer Zucker, Indigo, Öl und anderes mehr
zugrunde gingen.
In unserem Konventgarten stand das
Wasser 5-6 Fuß hoch, es reicht bis an die Türschwelle des Refektoriums. Es sind
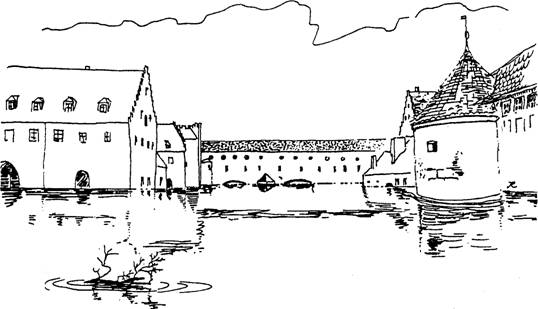
also Blick von der Schiffbrücke zur Stadtbrille zur Zeit
des Hochwassers um 1784
alle unteren Gewölbe, Keller und
die beiden Grüfte vom Wasser vollkommen angefüllt. Wie hoch das Wasser stand,
lässt sich heute noch an den Hochwassermarken beim Schulsteg oder an der
Schiffbrücke ablesen.
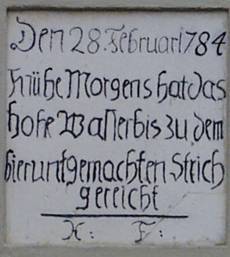
 Über die weiteren Ereignisse
schrieb der Pater noch nieder, dass man im Kloster über 14 Tage täglich an der „Ausschöpfung
der Keller“ arbeitete: „Dabei waren 10 - 15, anfangs sogar 20 - 25 Personen
beschäftigt. Im Bierkeller und auch in der neuen Gruft wurde eine Hauptmauer beschädigt,
es wurden auch einige Gräber geöffnet. Die Kessel im Waschhaus, in der Walk und
im Branntweinhäusl hat das Wasser herausgerissen, alles musste wieder repariert
werden. Die Kirche und der Kreuzgang sind zwar von der Überschwemmung befreit
geblieben, doch sind in der Kirche die Altäre St. Michaelis und Mater Dolorosa
und auch alle alten Totengrüfte samt dem Kirchenpflaster und auch das Gewölbe
beim Eingang der Pforten nachgesunken. Das muss nun alles neu aufgeschüttet
und gepflastert werden. An einigen Orten ist der Kreuzgang, das Refektorium,
die Sakristei und das Pflaster in der Kirche eingesunken. Die Gartenmauer ist
sowohl innen als auch außen durch das Wasser sehr beschädigt worden und muss
ebenfalls mit großen Kosten ausgebessert werden. Die Fischbehältnisse hat das
Wasser mit sich fortgeführt.“
Über die weiteren Ereignisse
schrieb der Pater noch nieder, dass man im Kloster über 14 Tage täglich an der „Ausschöpfung
der Keller“ arbeitete: „Dabei waren 10 - 15, anfangs sogar 20 - 25 Personen
beschäftigt. Im Bierkeller und auch in der neuen Gruft wurde eine Hauptmauer beschädigt,
es wurden auch einige Gräber geöffnet. Die Kessel im Waschhaus, in der Walk und
im Branntweinhäusl hat das Wasser herausgerissen, alles musste wieder repariert
werden. Die Kirche und der Kreuzgang sind zwar von der Überschwemmung befreit
geblieben, doch sind in der Kirche die Altäre St. Michaelis und Mater Dolorosa
und auch alle alten Totengrüfte samt dem Kirchenpflaster und auch das Gewölbe
beim Eingang der Pforten nachgesunken. Das muss nun alles neu aufgeschüttet
und gepflastert werden. An einigen Orten ist der Kreuzgang, das Refektorium,
die Sakristei und das Pflaster in der Kirche eingesunken. Die Gartenmauer ist
sowohl innen als auch außen durch das Wasser sehr beschädigt worden und muss
ebenfalls mit großen Kosten ausgebessert werden. Die Fischbehältnisse hat das
Wasser mit sich fortgeführt.“
„Dieser großen Überschwemmung ungeachtet,
ist niemand in der Stadt im Wasser ertrunken bis auf ein Kind von sieben bis
acht Jahren,  welches ungefähr von einer
Stiege ins Wasser fiel. Der Herr bewahre in Zukunft unsere Vaterstadt vor solch
großem Übel.“
welches ungefähr von einer
Stiege ins Wasser fiel. Der Herr bewahre in Zukunft unsere Vaterstadt vor solch
großem Übel.“
Zwar ist das Hochwasser von 1784 bis heute das verheerendste
geblieben, das Amberg je heimgesucht hat Ähnliche Katastrophen erlebte unsere
Stadt allerdings häufiger, Hochwassermarken am Hause südlich der Martinskirche
und am Lederersteg erinnern daran. Von anderen Überschwemmungen berichten
unsere Chroniken, Am 15. Februar 1571 folgte grimmiger Winterkälte plötzliches
Tauwetter mit Regen und „die Gewässer haben allenthalben an Häusern, Brücken,
Stegen, Ackern, Gärten und Wiesen großen Schaden getan. Jedermann meinte, der
jüngste Tag war angebrochen.“
Große Schäden verursachte das Tauwetter zwischen 25. und 27.
Februar 1595. Besonders die Mühlen und Hammerwerke an Vils und Rosenbach wurden
sehr geschädigt.
 1662 heißt es, dass am
25. Januar die Vils um 10 Werkschuh (das sind 2,8 m) über ihren gewöhnlichen
Lauf gestiegen ist. Den Bewohnern der Unteren Georgenstraße musste man mit
Kähnen die Lebensmittel bringen.
1662 heißt es, dass am
25. Januar die Vils um 10 Werkschuh (das sind 2,8 m) über ihren gewöhnlichen
Lauf gestiegen ist. Den Bewohnern der Unteren Georgenstraße musste man mit
Kähnen die Lebensmittel bringen.
Das Hochwasser am 29. und 30. Dezember 1765 reichte bis zur
Oberen Apothekergasse und auch der Paradeplatz war völlig überschwemmt.
Die Überschwemmung des Jahres 1909 (4. mit 6. Februar)
reichte bis zur Regierungsstraße. Im Stadtgraben konnte man mit Kähnen fahren,
über den Marktplatz mussten Stege geschlagen werden. Von dieser letzten großen
Überschwemmung bewahrt das Stadtarchiv noch einige Fotografien.
Als der Nachtwächter am Klosterplan die vierte Morgenstunde
des 6. Oktober 1802 ausruft, bemerkt er einen matten Lichtschimmer in den
Fenstern der Bernhardskirche. Was haben die guten Franziskaner zu so früher
Stunde vor? Er schaut durch die Tür.

Blick über die Stadt auf die Bernhardskirche
In der mächtigen Halle werden an einigen der 13 Altären bei
flackernden Kerzen Messen gelesen. Laienbrüder und einige Bürger ministrieren.
Übergroß, fast drohend, erscheint im schwachen Dämmerlicht die Figur des heiligen
Johann Capistrano über der Kanzel. Wie ein riesiger Block ragt die Orgel auf
der zweiten Empore nach oben, stumm und unheimlich. Nur das halblaute Beten aus
den Kapellennischen ist zu vernehmen. Der Guardian, Pater Victurnus, spricht am
Hochaltar das Kyrie, alle wiederholen mit tiefem Ernst, wie es dem Nachtwächter
dünkt, die Bitte um Gottes Erbarmen. Dann stimmt Pater Victurnus das Gloria an,
seine Mitbrüder singen mit, aber der Nachtwächter merkt, aus frohem Herzen
kommt dieser Lobpreis des Herren nicht. Nun, er weiß ja nicht, dass in dieser
frühen Stunde die Franziskaner Abschied nehmen von ihrem Kloster, von ihrer
Gemeinschaft und von Amberg. Etwas verwundert geht er weiter.
Der Guardian kennt die Sorgen seiner Gemeinschaft. Einige Abschiedsworte
will er ihnen mitgeben, und so versammelt er sie zu einer kurzen Ansprache um
den Hochaltar. Er bekennt, dass es ihm ein Trost ist, dass sie alle mit gutem
Gewissen Amberg verlassen können. Der Amberger Konvent hat unter großen
Entbehrungen dieses stattliche Kloster zwischen 1453 und l480 gebaut.
Konventsmitglieder waren es, die den Großteil der schönen Kirchenausstattung
geschaffen haben. Er weist auf die kunstvolle Uhr hin, die eben schlägt und das
Werk eines Fraters ist. Er fährt fort: „Wir haben uns alle redlich bemüht, Amberg
und den Ambergern zu helfen in allen Nöten.“ Die Bürger nicken und erinnern
sich dankbar des wagemutigen Einsatzes der Franziskaner bei jedem Brand in der
Stadt. Der Guardian stellt fest:
„Wir haben dafür spüren dürfen, dass man uns gerne hat, man
hat uns geholfen, und ohne den Beistand der Bürger wäre es nicht möglich
gewesen, diese Kirche auszuschmücken, unsere Bibliothek auszubauen, die Lodenwalkerei
einzurichten und unser Brauhaus aufzubauen.“
Wehmütig denken die Bürger an vergnügte Stunden im
Klosterbräustüberl. Der Prediger wird nachdenklich: „Doch haben wir all das,
was uns zur Verfügung stand, nicht schon als Selbstverständlichkeit
hingenommen? Nach dem Willen des heiligen Franz sollten wir Bettler sein. Es
war sicher eine besondere Bosheit, dass die Regierung uns ausgerechnet am
Namensfest unseres Ordensstifters den Ausweisungsbefehl zugestellt hat. Lasst
uns dies jedoch als Mahnung betrachten, dass wir hier auf Erden nirgendwo einen
festen Platz und eine feste Aufgabe haben sollen. Lasst uns dem Beispiel des
heiligen Franziskus folgen, der mit leeren Händen sein Vaterhaus verlassen hat.
Mög' er und der allmächtige Gott uns auf unseren weiteren Wegen beschützen.“
Mit einem festen „Amen“ antwortet die kleine Gemeinschaft.
Die Messe ist zu Ende. Gewohnheitsmäßig verwahren die Pater
ihre Messgewänder in der Sakristei. Die bürgerlichen Messdiener verabschieden
sich. Tränen stehen ihnen in den Augen, und traurig gehen sie heim. Dann sitzt
der Konvent beim gemeinsamen Morgenmahl. Inzwischen löscht der Küchenbruder das
Herdfeuer und verräumt das Geschirr. Während sich die Mönche aus ihren Zellen
die Wolldecken holen, die eine hohe Regierung mitzunehmen gestattet hat, geht
der Guardian noch mal in die Kirche und löscht das ewige Licht beim Hochaltar.
Kurz darauf tritt ein Beamter des Landrichters ins Refektorium und fordert die
Schlüssel für Kirche und Kloster. Vor dem Kirchenportal warten bereits Wägen.
Es ist noch finster und die Stadt liegt noch im Schlafe, als gegen halb sechs
Uhr die Franziskaner Amberg in Richtung Freystadt verlassen.

Mönche beim Verlassen des Klosters
Vier Wochen bleibt das Kloster völlig ohne Leben. Anfang
November aber füllt lautes, unheimliches Treiben, die weitläufigen Gänge und
Höfe. Da werden einfache, rohe Stühle, Tische und Bettstellen aus den
Mönchszellen geschleppt. Geschirr, Kessel, Töpfe und Pfannen der Klosterküche
werden auf den Hof geschafft. Auf einigen Tischen stapeln sich Bettwäsche,
Tischtücher, Vorhänge und Lodenballen. Kurfürstliche Beamte versteigern die Einrichtung
des Klosters zu billigen Preisen an Kauflustige. Weniger laut geht es in der
Sakristei zu. Kelche, Monstranzen, Leuchter und Becher werden für die kurfürstliche
Münze eingepackt. Amberger Bürger müssen sehen, wie die kostbare
Klostermonstranz, die sie erst vor einem Jahr um 600 Gulden von der
kurfürstlichen Silberkommission zurückgekauft haben, nun doch nach München
geschafft wird. In der Bibliothek sortiert inzwischen Sekretär Bernhard die 5294
Bücher, wählt die wertvollsten aus und lässt schließlich 15 schwere Bücherkisten
nach München transportieren. Gegen 4000 Bände finden um den Spottpreis von 5
Kreuzer je Stück Käufer. Über 1000 Bände wandern in die Papiermühlen. Den
Winter über stehen Kloster und Kirche verlassen inmitten der rührigen Stadt.
Ende März geht der Ausverkauf weiter. Die Kirche muss geräumt werden, damit man
dieses Zeugnis des finsteren Mittelalters abbrechen kann, wie es eine „weise,
aufgeklärte Obrigkeit“ bestimmt hat.
Professor Graf kommt aus München und sucht die schönsten
Bilder für die kurfürstliche Gemäldesammlung aus. Die Stadt Weiden kauft für
ihr Rathaus die kunstvolle Konventuhr. Wie freuen sich die Kümmersbrucker über
die 3 Altäre, die sie billig erstehen können. Dabei ahnen sie gar nicht, wie
wertvoll das St. Annabild des Rubensschülers Crayer ist. Viele Fuhrwerke schaffen
die Teile der großen Orgel nach Seligenporten. 3 Altäre und die Kanzel holen
die Bärnauer, und auch die Illschwanger kaufen 3 große Altäre. Über die ganze
Oberpfalz wird die Einrichtung der Bernhardskirche zerstreut.
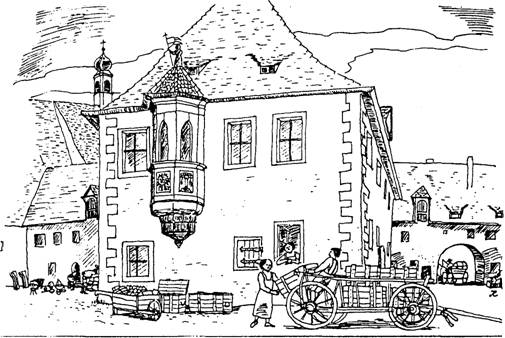
Die verkauften Einrichtungen der Bernhardskirche
werden abtransportiert.
Voll Trauer und Bitternis sehen die Amberger wie Bilder,
Figuren und Altäre, die sie selbst oder ihre Vorfahren für ihre
Franziskanerkirche gestiftet haben, verschachert werden, weil der Staat
Schulden hat und Geld braucht. Am 16. April ist die Kirche leer.
Der Nachtwächter, der vor der Alten Veste die Mitternacht
ansingt, wird vom fröhlichen Lachen und Schreien im Saal des alten
Herzogschlosses beinahe aus dem Takt gebracht. Mißbilligend brummt er: „Was
feiert der Herr Baron Eghker schon wieder?“ Nun, die Mitglieder des „Adeligen
Gesellschaftstheaters“ haben das Schauspiel "Dienstpflicht"
probeweise mit verteilten Rollen gelesen. Sehr zufrieden sind sie, diese Herren
Barone und Reichsgrafen, diese Regierungsdirektoren und Rentkammerräte, diese
vornehmen Gräfinnen und adeligen Damen. Oh, da werden die Bürger schauen, wenn
ihnen auf der Bühne gezeigt wird, wie tüchtige Beamte ihrem Dienst verpflichtet
sind! Jetzt sitzt man zwanglos beim Wein, schwärmt von den diesjährigen Theateraufführungen
und klagt wie üblich über die ungünstigen Verhältnisse im kleinen Theater an
der Seminargasse. Ein richtiges Theater brauchte man, eine große Bühne, viele
Kulissen, eine Theatermaschine. Wunschträume! Daraus kann nichts werden, wenn
man nicht 25.000 Gulden hat.
Da schlägt eine der Damen vor, die leere Klosterkirche als
Theater zu nutzen. Erst schauen sich alle erstaunt an, doch dann überschreien
sich alle in Äußerung der Zustimmung, man klopft sich auf die Schultern, sinkt
sich vor Freude in die Arme. Als die fröhliche Ausgelassenheit etwas nachlässt,
verkündet Herr Statthalter Reichsgraf von Holnstein mit halbamtlicher Miene: „Meine
Damen und Herren, die Bernhardskirche wird unser Theater.“ Beifallklatschen,
jubelnde Zustimmung und knallende Sektflaschen übertönen den Nachtwächterruf.
Mißbilligend schüttelt drunten auf dem Platz der Alte den Kopf, und mehr kann
er sich angesichts der hochgestellten Ruhestörer gar nicht leisten.
Als am 4. Mai 1803 das leere Kloster dem Melber Thomas
Bruckmüller um gut 25.000 Gulden verkauft wird, zirkulieren bereits Spendenaufrufe
für den künftigen Musentempel. Die Finanzierung ist gesichert. Die Regierung
hat kurzerhand das städtische Almosenamt als Bauträger und späteren Besitzer
verpflichtet, und die stattlichen Beträge, die Ambergs Bürger für die Armen
gegeben haben, müssen für den Theaterbau verwendet werden. Dafür sollen der
Almosenverwaltung die künftigen Einnahmen aus dem Theaterbetrieb zufallen.
Ab Mai 1803 wird der Klosterplan zu einer großen Baustelle.
Maurer verändern die Fenster, Dachdecker arbeiten am Giebelwalm, Zimmerleute
hauen die Balken für die Theaterkonstruktion zurecht. Ständig kommen Fuhrwerke
mit Baumaterial und Baumstämmen.
Bald verlagert sich diese emsige Tätigkeit ins Innere der
ehemaligen Kirche. Zimmermeister Graf errichtet aus mächtigen Balken das Gerüst
für die Ränge, den Unterbau für das Parkett und die Stützen der Bühne. Leonhard
Bacher, der kunstreiche Schreinermeister, der Schöpfer des prächtigen Altares
im Kongregationssaal, verkleidet die Logen und die Bühne, liefert die Bänke
und Stühle und fertigt die Rahmen für die Theaterkulissen. Auf seiner Rechnung
stehen ferner ein großes Schiff auf Rollen, eine Brücke, ein Sarg, ein richtiges
Bauernhaus und viele, viele andere Stücke für die Bühnengestaltung.
Der Hofmaler Schelling aus München arbeitet monatelang an
den vielen Kulissen. Gegen 4 000 Meter Leinwand verbraucht man, und die
oberpfälzischen Weber machen gute Geschäfte. Unter der Bühne werkelt der Mühlarzt
Beck - wir würden ihn Mechaniker nennen - an dem Zauberwerk der Theatermaschine.
Ein Schacht für die großen Gewichte wird gegraben. Zahnräder, Walzen, Zugseile
und Rollen fügt er zu einem seltsamen Gebilde zusammen, das einer großen Uhr
gleicht. Schließlich hängt er die 24 Kulissenwagen an den Drehbaum. Ein
Hebeldruck, das Gewicht gleitet nach unten, die Hauptwalze dreht sich, und von
jeder Seite gleiten 6 neue Kulissen auf die Bühne, während 6 verschwinden.
Gleichzeitig wechseln Hintergrund und Deckenkulissen. In Sekundenschnelle wird
aus einem Gefängnis ein Schlosssaal.
Am 4. Oktober 1803 kann das Theater feierlich eröffnet
werden. Da sehen die Besucher, also viele adelige Herrschaften aus einem weiten
Umkreis, aber auch wohlhabende Bürger und ehrsame Handwerker Ambergs und
Theaterfreunde oben auf dem „Juchhe“, lauter getreue Untertanen, ihre
hochweisen, hochadeligen Herren der Regierung als Helden, Liebhaber und
Schurken auf der Bühne agieren. Sie staunen beim raschen Wechsel des Bühnenbildes,
zucken bei Blitz- und Donnerschlägen zusammen und sind gerührt von der aufopfernden
„Dienstpflicht“, die ihnen gezeigt wird. Der Nachtwächter, der zu später Stunde
den lauten Beifall hört, schüttelt den Kopf. Vor knapp 6 Monaten begann man mit
dem Umbau, und erst ein Jahr ist es her, dass Pater Victurnus das ewige Licht
in der Bernhardskirche löschte.
Die vertriebenen Franziskaner kann er nicht vergessen. Er
kann sich nicht über dieses
Theater in der einstigen Bernhardskirche freuen, und vielen seiner Mitbürger
geht es ebenso.
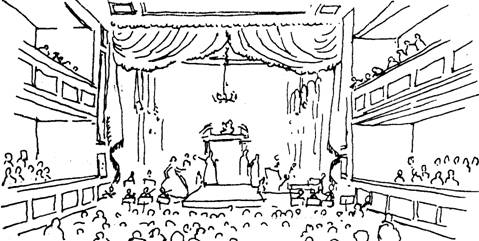
Der Zuschauerraum des Stadttheaters
Die Ausweisung der Franziskaner 1802 war bereits die zweite
in der Geschichte der Amberger Ordensniederlassung. 1553 übergaben die
Ordensoberen das Kloster Kurfürst Friedrich II., da es ihnen an Nachwuchs
fehlte. Der Landesherr übernahm es mit Zustimmung des Papstes. 1555 verließen
die letzten Minoriten Amberg. Kalvinische Herrscher machten das Kloster zum
kurfürstlichem Pädagogium. Die Kirche wurde ausgeräumt.
Nachdem 1621 Truppen des katholischen Herzogs Max I. Amberg
besetzt hatten, kehrten 1626 die Franziskaner wieder zurück. Sie bauten von 1667
bis 1669 in die große, spätgotische Kirchenhalle mit der seltenen Holztonnendecke,
die 1480 holländische Franziskaner geschaffen hatten, 8 mächtige Stützpfeiler
und zogen ein barockes Steingewölbe ein. Nach und nach konnte die Kirche dank
der reichlichen Spenden Amberger Bürger gediegen ausgestattet werden.
Ab 1690 übernahmen die Franziskaner alle gottesdienstlichen
Verpflichtungen in der Wallfahrtskirche Mariahilf. 1802 mussten sie auch das
Bergkloster räumen, doch 1850 kehrten sie wieder auf den Mariahilfberg zurück.
Das St. Bernhardskloster blieb als Gaststätte und Brauhaus
bis heute im Besitz der Familie Bruckmüller. Im Laufe der Jahre wurde das Nationaltheater
von 1803 allen Ambergern lieb und wert. Die Stadt hat stets dafür gesorgt, dass
Gebäude und Theatereinrichtungen in gutem Zustand blieben. Bis zu 100
Aufführungen wurden in mancher Spielzeit geboten.
1955 musste der Theaterbetrieb wegen einer fehlenden
Feuermauer eingestellt werden. Bald zeigten sich Schäden am Dachgebälk. Sehr
unzulänglich war die Heizungsanlage. Da man für das Gebäude keine passende Nutzung
wusste, beschloss 1969 der Stadtrat den Verkauf an eine Bank und erteilte die
Abbruchgenehmigung. Die Bemühungen der Amberger Bürger für die Erhaltung des
traditionsreichen Theaters, der Einspruch des Landesamtes für Denkmalpflege und
der Verbot des Abbruchs durch die Regierung führten schließlich zu einer Aufhebung
des Stadtratsbeschlusses und zu einer gründlichen Restaurierung des Theaters.
1978 konnte das Amberger Stadttheater in der alten St. Bernardskirche wieder
eröffnet werden.
Welch ein Treiben auf dem Marktplatz! Ein großer, prächtiger
Kranz, den die Vinzentinerinnen für das neue Krankenhaus geflochten haben,
lockt immer neue Gruppen an. Eben schmücken ihn die Amberger Mädchen mit
langen, bunten Seidenbändern. Fröhlich und gelöst schaut Bürgermeister Rezer
vom Rathaus auf die vielen festlich gekleideten Menschen, die den Platz allmäh-
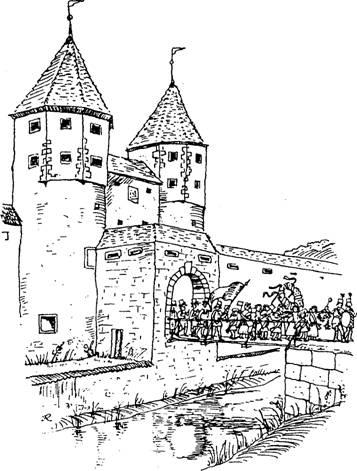
Festzug beim Nabburger Tor
lich so füllen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie
hier ein ordentlicher Festzug zustande kommen soll.
Doch als um 3 Uhr nachmittags die Kapelle der Bergleute
anmarschiert, da finden sich die Leute in Reihen zusammen und in schönster
Ordnung geht’s mit der Musik voran zum Nabburger Tor. 16 weißgekleidete
Mädchen, alle geschmückt mit schwarz-rot-goldenen Schärpen, tragen auf blumengeschmückter
Bahre den Kranz und den Buschen für die Hebefeier des Krankenhauses. 12 Buben
mit weiß-blauen Schärpen und Fähnlein gehen ihnen zur Seite.
Die Maurer folgen, voran ihr Fähnrich in schmucker,
mittelalterlicher Tracht. Lustig lässt er die Fahne kreisen. Dann kommen die
ehrsamen Meister und Gesellen des Maurerhandwerks in ihrer saubersten
Arbeitskleidung. Stolz und würdevoll tragen sie ihr Werkzeug, also Winkeleisen,
Hammer, Kelle, Steinmetzgerät und Wasserwaage. 20 sinds, die heute stolz ihr
Werk, an dem sie fast 1 Jahr gearbeitet haben, ihren Mitbürgern zeigen wollen.
Wieder naht ein Fähnrich im bunten, alten Kostüm. Auf seiner
Fahne prangt das Bild des heiligen Josef, und der würdige Patron der
Zimmerleute schwebt heute besonders verwegen durch die Luft. Besonders fallen
die sechs Zimmergesellen auf. Mit Rosmarin, Zitronen und schwarz-rot-goldenen
Bändern haben sie ihre Winkeleisen geschmückt. Mit Rezer freuen sich viele,
dass sie heute so häufig diese Farben des neuen deutschen Bundes sehen. 6 Altgesellen
kommen mit ihren schweren Queräxten, 6 andere tragen Bandbeile. Die 2
Steinmetzmeister Ambergs gehen dann für sich. Nun kommen die wichtigsten Leute
der heutigen Feier, der Krankenhausverwalter, der Bauführer und Zimmermeister
Gürtler und der Obermeister der Maurerzunft.
Die Amberger Behörden folgen, also die Magistratsbeamten,
die Stadträte und die Gemeindebevollmächtigten. Bürgermeister Rezer schaut
während des Marsches erfreut auf die dichten Zuschauerreihen, die überall den
Weg des Zuges säumen. Immer neue Gruppen reihen sich dem Festzug ein und
beschwingt gehts dahin bei den Klängen der Musik.
Jetzt verlässt die fröhliche Menschenschlange durchs
Nabburger Tor die Stadt, schiebt sich durch abgeerntete Felder und vorbei an
fruchtschweren Obstgärten hin zum Mariahilfbergweg und weiter zum Rohbau des
Marienkrankenhauses. Die Mädchen und die Buben sind schon hinter den Gerüststangen
im großen Hause verschwunden, da dringen noch immer Leute durch das altersgraue
Stadttor.
Stattlich ist der Rohbau des neuen Krankenhauses. Seit über
100 Jahren ist in Amberg kein ähnliches Gebäude mehr errichtet worden. Über den
beiden Giebeln bauschen sich an hohen Stangen Fahnen mit den bayerischen Farben.
In der Mitte aber, dort wo sich einst das Kapellentürmchen erheben wird, bewegt
sich mayestätisch eine riesige schwarz-rot-goldene Fahne.
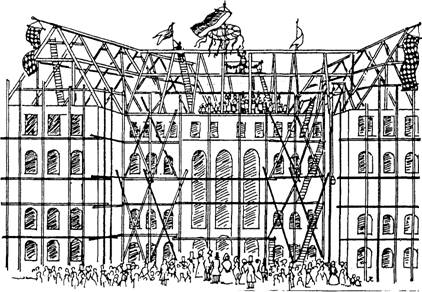
Richtfest -- Krankenhaus bau 1848
Die Mädchen mit Kranz und Buschen stehen nun im Dachstuhl unter
der großen Bundesfahne. Die Knaben schließen sich rechts und links an und die
Werkleute umrahmen diese hübsche Kindergruppe. Die beiden Fähnriche steigen
hoch hinauf ins Dachgebälk und lassen vom First ihre Fahnen lustig flattern.
Der Garten füllt sich, und auch ins Haus drängen Männer,
Frauen und Kinder. Aus vielen Fenstern schauen bereits fröhliche Menschen
hinaus in den milden Herbsttag und hinunter auf die vielen, vielen Festgäste.
Lustig spielt die Kapelle bis alles versammelt ist. Inzwischen haben sich auch
die Behörden auf einer Tribüne eingefunden. Die Musik endet, und allmählich verstummt
das vielstimmige, fröhliche Gemurmel der Menge.
Bürgermeister Rezer schaut zufrieden, nein, glücklich auf
das Haus und freut sich über dieses Werk, um das er sich 8 Jahre lang bemühen
musste. Jetzt hat Amberg ein Krankenhaus. Überall sieht er dann Schwarz-Rot-Gold,
diese Farben, unter denen sich jetzt alle deutschen Stämme freiwillig zusammengefunden
haben, von Südtirol bis Schleswig-Holstein, von Kärnten bis Ostpreußen. Im
neuen Bund wird Bayern, wird Amberg einer schönen Zukunft voll Freiheit,
Einigkeit und Gerechtigkeit entgegengehen, so hofft er.
Jetzt tritt Zimmermeister Gürtler, der nicht nur den Bau
geleitet, sondern auch die Baupläne entworfen hat, auf das schmale Podest im
Dachstuhl und spricht mit kraftvoller Stimme den wohlgereimten Meisterspruch
für dieses Werk der Nächstenliebe:
Nach gutem, alten Meisterbrauch
besteig' ich heut die Balken auch,
um meinen Spruch mit Wein zu netzen,
und auf den First den Kranz zu setzen.
In fast klassischen Reimen erinnert er dann an die
Grundsteinlegung im Jahre 1847 und auch an die freiheitliche Bewegung im März
des Jahres 1848, an die Bundesversammlung in Frankfurt und an die neue
Verfassung in Bayern:
Da gesellten, erkoren durch Völker Vertrauen,
sich die Männer in Frankfurt zusammen
und begannen am Dome der Einheit zu bauen in der Freiheit geheiligtem Namen.
Dann preist der Redner das Banner des neuen deutschen Bundes
und bekennt für sich, und wohl auch für die meisten der Anwesenden:
Was ein echter Gesell von gedrungenem Kern, der bekennt sich
zum Banner der Einigkeit gern.
Ausführlich schildert er den Baubeginn, die mühsame Arbeit
und die vielen Schwierigkeiten und empfiehlt in einem schlichten Gebet den Bau
der hohen Namenspatronin:
Maria, gnadenvolle,
sieh nieder hold und gut
und nimm zu unserm Wohle
dein Haus in deine Hut.
Aber auch seinen Stolz und seine Freude über die vollbrachte
Leistung verbirgt er nicht:
Die Freude pocht in meiner Brust,
wenn ich den hohen Bau betrachte,
den, viel bemüht der Geist erdachte,
er ist mein Stolz und meine Lust.
Nun wird’s Zeit für die Trinksprüche. Diesen alten
Zimmermannsbrauch begründet er in hübschen Strophen und preist dabei Noe als
ersten Zimmermann, der zugleich der Erfinder des Rebensafts ist:
Wie Herr Noah halt ich auch,
treu mit Zimmermannsbedacht,
an dem guten alten Brauch,
der die Seele munter macht.
Zuerst preist er alle, die durch ihre Opferbereitschaft
dieses große Werk ermöglicht haben. Er dankt im Namen all der Kranken, denen
dieses Haus helfen wird und schließt:
Ihr edlen Geber nehmt entgegen
des Himmels reichsten Gnadensegen.
Ein Altgesell reicht ihm das volle Weinglas, und unter dem
tosenden Beifall der großen Menge bringt er allen Wohltätern den ersten
Ehrentrunk. Die Musik setzt ein und Böller krachen. Das Glas hat seinen Dienst
getan, in hohem Bogen fliegts hinab. Doch unten lauern schon pfiffige
Bürschlein, um dieses Erinnerungsstück mit Mützen und Tüchern aufzufangen. In
den allgemeinen Beifall für die Verse mischt sich die heitere Anerkennung für
den glücklichen Fänger, um den sich sofort einige Bürger drängen, die für
blinkende Gulden ihm dieses Andenken abkaufen wollen. Dann preist Gürtler seine
Vaterstadt, ihre Bewohner und besonders Bürgermeister Rezer, und der zweite
Ehrentrunk gilt:
Amberg, der guten Pfälzer Stadt,
und was sie Gutes und Edles hat,
dem Bürgermeister auch daneben,
mit seinem segensreichen Streben.
Wieder braust der Beifall, wieder blitzt das fallende Glas
und wieder retten es geschickte Bubenhände.
Das 3. Glas wird der bayerischen Heimat und König Maximilian
gewidmet. Man erwartet einiges von diesem König, der so rasch die Verfassung anerkannt
hat:
Und mög’ König Max, der uns milde regiert,
der Himmel den Segen verleihen,
dass unter der Krone, die würdig ihn ziert,
das Recht und die Freiheit gedeihen.
Während er das 3. Glas ebenfalls in einem Zuge leert, nicken
ihm seine Zunftgenossen anerkennend zu, und der Jubel steigert sich, als auch
dieses Glas aufgefangen wird. Den 4. Trunk weiht er dann in begeisterten Versen
dem deutschen Vaterland, der deutschen Einigkeit und Erzherzog Johann, dem
Reichsverweser:
Oh, möge gut zumal geraten
der Bau der deutschen Einigkeit,
durch Männer Rat und Männer Taten,
dem Heil des Vaterlands geweiht.
Hoch hebt er das volle Glas, damit ja alle sehen können,
dass er keine halben Sachen liebt und laut schallt’s über die lauschende Menge:
Dem lieben deutschen Vaterland
im freien, einigen Verband
und Deutschlands bravsten Mann,
dem edlen Erzherzog Johann,
ein donnernd Lebehoch!
Die letzte Aufforderung hätte es nicht gebraucht. Es dauert
lange bis sich die begeisterten Zurufe legen. Mit einem letzten Gedicht begleitet
Gürtler das Aufsetzen des Kranzes und des großen Blumenbuschen. Während im
Winde die vielen Bänder des Kranzes lustig flattern, bittet er noch mal Gott
den Herrn um Schutz für dieses Haus. Ein kräftiges Amen beschließt diesen Teil
der Feier.
Anschließend berichtet Bürgermeister Rezer, wie die Amberger
sich stets der Kranken angenommen haben, wie sie schon vor 1300 für die armen
Aussätzigen zwei Häuser gebaut und im Bürgerspital stets eine
Krankenpflegestube unterhalten haben. Er fährt fort: „1522 bauten schließlich
unsere Vorfahren das alte Leprosenhaus bei St. Katharina zu einem allgemeinen
Krankenhaus um. Um 1542 wurde schließlich das ehemalige Benefiziatenhaus bei
der Katharinenkirche eine Krankenpflegestätte. Seit 306 Jahren dient dieses Gebäude
der Unterbringung und Pflege der Kranken. 300 Jahre sind’s bereits. Stets hat
die Krankenhausstiftung im Geiste christlicher Nächstenliebe und bürgerlicher
Gesinnung für die Kranken gesorgt. Stets haben die Bürger durch reichliche
Spenden das Vermögen dieser Stiftung vermehrt. Über 8.000 Gulden verfügte die
Krankenhausstiftung bereits vor 10 Jahren, und bislang konnten von den Zinsen
dieses Vermögens alle Dienstboten und Handwerksgesellen, aber auch alle Bürger,
denen die häusliche Pflege mangelte, im Krankheitsfalle versorgt werden.“

Er führt aus, wie man in den letzten Jahren immer deutlicher
die Unzulänglichkeiten des alten Krankenhauses erkannte. Mit bewegter Stimme
berichtet er: „Diese Erkenntnis führte zu Taten echt christlicher
Nächstenliebe. In knapp 10 Jahren wurden über 20.000 Gulden gestiftet.“ Er
nennt die Namen all der hochherzigen Geber, angefangen vom Benefiziaten
Walbrunn der 1800 Gulden schenkte, bis zum Peter Winter von Süß, der als
Dienstknecht starb und 11 Gulden der Stiftung vermachte. Er vergisst nicht
Johann Erras, der seinen Steinbruch bei Raigering der Krankenhausverwaltung
überließ, so dass man billig zu 12 000 Quadersteinen kam. Rezers Freund,
der Graf von Platen, schüttelt zwar mißbilligend den Kopf, aber die Amberger
dürfen schon erfahren, dass dieser fränkische Standesherr, dem Amberg zur
Heimat geworden ist, nicht nur alle Gartenarbeiten übernommen hat, sondern auch
sämtliche Pflanzen, Samen, Sträucher und Bäumchen geben will.
Rezer wendet sich an die Kinder und bittet sie, diesen Tag,
den sie so schön und eindrucksvoll mitgestaltet haben, nicht zu vergessen. Zum
Schluss vereinen alle ihr Gebet für die Wohltäter des Marienspitals und Rezer
schließt mit dem Ausruf:
„Heil und Segen allen Wohltätern unseres Marienspitals“. In
das oft wiederholte vielstimmige Hoch mischt sich nochmals die Blasmusik und
das Donnern der Böller. Das Richtfest ist beendet.
Noch lange steigen Bürger durch die Stockwerke des Rohbaues,
bewundern das weiträumige Haus, schauen fröhlich auf die Stadt Amberg, die
umgeben vom herbstbunten Ring der Allee und den altersgrauen Mauern und Türmen
vor ihnen liegt und blicken immer wieder hinauf zur großen schwarz-rot-goldenen
Fahne.
Alle städtischen Behördenvertreter treffen sich nochmal am
Abend im Wingershof, um am Hebmahl der Bauleute - auf eigene Kosten versteht
sich - aufgeräumt und fröhlich teilzunehmen. Wieder werden die Veranwortlichen
für den Neubau des Krankenhauses in lustigen und ernsten Trinksprüchen
gefeiert, und Rezer bekommt noch manches lobende Verslein zu hören. Er ist
überglücklich und hofft nur, der Bau des neuen deutschen Bundes möge unter den
Farben schwarz-rot-gold ebenso gut gelingen wie der Bau des Marienkrankenhauses.
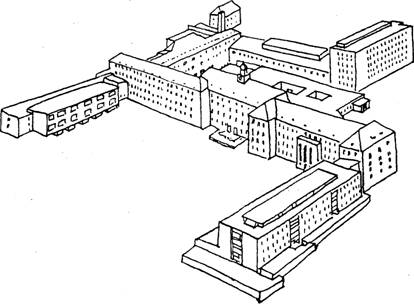
Krankenhaus (1984) mit den bestehenden Erweiterungsbauten
Der Bau von 1848 war so großzügig geplant, dass er bis 1928
allen Anforderungen gerecht werden konnte, obwohl sich die Bevölkerung der
Stadt in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt hatte. Von 1928 bis 1930 wurde der
erste große Erweiterungsbau angefügt. Nach dem Kriege reichten die vorhandenen
Räumlichkeiten nicht mehr aus, denn Ambergs Bevölkerung war auf 45.000
angewachsene Ab 1955 entstand der Küchen- und Entbindungstrakt. Zwischen 1961
und 1967 wurden weitere Gebäudlichkeiten angefügt. Doch die Bautätigkeit ging
weiter. 1984 stellte der Rezerbau nicht einmal mehr den zehnten Teil des Gesamtkomplexes
dar. Inzwischen musste auch er einem Neubau weichen.
Ein besonderes Verdienst Rezers war es dann,
Vinzentinerinnen für die Leitung des Hauses gewinnen zu können. Bis 1974 haben
sie im Krankenhaus in selbstloser Weise christliche Caritas vorgelebt, dann
mussten sie mangels Nachwuchs Amberg aufgeben.
Mit seinem Marienkrankenhaus durfte Rezer mit Recht
zufrieden sein. Sein eigenes Geschick dagegen ist tragisch. Der von ihm so sehr
gewünschte einige deutsche Bundesstaat, der alle deutschen Fürstentümer einschließlich
Österreichs umfassen sollte, scheiterte am Widerstand der deutschen Fürsten. In
Amberg schlug die Stimmung bald um. Die hohe Beamtenschaft und die Offiziere
waren ja bereits der Hebefeier fern geblieben. Sie wollten nichts mehr von bürgerlicher
Freiheit und allgemeiner Gerechtigkeit und deutscher Einigkeit wissen. Die
schwarz-rot-goldene Flagge verschwand schon 1849. Rezer verlor sein Bürgermeisteramt,
die Regierung beförderte ihn zum Landrat von Freising. Als 1850 das Amberger
Krankenhaus vollendet war, konnte er wegen seiner angegriffenen Gesundheit nicht
zur Eröffnungsfeier kommen. Im Oktober 1850 starb er. Die Rezerstraße erinnert
an den Mann, dem wir unser Marienkrankenhaus verdanken.
An einem Frühlingsabend 1834 sitzen beim Malteserwirt einige
Herren des Historischen Vereins eifrig diskutierend beisammen und unterhalten
sich über ihre letzten Archivarbeiten. Ein Gast am Nachbartisch bittet nach einiger
Zeit, sich zu ihnen setzen zu dürfen, da ihn Geschichte sehr interessiere. Es
wird ein sehr anregender Abend. Ehe die kleine Gruppe gegen 23 Uhr aufbricht,
lobt der Fremde nicht nur das gute Malteserbier, er ist auch von Amberg
angetan. Die Herren vernehmen das gerne. Dann aber stellt er missbilligend
fest, dass diese schöne Stadt nur schwer erreichbar ist. „Von Bayreuth nach Amberg
brauche ich fast länger als für eine Reise nach Augsburg. In der
Postkutschenzeit hätte ich Amberg beinahe ebenso schnell erreicht als jetzt mit
der Bahn. Haben ihre verehrten Vorfahren geschlafen, als die Eisenbahnlinien
abgesteckt wurden?“, meint er. Dem alten General Dollacker lässt dieser Vorwurf
des Bayreuthers keine Ruhe. Wie war das mit der Eisenbahn? In den nächsten
Wochen ist der General häufig in Ambergs Archiven. Was er da in dicken Akten
findet, das hätte er früher wissen müssen. Man bedenke, 1835 fuhr die erste
Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth. 1837 eröffneten die Sachsen und 1838 die
Preußen ihre ersten Eisenbahnlinien. Bereits 1838 aber reichten die Städte
Nürnberg, Regensburg und Amberg ein Gesuch um die Genehmigung einer Bahnverbindung
bei König Ludwig I. ein. Nachdem keine Antwort erfolgte, erneuerte Ambergs
Bürgermeister Rezer 1841 dieses Ansuchen.
„Na, das müsste der Bayreuther erfahren!“, denkt Dollacker,
als er liest, wie ab 1844 Ambergs Stadtväter ausgerechnet mit Bayreuth wegen
einer Schienenverbindung verhandelten. Durch das Vilstal sollte sie weiter nach
Regensburg geführt werden. Rezer hat dieses Projekt gründlich prüfen lassen und
war überzeugt, dass sich diese Strecke gut rentieren würde. Nutzen würde diese
Bahnlinie den Märkten Hahnbach, Rieden und Kallmünz, dann den Städten Auerbach
und Vilseck und besonders Amberg mit seinen knapp 8.000 Einwohnern und seinen
zahlreichen Garnisonen. Welchen Aufschwung würden die Hammerwerke an der Vils
und der Bergbau bei Amberg und Sulzbach nehmen. Sogar die Kosten hat man schon
zusammengestellt, mit 8 Millionen Gulden hofft man auszukommen.
1847 und 1849 bemühen sich die Städte Nürnberg und Amberg um
eine möglichst kurze Verbindung nach Böhmen. Amberg schlägt eine Linie über
Schwarzenfeld und Waidhaus nach Pilsen vor.
Als beim nächsten Stammtisch Dollacker seinen Freunden seine
Forschungsergebnisse vorträgt, ist man erstaunt. Da wollten die Amberger also
1849 der Eisenbahnknotenpunkt der Oberpfalz werden mit direkten Verbindungen
nach Pilsen, Regensburg, Nürnberg und Bayreuth.
„Warum sind aber diese Planungen unserer Vorfahren
gescheitert?“, will Dollacker wissen. In den Akten bis 1855 findet er nur neue
Eingaben der Stadt bei der hohen Regierung, endlich mit dem Bau wenigstens
einer der großen Linien zu beginnen. Dann entdeckt er die ersten Einwände. Bei
Burglengenfeld arbeitet ein modernes Eisenwerk, die Maxhütte. Dieser Betrieb
wünscht einen Bahnanschluss nach Regensburg. Die Regensburger wiederum drängen
auf eine Schienenverbindung mit Böhmen über Schwandorf und Cham. Die Vilstalbahn
lehnt man am Sitz der Kreisregierung ab. In Amberg aber will man unbedingt,
dass die Strecke über Schwarzenfeld nach Pilsen endlich begonnen wird, und man
bietet 1854/55 in München sogar die Gründung einer Aktiengesellschaft zur
Finanzierung dieses Vorhabens an. Doch vorerst geschieht nichts.
Beim nächsten Historikerstammtisch kann Seminardirektor
Blößner einiges zur Geschichte der Eisenbahn berichten. Er weiß, dass die
Amberger um 1850 den Bahnhof im Westen der Stadt nahe Gärbershof planten. Die
Bürger wollten nicht, dass die Bahnlinie die Stadt vom Mariahilfberg trennt.
Schon gar nicht wollten sie für die Bahnlinie im Osten der Stadt ihre Allee
opfern. Die Eisenbahnsachverständigen dagegen wollten gerade am Ostende der
Stadt die Bahnstation errichten.
Dollacker forscht weiter und findet, dass man um 1855 in
Ostbayern wegen der Bahnangelegenheit mit München sehr unzufrieden war.
Alle anderen Regierungsbezirke besaßen bereits Anschluss an
das große, eiserne Verkehrsnetz. Man konnte z. B. bereits von Aschaffenburg
nach Hof und nach München mit dem Zug reisen. In die Oberpfalz und nach Niederbayern
führten noch keine Schienen. Bitter beklagte sich die Handelskammer der
Oberpfalz über diese Zurücksetzung.
Es waren dann Privatleute, die das Schienennetz der
Oberpfalz schufen. Die Bankiers Eichthai und Hirsch bemühten sich um die
Gründung einer Aktiengesellschaft für den Bahnbetrieb in Ostbayern. Erst als
sich das berühmte Bankhaus Rothschild in Frankfurt, die Firma Cramer-Klett
(MAN) und der Fürst von Thurn und Taxis an diesem Unternehmen beteiligten, kam
es im April 1856 zur Gründung der Ostbahngesellschaft.
Leider besaß in dieser Aktiengesellschaft die Stadt Amberg
kaum Einfluss. Für 50.000 Gulden wollten die Amberger Aktien, doch sie bekamen
nur ein Aktienpaket von 4.200 Gulden. Die Regensburger Interessen dagegen vertrat
der Fürst von Thurn und Taxis, der erste Präsident der Gesellschaft.
Noch 1856 begannen die Arbeiten an der Strecke
Nürnberg-Amberg-Schwandorf-Regensburg. Von der Vilstalbahn wurde nicht mehr
gesprochen. Schwandorf war zudem als Ausgangsstation für die Verbindung nach Böhmen
vorgesehen. Die Strecke Amberg – Schwarzenfeld – Waidhaus - Pilsen war damit
hinfällig.
Noch immer bemühten sich die Amberger um die direkte
Verbindung nach Bayreuth. 1858 mussten sie erkennen, dass auch diese Absicht
nicht zu verwirklichen war. Die Bayerische Staatsbahn Augsburg-Bamberg sah in einer
Privatstrecke Amberg-Bayreuth-Hof ein Konkurrenzunternehmen und erhob
Einspruch. Die Amberger Planungen mussten zu den Akten gelegt werden.
Von den Arbeiten an der Bahnstrecke zwischen 1856 und 1859
weiß der General noch einiges von seinem Vater, der damals Landrichter in
Amberg war. Es gab keine Schwierigkeiten beim Grundstückskauf. Die
Vermessungsarbeiten waren rasch abgeschlossen. Dann rückten Arbeitskolonnen an,
und mit Pickel und Schaufel wurden Dämme und Einschnitte für den neuen Verkehrsweg
geschaffen. Amberger Fuhrunternehmer verdienten nicht schlecht, Brauer und
Wirte konnten sich am erhöhten Umsatz freuen, und mancher Schneider und
Schuster musste zusätzlich Gesellen einstellen, um die zerrissenen Kleider bzw.
Schuhe der Arbeiter ersetzen zu können. Von Herrn Blößner erhält der General
einen Brief mit interessanten Mitteilungen. „In den Krankenhausrechnungen fand
ich die Anzahl der Arbeiter vermerkt, die während der Arbeiten zu Schaden
gekommen sind. 1857 schickte die Eisenbahnsektion 20 Verletzte in das
Marienhospital, 1858 waren es 104, also genau ein Viertel aller Patienten. 1859
nahmen die Schwestern 70 Eisenbahnarbeiter auf und 1860 nochmals 20. Es müssen
Hunderte von Arbeitern rings um Amberg beschäftigt gewesen sein.“
„Dann wird sie interessieren, dass es 1857/58 zwischen der
Malteserbrauerei und der Ostbahn wegen des Wasserstollens beim Schimmelbauer
Schwierigkeiten gab. Die Wasserzufuhr zur Brauerei ließ sehr nach. Der Bahnhof
erhielt daher eine Wasserleitung vom Lindenbrünnlein her.“
„Ferner fand ich, dass noch 1858 wegen der Allee und der
Gestaltung des Bahnhofplatzes keine Einigung erzielt worden war. Die Stadt hat
sich sogar beim König über die Ostbahngesellschaft beschwert, allerdings
vergebens. Schließlich war die Gesellschaft bereit, den Bau der Brücke über den
Stadtgraben zu übernehmen, nachdem die Stadt einen Straßendurchbruch vom Spital
her zum Bahnhof beschlossen hatte.“
„Ich empfehle Ihnen übrigens, die Zeitungen von 1859 und 1860
durchzusehen.“
Natürlich freut sich der General über diese Aufmerksamkeit
und holt sich noch am gleichen Tage die zwei Jahresbände des Amberger Tagblatts
aus der Provinzialbibliothek. Dann notiert er eifrig.
8. September 1859 – „Heute, bald nach Mittag, hatten wir das
Vergnügen, die erste Lokomotive an unserem Bahnhof heranbrausen zu sehen. Diese
kam von Schwandorf her an und kehrte nach zweistündigem Aufenthalt, während
eine große Menge Schaulustiger herbeigeströmt war, wieder dahin zurück.“
12. September 1859 – „Gestern hatten wir das Vergnügen, zwei
Lokomotiven dahier zu sehen. Die eine, von Nürnberg kommende, traf etwas vor 12
Uhr in der Nähe der Vilsbrücke beim Weiherhäusl (nahe Neumühl) ein und schob
einen eleganten Waggon vor sich her, in welchem sich einige angesehene
Mitglieder des Vorstands der Ostbahngesellschaft befanden. Obwohl die Strecke
beim Weiherhäusl inzwischen mit Schienen belegt worden ist, stiegen die Herren,
da die Strecke bis zum Bahnhof noch nicht ohne Gefahr zu befahren war, vor der
Brücke aus und begaben sich zu Fuß hierher.
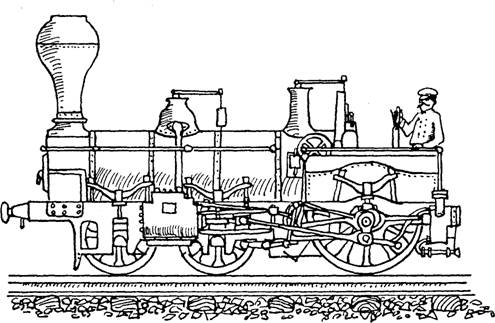
Lokomotive der Bayerischen Ostbahnen - gebaut 1857/58
bei Maffei in München.
Der Waggon wurde sodann durch Arbeiter zum Bahnhof
geschoben. Eine zweite Lokomotive war im Verlauf des Nachmittags von Schwandorf
her angekommen. Von dieser wurde obiger Waggon und die Reisegesellschaft nach
Regensburg weiterbefördert. Am 7. 12. 1859 berichtet das „Tagblatt“ aus
München. „Am 8. 12. 1859 sollen die Herren Vorstände der Ostbahn auf der
vollständigen Strecke von Regensburg über Amberg nach Nürnberg und am gleichen
Tag wieder zurück nach München fahren. Der ganze Bau ist jetzt in allen Teilen
vollkommen gelungen und, was die Hauptsache ist, er ist sehr wohlfeil und weit
unter den ersten Kostenanschlägen gebaut worden. Am 12. 12. 1859 findet die
eigentliche Eröffnung der Bahnstrecke statt.“
Beachtenswert findet Dollacker den Rückblick auf das Jahr
1859 in der Neujahrsausgabe 1860. Da heißt es: „Das abgelaufene Jahr ist seit
Dezennien das wichtigste für unsere Stadt gewesen. Das Wort Lokomotive, der
Name des Zauberrosses der weltbewegenden Dampfkraft, ist für uns nun kein leerer Begriff mehr. Am 8. 9. 1859
brauste die erste Lokomotive auf den uns mit der kaiserlichen Noris und der
ehrwürdigen Ratisbona im raschen Flug verbindenden Gleisen heran und brachte
die ersten Grüße einer neuen Zeit. ... Seit 12. September sehen wir nun
regelmäßig das Dampfross ankommen und abgehen. Waren und Menschen bringen und
fortnehmen auf den eisernen Linien, die nicht allein die Richtung für Handel
und industriellen Verkehr, sondern auch die Entwicklung des industriellen Fortschritts
und des Kulturlebens in hohem Grade bestimmen.
Die Stelle der Gärten, deren freundliches Grün die Baumgänge
der Allee mit dem Mariahilfberg verband, nimmt nun der Bahnhof ein mit seinen
Gebäuden

Auf der Wart in der jetzigen Bahnhofstraße. In der
Mitte der ehem. Gasthof vor dem Durchbruch der Stadtmauer zum Bahnhof. Links
das Bürgerspital, rechts steht jetzt ein Kaufhaus.
und Geleisen. Im Frühjahr wurde erst der Grund gelegt, in
Hiltersdorf und Neuricht brach man die Quader, und in wenigen Monaten war er
fertig.
Vom Bahnhof kann man jetzt in die Stadt hineinblicken,
allerdings nur über Mauertrümmer und Schutthalden abgerissener Gebäude. Der
Stadtmauerdurchbruch ist einer Bresche überaus ähnlich, und er ist wohl auch
eine solche, die von einer neuen Zeit in die beengenden Mauern und die beengten
Verhältnisse unserer Stadt gebrochen wurde.
Inzwischen arbeitet man bereits an der Brücke über den Stadtgraben,
und die Häuser an der Bahnhofstraße sind bereits geplant. Wir Amberger haben
für dieses neue Verkehrsmittel freilich auch unsere Opfer gebracht. Die herrliche
Allee wurde an ihrer schönsten Stelle unterbrochen und eine prachtvolle
Lindenreihe musste gefällt werden. Um die Gelder für die neue Straße
aufzubringen, sahen sich die Stadtväter gezwungen, den Malzaufschlag zu
erhöhen.
Aus allem, was er liest, spürt Dollacker, wie überglücklich
die Amberger 1860 waren, weil sie früher als jede andere Stadt der Oberpfalz
den Anschluss an das länderverbindende Schienennetz bekommen haben. Zwanzig
Jahre intensiver Bemühungen schienen 1859 belohnt zu werden. Amberg wurde sogar
Schnellzugstation. 1861 konnte die Linie Schwandorf-Furth i. W. eröffnet
werden. Unsere Stadt hatte davon einigen Nutzen.
Die weitere Entwicklung kennt Dollacker bereits. 1864/65
wurde die wichtige Strecke Schwandorf - Weiden - Mitterteich fertiggestellt,
gleichzeitig wurde die Strecke Weiden - Bayreuth befahrbar. Schwandorf und
Weiden sind seitdem die Eisenbahnknotenpunkte der Oberpfalz. Beide Orte verdanken
dieser Vorrangstellung sehr viel. Als dann 1875 die kürzere Verbindung Regensburg-Nürnberg
über Neumarkt fertig war, endete die Schnellzugzeit in Amberg. Die alte
Hauptstadt der Oberpfalz blieb abseits der Haupteisenbahnlinien.
Beim nächsten Stammtisch berichtet der General
zusammenfassend alles, was er gefunden hat. Schade, dass der Herr aus Bayreuth
nicht zuhören kann. Die Runde der Heimatgeschichtsfreunde meint, dass diese
ausgezeichnete Arbeit unbedingt
veröffentlicht werden muss. Herr Dollacker übergibt sie 1936 der
Heimatzeitschrift „Oberpfalz“. Nun kann jeder nachlesen, wie sich die Amberger
ab 1838 für den Eisenbahnbau eingesetzt haben, und wie sie leider ihre
Planungen nicht durchsetzen konnten.
Die Dampflokomotive von 1859 fuhr langsamer als unsere
Diesellokomotive, wie der damalige Fahrplan zeigt.
Regensburg ab Amberg
an Amberg ab Nürnberg an
05.16 07.55 08.01 10.50
12.46 15.14 15.20 17.54
17.12 20.54 17.40 21.50
Man vergleiche mit der Postkutsche! Die Extra-Eilpost
brauchte rund acht Stunden von Amberg nach Regensburg oder Nürnberg.
Bezahlt hat man 1860 für die einfache Fahrkarte
Amberg-Regensburg 171 Kreuzer in der 1. Klasse, 114 Kreuzer in der zweiten
Klasse und 75 Kreuzer in der 3. Klasse. Eine Postkutschenfahrt für diese
Strecke kostete dagegen 90 Kreuzer. Diese Preise sind vergleichsweise sehr
hoch, denn damals kosteten eine Maß Weizenbier 5 Kreuzer, ein Pfund
Ochsenfleisch 15 Kreuzer und ein Pfund Butter 24 Kreuzer.
In Amberg hat man sich weiterhin für neue Eisenbahnstrecken
eingesetzt. 1877 bemühte sich die Stadt
vergebens um eine Strecke Amberg – Velburg - Ingolstadt. 1879 drängte sie ohne
Erfolg auf den Bau einer Verbindung von Amberg nach Neumarkt. Erst 1905 wurde
die Lokalbahn Amberg - Kastl - Lauterhofen eröffnet. Vorher schon, 1898, war
nach neunjährigem Bemühen die Bahnlinie nach Schnaittenbach fertiggestellt
worden. Als letzte Strecke entstand zwischen 1908 und 1910 die Vilstalbahn nach
Schmidmühlen. So war Amberg wenigstens Knotenpunkt einiger Lokalbahnen
geworden.
Die Blütezeit der Eisenbahnen neigte sich ihrem Ende zu. Der
Automotor wurde immer stärkerer Konkurrent der Dampfkraft. Immer mehr
Personenautos befuhren die gut ausgebauten Straßen, immer mehr Güter wurden von
Lastwagen befördert. Der Personenverkehr auf der Bahnstrecke nach Lauterhofen
wurde 1962 eingestellt, 1972 begann man mit dem Abbau der Gleise. Nach
Schmidmühlen fuhr 1966 der letzte Personenzug und der Personenverkehr nach
Schnaittenbach wurde 1976 eingestellt. Dafür erreichte als neuer, schneller
Verkehrsträger die Autobahn 1976 den Amberger Raum. Rund 100 Jahre war der Eisenbahnzug
für Amberg das Hauptverkehrsmittel.
Ursprünglich gab es im Stadtgebiet Ambergs reichlich gutes,
fließendes Wasser. Sogar die Vils, unser Heimatfluss, führte noch im 19.
Jahrhundert reines, trinkbares Wasser. Ihr damals sprichwörtlicher Reichtum an
Fischen und besonders Krebsen ist dafür ein sicherer Beweis, dass sie damals gesund
war. Vilswasser konnte allen Ansprüchen genügen.
Dazu gab es noch einige kleine und größere Quellen in der
Altstadt. Unterhalb der Martinskirche entsprang nahe der Vils einst die
Rainerquelle. Heute ist sie verschüttet. Im Bereich des Klosters der Armen
Schulschwestern war die Quelle des Zollerbrunnens. 1601 verlegte man eine
Bleileitung von dieser Quelle durch die Vils zum Haus des Stoffhändlers Jonas
Geißel. Sie ist schon lange verschüttet und selbst die genaue Lage ist
unbekannt.
Einige Quellen befanden sich westlich des Fuchssteiners am
Westrand des Schlossgrabens. Ihr Wasser floss südlich des Turms am
Dr.-Sattler-Haus in die Vils. Friedrich I. ließ 1453 den tiefen und breiten
Schlossgraben anlegen, den diese Quellen füllten und der sogar mit Fischen
besetzt wurde. Im Zusammenhang mit dem Bau Schlossgraben 1 um 1900 hat man
diesen Weiher aufgefüllt.
Sehr stark ist noch immer die Fürstenquelle unterhalb der
Stadt. Sie ist aber jetzt ganz gefasst. Ihr Wasser versorgte einst den
Fürstenhof, daher ihr Name. Es floss durch einige Weiherlein, ehe es in die
Vils einmündete, die damals ihren Lauf weiter
östlich im Bereich des alten Dultplatzes hatte. Die Bewohner vom Fürstenhof
bzw. Wingershof holten hier ihren Wasserbedarf, daher der Name Fürstenquelle.
Das kleine Bächlein floss einst durch einige kleine Weiher zur Vils. Um 1850
versorgte die Quelle die Strafanstalt im Fürstenhof. Heute zeigt ein Eisenrohr,
aus dem ständig Wasser fließt, die einstige Quellenlage an. Ihr Wasser wird in
einigen Industriebetrieben verwendet und speist zudem einen kleinen künstlichen
Bach zwischen den Sportanlagen und beim Schanzl.
Zwei starke Quellen, beide hießen Lindenbrünnlein,
entspringen nahe der Stadt am südlichen Fuße des Mariahilfberges. Die stärkere und
ältere davon ist heute verschüttet und verrohrt. Ihre Brunnenstube war nahe der
jetzigen Fabrikstraße. Das Lindenbrünnerl am Fuße der Lindenallee läuft jetzt nur
ein kurzes Stück sichtbar.
Auch an den übrigen Abhängen des Mariahilfberges finden wir
an verschiedenen Stellen über der Lehmschicht des Ornatentons schwache
Quellaustritte, die vielfach nur am feuchten Grund feststellbar sind. Die
höchstgelegene Quelle ist das Kräuterbrünnerl am Mariahilfberg, das zudem kaum
verändert wurde.
Fast überall in der Altstadt erreicht man schon in geringer
Tiefe das Grundwasser. Erstaunlich ist, dass selbst bei St. Georg schon in fünf
Meter Tiefe Wasser ansteht.
Eine sehr starke Wasserader zieht von Westen kommend unter
dem Schrannenplatz Richtung Vils. Beim Bau der Turnhalle der Armen Schulschwestern
wurde 1983 wahrscheinlich dieser Wasserlauf angegraben, in kürzester Zeit war
die Baustelle überflutet und man musste starke Pumpen einsetzen. Unbekannt ist,
woher dieser unterirdische Wasserlauf kommt. Er scheint unter dem Vilsbett weiter
und tief unter dem einstigen Stadtgraben gen Osten zu fließen.
Schon beim Bau des neuen Vilsbetts gab es 1934
Schwierigkeiten wegen der Bodenbeschaffenheit in der ehemaligen Gärtnerei Zahn.
Das neue Vilsbett musste mit Betonwänden eingefasst werden, das Wasser wäre
sonst unterirdisch ins alte Bett gesickert. Der Bereich zwischen Paradiesgasse
und Viehmarkt hieß einst „Im Krötensee“. Man darf aus diesem Namen auf ein feuchtes
Gelände schließen.
Wer nahe an der Vils wohnte, holte sich seinen Wasserbedarf
aus dem Fluss. Selbst die Frau Pfalzgräfin ließ noch 1409 auf dem Umgang ihres
Hauses (jetzt Klösterl) einen Aufzug zum offenen Gang im ersten Stock
anbringen, damit man das Vilswasser leichter kübelweise in ihre Gemächer
schaffen konnte.
Es war nicht schwer, bei den gegebenen
Grundwasserverhältnissen Zieh- oder Schöpfbrunnen anzulegen. Mit Sicherheit
hatte jeder wohlhabende Bürger seinen eigenen Brunnen entweder im Hofraum oder
im Keller oder gar in der Küche. Es kam auch vor, dass zwei Nachbarn sich
gemeinsam einen Brunnen hatten bauen lassen und später die Unterhaltskosten
teilten. Schwaiger (um 1550) berichtet von 243 privaten Brunnen innerhalb der
Altstadt. Interessant ist, dass es sogar in der Martinskirche einen Schöpfbrunnen
gab.
Im lehmigen Grund war es nicht schwer, eine Zisterne
anzulegen, in welcher sich das Wasser von den Dachflächen sammeln konnte. Selbst
im Rathaushof wurde eine solche Anlage
1984 freigelegt.
So suchten die Gerber für ihr Gewerbe die Nähe des Flusses.
Unsere alte Lederergasse läuft parallel zur Vils, die Gerberwerkstätten waren
unmittelbar am Fluss. Hier wurden die Häute gewässert. Zwischen unserer
Fleischbankgasse und der Vils stand das alte Schlachthaus, und die Fleischbänke
grenzten unmittelbar an dieses Gebäude. Weitere Fleischbänke, (die Metzger hatten
grundsätzlich in ihren Wohnhäusern keine Verkaufsräume), befanden sich auf der
Brücke über den alten Stadtgraben nahe der Spitalkirche. Alles was beim
Schlachten abfiel, wurde in die Vils oder den Spitalgraben geworfen.
Auch die Tuchfärber hatten ihre Werkstätten entweder an der
Vils oder am alten Spitalgraben. Das Walfischhaus am alten Stadtgraben, das
einem Schwarzfärber gehört, ist beispielhaft für diese Platzwahl.
In der Fischgasse längs der Vils (heute heißt sie Schiffgasse)
wohnten sieben Fischer, die in festen Fischkästen im Fluss ihre Fische bis zum
Verkauf verwahrten.
Eine der ältesten Brauereien Ambergs befand sich am Mühlhof.
Sie konnte nicht nur ihren hohen Wasserbedarf aus dem Flusse decken, man hat
das Vilswasser auch zur Kühlung verwendet.
Die Blechzinner brauchten für Reinigung und Ablaugen der
Bleche viel Wasser. Die ersten Zinnereibetriebe standen am Schlossgraben.
Später verlegte man sie in das Rückgebäude des Anwesens Untere Nabburger Straße
5, das unmittelbar am alten Stadtgraben lag.
Der alte Spital- oder Münzgraben war bei Bränden in der
östlichen Stadthälfte von großer Bedeutung, da er meist weite Wege zur Vils
oder zu einem Brunnen ersparte. Dank verschiedener Stauvorrichtungen konnte man
Löschwasser dort lassen, wo man dem Brand am nächsten war.
Dass die Strömung der Vils innerhalb der Stadt zwei große
Mühlen, eine Walkmühle für die Lodenherstellung, eine Schleiferei und
schließlich die Münze bzw. die spätere Gewehrfabrik betrieb, sei wenigstens
erwähnt. Die Vils ermöglichte ferner als Verkehrsweg Ambergs Salz-, Erz- und
Eisenhandel.
Selbst in der reichen Stadt Amberg konnte sich nicht jeder
Bewohner einen eignen Brunnen leisten. Bei machen Häusern war wegen der
geringen Grundstücksgröße eine eigene
Wasserversorgung nicht möglich. Die Mehrzahl der rund 850 Amberger
Haushaltungen war ohne eigene Wasserstelle. Hier musste die Gemeinschaft der
Bürger, die Stadt, helfen.
 Um 1550 zählte Amberg 42 öffentliche Schöpf-
oder Ziehbrunnen, aus denen sich jedermann nach Belieben bedienen konnte. Die „Löffelgasse“
erinnert noch an einen solche Straßenbrunnen, an den „Löffelbrunnen“. Wahrscheinlich
diente hier eine große Kelle zum Wasserschöpfen. Ansonsten hatten alle diese
Brunnen eiserne Ketten und feste Kübel.
Um 1550 zählte Amberg 42 öffentliche Schöpf-
oder Ziehbrunnen, aus denen sich jedermann nach Belieben bedienen konnte. Die „Löffelgasse“
erinnert noch an einen solche Straßenbrunnen, an den „Löffelbrunnen“. Wahrscheinlich
diente hier eine große Kelle zum Wasserschöpfen. Ansonsten hatten alle diese
Brunnen eiserne Ketten und feste Kübel.
Wiltmaister hat für das 18. Jahrhundert 40 dieser Brunnen Örtlichkeiten
zugeordnet, wir können uns also ein Bild von der Verteilung dieser allgemeinen
Wasserstellen innerhalb der Altstadt machen.
1. Beginn der Georgenstraße, Abzweigung Fleischbankgasse.
2. Ecke Regierungsstraße / Zuckerbäckergasse
3. Im Hof der neuen Kanzlei, jetzt Landgericht
4. Im Hof der alten Kanzlei, jetzt Landgericht
5. Im Schlosshof
6. In der Steinhofgasse
7. In der Badgasse
8. Vor dem Zehentstadel in der oberen Neustift
9. In der unteren Neustift nahe dem Wingershofer Tor
10. Vor dem nördlichen Maltesergebäude
11. Am unteren Ende des Malteserplatzes
12. Am Rossmarkt
13. In der vorderen Langen Gasse
14. In der hinteren Langen Gasse
15. In der Paradiesgasse
16. In der Vilsstraße beim Vilstor
17. Auf dem Paradeplatz
18. In der Ziegelgasse, Nähe Ziegeltor
19. In der Ziegelgasse, Nähe Pestalozzischule
20. Am Eck Bahnhofstraße / Obere Nabburger Straße
21. Obere Nabburger Straße vor Nr. 9
22. Beim Nabburger Tor
23. In der oberen Hälfte der Unteren Nabburger Gasse
 24. In der unteren Hälfte der Unteren
Nabburger Gasse
24. In der unteren Hälfte der Unteren
Nabburger Gasse
25. In der Münzengasse
26. Auf dem Paulanerplatz
27. In der Rosengasse
28. Am Viehmarkt
29. In der Weinstraße
30. Beim Salesianerinnenkloster beim Mühlsteg
31., 32., 33. In den Höfen der Kasernen in der Herrnstraße und Kasernstraße
34. Obere Apothekergasse
35. In der Herrnstraße
36. Nördlich des Rathauses
37. In der Löffelbrunngasse
38. In der Schiffgasse
39. Im Zeughaus
40. Im Baustadel
Zu Schwaigers Zeit musste jeder Bürger im Vierteljahr 10
Pfennig für die Instandhaltung dieser Brunnen und den allgemeinen Wachdienst
entrichten, eine Zusammenstellung, die ungewöhnlich ist. Diese allgemeinen
Wasserstellen wurden demnach ständig überprüft und in gutem baulichen Zustand
erhalten. Da Wiltmeister nur 40 Brunnen anführt, Schwaiger aber 42 angibt, müssen
in der Zwischenzeit zwei Brunnen eingegangen sein. 1874 aber gab es 44
öffentliche Pump- und Schöpfbrunnen und dazu die fließenden Brunnen der
Lindenbrünnerlleitung.
Schon 1501 bekam Amberg eine Wasserleitung, die frisches Quellwasser
in die Stadt brachte. Man hatte das vordere Lindenbrünnerl in einer Brunnenstube
gefasst und in einer Leitung aus durchbohrten Kiefernstämmen floss das Wasser
in das kurfürstliche Schloss (jetzt Landratsamt). Eine Abzweigung vorm
Nabburgertor führte zu einem Brunnenbecken an der Nordseite der Martinskirche,
am Marktplatz und im Bürgerspital. Kurfürst Philipp ließ die nötigen Bäume aus
seinen Forsten holen.
Die Wasserleitung Ambergs ließen Kurfürst Philipp und der
Stadtrat gemeinsam verlegen. Sie war eine beachtliche Leistung. Man musste zum
Beispiel nicht nur den Stadtgraben unterqueren, dies geschah beim Nabburger Tor.
Man musste nahe der Stadtbrille auch durch die Vils. Der Brunnen am Marktplatz und
bei St. Martin standen ausschließlich der Allgemeinheit zur Verfügung, jener im
Spital wohl auch. Er war jedoch eine besondere Hilfe für diese sehr große
caritative Einrichtung, zu der eine eigene Brauerei gehörte. Das laufende
Wasser im Schloss war bis zu einem gewissen Grad Statussymbol des hohen
Landesherrn. Wasser scheint dort auch in die Küche und Metzgerei weitergeleitet
worden zu sein. Das Schloss war demnach das erste Wohngebäude mit fließendem
Wasser in Amberg. Beim Erweiterungsbau des Rathauses 1572/73 wurde ein Brunnen
im Innenhof, der jedermann und jederzeit zugängig war, an die städtische
Leitung angeschlossen.
Die Kiefernröhren hatten leider keine lange Haltbarkeit, und
länger als 10 Jahre waren sie nicht zu gebrauchen und mussten ersetzt werden.
Am 31. Mai 1576 verhandelten Kurfürst Ludwig VI. und der Stadtrat mit dem Regensburger
Glocken- und Büchsengießer Schultheiß wegen des Ersatzes der hölzernen Röhren
durch solche aus Blei. Man einigte sich. Der Regensburger goss in der Amberger
Glockengießerei das Rohrmaterial und  erneuerte das
gesamte Wasserleitungsnetz.
erneuerte das
gesamte Wasserleitungsnetz.
Er leistete gute Arbeit, denn über 325 Jahre waren keine
großen Reparaturen nötig. Erstaunlich ist, dass dieser tüchtige Glockengießer
weder lesen noch schreiben konnte. Sein Schwager musste für ihn unterschreiben.
Bleirohrleitung im Landratsamt.
Die neue Leitung lieferte
so reichlich Wasser, dass man es in weitere Räume des Schlosses leiten und
sogar noch zwei schöne Springbrunnen in den Schlossgärten anschließen konnte.
Ob das „Weißbierbrauhaus“ in der Oberen Nabburger Straße
(Nr. 9) bei seiner Gründung 1617 bereits eine Zuleitung erhielt, ist noch
zweifelhaft. In späteren Jahren floss auch hier Wasser vom Lindenbrünnerl.
Da 1644 das kurfürstliche Schloss nach einem Blitzschlag
völlig ausbrannte und anschließend mehr als 70 Jahre lang Ruine blieb, gingen
die dortigen Brunnenstellen ein.
Dafür bekam um 1670 der Pfarrhof St. Martin eine eigene
Zuleitung. Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde das städtische Salzhaus am Marktplatz,
an die Leitung angeschlossen. Vor dem Türkenwirt, der die jetzige Bahnhofstraße
auf der Höhe der Ziegelgasse abschloss, wurde ebenfalls ein fließender Brunnen
aufgebaut, und auch der Türkenwirt selbst durfte für seine Brauerei Wasser
abzweigen. Als 1695 die Salesianerinnen ihr Kloster erbaut hatten, ließ die
Stadt vom Pfarrbrunnwechsel ab durch die Lederergasse zum Mühlhof und durch die
Vils hindurch eine Leitung für die Klosterfrauen verlegen. Als 1762 die kurfürstliche
Münze in Amberg eingerichtet wurde, erhielt diese ebenfalls fließendes Wasser.
Aus den fließenden Brunnen in städtischen Gebäuden und auf
öffentlichen Plätzen konnte jedermann nach Bedarf Wasser holen. Von den
privaten Beziehern von Lindenbrünnerlwasser verlangte die Stadt einen
jährlichen Wasserzins. Diese erste Wasserleitung der Stadt blieb auch ihre
einzige. 1850 sind folgende Abnehmer und allgemeine Brunnen vermerkt: Drei
Häuser an der jetzigen Jahnstraße, der Nabburgertorbrunnen, das Weißbierbrauhaus
in der Oberen Nabburger Straße, der Türkenwirt, der Johannisbrunnen auf der
Wart, der Spitalbrunnen, die Gewehrfabrik (ehemals Kaufhaus Storg), der
Dechanthof, das Militärspital im ehemaligen Paulanerkloster und das Paulanerbrauhaus.
Es waren also einige Abnehmer seit 1762 hinzugekommen,
während die Leitung zum Salesianerinnenkloster aufgelassen worden war.
Alle öffentlichen fließenden Brunnen bestanden aus großen
Steinbecken in barocker Form, sie hatten hübsche Eisengitter und den
Johannisbrunnen schmückte eine Nepomukfigur, die jetzt in einer Nische des
Eckhauses Bahnhofstraße Obere Nabburger Straße steht. Ambergs Stadtbild hat
viel verloren, als diese Brunnen nach der Schaffung der zentralen Wasserversorgung
1893 beseitigt wurden. Als letzter verschwand der Brunnen hinterm Nabburgertor
um 1965.
Auch Brunnenstube, Überlauf und Lindenbaum beim vorderen Lindenbrünnerl
hat man inzwischen beseitigt. Nur das Gasthaus zum Lindenbrünnerl erinnerte
noch lange an die erste, alte Wasserleitung Ambergs. Einige Rohre aus Holz und
Blei, die bei Erdarbeiten gefunden wurden, sind im Heimatmuseum und bei den
Stadtwerken zu sehen.
Die Jesuiten, die ja nicht nur für Kloster und Garten,
sondern auch für ihre Schulen, ihr Schülerheim und besonders für ihre Brauerei
viel Wasser benötigten, schufen sich ab 1692 eine eigene Wasserversorgung. Am
Nordhang des Mariahilfbergs, an der so genannten Angerspitz, wo der
Brauneisenstein dem Opalinuston aufsitzt, ließen sie einige längere Stollen in
den Berghang treiben und diese ausmauern und einwölben. In zwei Brunnenstuben
wurde das Wasser, das in den Stollen zusammenfloss, in Holzröhren zum Schimmelbauernhof,
wo ja heute noch eine Quelle ist, und weiter den Triftweg abwärts geführt. Dies
war die hintere Leitung. Ähnlich verfuhren die Patres am Degelberg, unterhalb
der ehemaligen Haushaltungsschule. In mehreren Stollen sammelte man das Wasser,
dann floss dieses in Holzröhren zu einer Brunnenstube und lief weiter den
„Bergweg“ hinab, ebenfalls zum Triftweg, wo „Angerleitung“ und
„Deglbergleitung“ sich vereinten.
Durch den Kellerweg zog sich die Leitung weiter hin zum
Ziegeltor und am äußeren Stadtwall entlang bis zur Höhe der Oberen Mühle (jetzt
AZ). Hier verlief sie unter Stadtwall und Stadtgraben, beim Vilstor ging’s
durch die Vils und mit der Jesuitenfahrt stieg sie hinauf in das
Jesuitenkolleg.
Auch diese Anlage bestand ursprünglich nur aus durchbohrten
Kieferstämmen. Später hat man vom Vilstor ab Bleirohre verlegt. Trotz aller
Wasserverluste, bedingt durch die unzulängliche Abdichtung der
Röhrenverbindung, hatte diese Leitung noch einen so großen Druck, dass die
Patres in ihrem Garten 1762 einen imposanten Springbrunnen bauen konnten.
200 Jahre versorgte diese komplizierte Anlage das
Jesuitenkloster und später Malteserbrauerei und Studienseminar mit frischem
Quellwasser.
Reste von Brunnenstuben und Stollen finden wir unmittelbar
unterhalb der Haushaltungsschule und an der Angerspitze, nahe den großen
Wallanlagen für den einstigen Schützenplatz.
Die alte Brunnenstube am Fuße einer mächtigen Linde wurde
erst beim Ausbau des Lindenviertels beseitigt. Die moderne Sprudelanlage mit
verschiedenen Becken, aus welchen das Wasser quillt, erinnert noch an diese private
Wasserleitung.
Seit 1662, als der Mesner Kreukl sein Haus bei der
Marienkapelle bezog, und besonders ab 1696, als die Franziskaner ihr Hospiz auf
der Bergeshöhe errichteten, begannen die Bemühungen um Wasser für die
Bergbewohner. Man grub tiefe Brunnenschächte, der Erfolg war gering. Man war
letztlich immer wieder auf die kleine Quelle nordöstlich der Kirche angewiesen,
die entsprechend gefasst wurde und heute Kräuterbrünnerl heißt. Das hintere Lindenbrünnerl
war einst ein Hungerbrünnerl, das nur gelegentlich lief, dann aber nach aller
Überlieferung stets eine schlechte Ernte anzeigte. Als es 1750 ständig floss,
ließ der Gärtner Zottmeier auf eigene Kosten eine private Wasserleitung zu
seinem großen Garten bei der Dreifaltigkeitskapelle anlegen. Die Brunnenstube
ist noch gut erhalten. Der Name dieser Quelle erinnert übrigens noch an den
ersten Bergmesner, Sigmund Kreukl. Kreuklbrunnen hieß sie erst, aber mit dieser
Bezeichnung wusste man schon um 1800 nichts mehr anzufangen und verbesserte das
unverständliche „Kreukl“ zu „Kräuter“, eigentlich eine „Verböserung“. Man
staute ihr Wasser sogar zu einem kleinen Weiher, errichtete dazu eine
Waschbank, damit Kreukl und auch die Patres große Wäsche waschen konnten.
In Amberg schätzte man sich immer glücklich über die
reichliche und zuverlässige Versorgung mit Wasser. Seit der Anlage der Lindenbrünnerlleitung
im Jahre 1501 hatte sich jedoch keine wesentliche Verbesserung mehr ergeben,
wenn man vom Bau der Jesuitenleitung, mehr eine private Angelegenheit, absieht.
Man hatte fließendes Wasser, Privatbrunnen in jedem dritten Bürgerhaus und 40
öffentliche Schöpfbrunnen bzw. Pumpbrunnen. Es hatte niemand weit zu einer
Wasserstelle. Gerade dieses Grundwasser aber wurde immer mehr zu einer
Gefährdung der Bevölkerung. Immerhin lebten innerhalb der Stadtmauern zeitweise
bis zu 7000 Menschen, während es gegenwärtig kaum 2500 sind. Waren die Abortlagen
damals primitiv, so waren die Abortgruben eigentlich gemeingefährlich. Versitz-
oder Sickergruben waren’s, die bestenfalls gegen nahe Hauswände durch eine
Lehmaufschüttung etwas abisoliert waren. Das Mauerwerk wollte man schützen,
gegen das Versickern der Abwässer im Untergrund hatte man nichts. Und ausgeleert
wurden die Gruben nur dann, wenn es sich nicht mehr vermeiden ließ. Der
Schinder, der ohnehin als unehrlich galt, musste diese schlimme Arbeit
übernehmen. Nachts zog er mit seinen Gehilfen zur Arbeit, „Nachtkönig“ nannte
man ihn drum spöttisch, bezahlte ihn aber wesentlich besser als jeden
Handwerksmeister. Der Kostenaufwand war die Ursache, dass man diese Arbeiten
gerne aufschob.
Ein weiteres Problem war durch die Viehhaltung gegeben. Es
gab kaum ein Haus ohne Haustiere. Sogar im kleinwinzigen Ehhäusel befand sich
ein Stall, den eine Kuh freilich nur im Rückwärtsgang verlassen konnte, während
einige Ziegen gut Platz hatten. Der Amberger Stadtpfarrer dagegen hielt im 17. Jahrhundert
zeitweise 5 Pferde, 200 Schafe, 15 Schweine und 15 Rinder. So groß war der
Rinderbestand in Amberg, dass die Stadt zwei Stadthirten anstellen musste. Dem
Viehbestand entsprachen die Miststätten. Nur das Mauerwerk, nie aber der
Untergrund, war durch Lehm gelegentlich geschützt. Im Allgemeinen sollten die
Dungstätten alle 6 Monate geräumt werden.
Eine allgemeine Kanalisation gab es nicht. Zwar führten
einfache Kanäle das Abwasser von der Badgasse bzw. vom Schrannenplatz zur Vils,
doch viel davon versickerte zwischen den Bodenplatten auf diesen Strecken. Von
den meisten Häusern in Vilsnähe führten ferner kurze „Dollen“ (Kanäle) das Abwasser
von Ställen, Aborten und Arbeitsstätten zum Fluss. Ähnlich war es am alten
Stadtgraben, der auch Münz- oder Spitalgraben genannt wurde.
Dieser Spitalgraben führte zeitweise wenig Wasser, da er im
späten 17. Jahrhundert nur von einigen Wasserläufen, die aus der Kräuterwiese
kamen, gespeist wurde. Das sehr verschmutzte, langsam fließende Wasser gelangte
auch ins Grundwasser.
Unmöglich wurden diese Verhältnisse, als 1716 zwei Kasernen
an der Kasernstraße errichtet wurden, in denen zeitweise 2000 Soldaten untergebracht
wurden. Die kurfürstliche Regierung hatte, um Kosten zu sparen, auf die Anlage
von abisolierten Abortgruben verzichtet und die Aborte einfach über dem Spitalgraben
anfügen lassen. Es half nicht viel, dass man Vilswasser vorm Vilstor abzweigte,
um durch Öffnen eines Wehrs wenigstens zweimal in der Woche allen Unrat in die
Vils zu spülen.
Immer wieder kam es zu Klagen, dass bald in diesem, bald in
jenem Brunnen das Wasser einen üblen Geschmack habe. Man vermutete meist auch richtig,
dass eine nahe Miststätte oder eine Abortgrube die Ursache dieser Qualitatsverschlechterung
sei. Man hat daraufhin manchmal eine Miststätte verlegt, doch erforderlich war
dies nach den damaligen Rechtsverhältnissen nicht. Es genügte nach „Stadt
Amberger Brauch“ der Abstand von 5 Schritten zwischen Brunnen und Düngergrube.
Man hat z. B. beim Raseliushaus einen Brunnen gefunden, der gerade zwei Meter
vom Spitalgraben dieser Cloaka maxima Altambergs entfernt waren.
Man begnügte sich mit dem Ärger über das verunreinigte
Brunnenwasser und schimpfte über den „bösen Geschmack“. Dass dieses Wasser die
Ursache gefährlicher Krankheiten war, ahnte niemand. Manche verheerende Seuche
der Vergangenheit mag in der Wasserversorgung ihre Ursache gehabt haben. Doch
das wusste man lange nicht. Hatte ein Brunnen übles Wasser, ging man schimpfend
zu einem anderen, dessen Wasser man wohlschmeckend fand, das aber keineswegs gesünder
sein musste. Am Wasser der vom Lindenbrünnerl gespeisten Brunnen rühmte man den
Wohlgeschmack und die Frische und schloss aus diesen Eigenschaften auf seine Reinheit.
Sicher, das Wasser war tadellos, aber an die negativen Auswirkungen der ab 1576
verlegten Bleirohre dachte damals niemand.
Wie schwierig es war, im 19. Jahrhundert für eine wichtige
öffentliche Einrichtung die Wasserversorgung zu sichern, sei am Beispiel der
Wassernot im Amberger Krankenhaus gezeigt. Ersichtlich wird dabei ferner, dass
es selbst einer angesehenen und von viel Idealismus getragenen Stiftung nicht
möglich war, das Wasserproblem alleine zu lösen.
Die Krankenhausstiftung hatte dank der Opferbereitschaft
vieler Amberger 1848 das Marienkrankenhaus gebaut, das über 100 Kranke
aufnehmen konnte. Alle damals neuen Errungenschaften wollte man beim Bau berücksichtigen,
fließendes Wasser war daher eingeplant und Bleirohre zur Küche, zum Waschhaus
und in den Garten waren bereits beim Bau verlegt worden.
Man wollte vom städtischen Lindenbrünnerl her Wasser ins
Krankenhaus leiten, doch drei Bürger, die für ihre Häuser und Gärten das
Wasserbezugsrecht von der Stadt erworben hatten, erhoben Einspruch und, was wir
nicht verstehen, dieser wurde berücksichtigt. Das Krankenhaus war ohne Wasser.
1850 wurde das Krankenhaus eröffnet, und Tag für Tag hat man
das Trinkwasser für die Kranken von einem Brunnen in der Altstadt geholt,
während man Koch- und Waschwasser einer alten Zisterne im Krankenhausgarten
entnahm. Das ging bis zum Sommer 1851 gut, dann aber war die Zisterne leer. Inzwischen
war glücklicherweise beim Haus des Krankenhausgeistlichen ein Brunnen gegraben
worden, den die Schwestern benutzten durften. Doch nach einigen Wochen war auch
dieser erschöpft, und nunmehr musste alles Wasser, da die Zisterne auch leer
war, wiederum in mühsamer Arbeit aus der Stadt geholt werden.
Es musste etwas geschehen. Man ließ die Zisterne vertiefen,
dann wurde ein Graben von dieser Wassersammelstelle schräg den Berghang hinaufgeführt,
um das „bei Regengüssen reichlich herabschießend Wasser“ in die Zisterne zu
leiten. Der Brunnen eines Tagwerkerhäuschens, der bislang wegen einer nahen
Miststätte nicht gebraucht werden konnte, wurde gereinigt und die Miststätte
beseitigt. Damit glaubte man für einen Notfall genug getan zu haben.
Man wollte aber fließendes Quellwasser. Seit Mai 1851
forschte man am Berghang nach einer geeigneten Stelle für eine Brunnenstube.
Unmittelbar unterhalb der Bergkirche, im so genannten Eichelgarten, dem Gelände
der oberen Baumannvilla, fand man eine Lehmschicht und legte einen Stollen an.
Ende 1851 stellte man erfreut fest, dass seit Wochen klares
Wasser in Stärke eines Männerdaumens aus dem Stollen fließt. An Wasser war also
kein Mangel.
Gegen 3000 Gulden veranschlagte
die Krankenhausverwaltung für die Bleileitung zum Krankenhaus. Die
Gemeindebevollmächtigten der Stadt Amberg aber waren nicht bereit, diese Summe
aus der Stadtkammer auch nur vorzustrecken, ja, sie waren der Meinung, ein
anständiger Brunnen genüge vollauf. „Wenn allerdings die Krankenhausverwaltung
des Hauses diese Summe selbst aufbringen könne, dann könne sie auch eine
Wasserleitung legen lassen.“ Das wenigstens gestattete man großzügig.
Einsichtiger war hier das kg.
Bergamt, das sogleich einen tüchtigen Bergmann für die weiteren Arbeiten am
Stollen im Eichelgarten abstellte. Ein anderer Bergmann arbeitete unentgeltlich
in seiner Freizeit im Stollen mit. – Ob sich da die für das Wohl der Stadt zuständigen
Herrn Gemeindebevollmächtigten nicht doch ein wenig schämten?
Im Mai 1852 waren Brunnen und
Zisterne beim Krankenhaus wieder erschöpft. Der Krankenhausarzt Dr. Luckinger
konnte selbst für Krätzekranke keine Bäder mehr verordnen. – Droben im
Eichelgarten aber liefen pro Minute 6 ½ Liter aus der Brunnenstube, die in 10
Minuten eine Badewanne hätten füllen können.
Inzwischen war es der
Stiftungsverwaltung gelungen, Zuschüsse von anderen Stiftungen zu erhalten. Dem
Leitungsbau stand nichts mehr im Wege. Man stand vor der Frage: „Welche Rohre sind
am zweckmäßigsten“? Gegenüber Tonmaterial war man sehr misstrauisch. Das
Münchner Krankenhaus teilte mit, man habe Bleirohre und sei damit recht
zufrieden und habe bislang keinerlei Gesundheitsschädigungen feststellen
können. Das kg. Bauamt Amberg schlug Eisenrohre vor. Die Rostbildung hielt man
für belanglos, ja, man fand diese sogar günstig, da „eisenhaltiges Wasser
gesund sei“. Schwandorf aber hatte mit Eisenmaterial schlechte Erfahrungen
gemacht und erst kürzlich eine völlig verrostete Leitung durch die altbewährten
Kiefernstämme ersetzt. Man folgte dem Beispiel der Nachbarstadt, besonders, da
eine Holzleitung, wie man hoffte, auch weniger Kosten verursacht.
In drei Wochen war die Leitung im
Boden verlegt. Im Dezember 1852 sprudelte das Wasser im Garten und in der
Waschküche des Krankenhauses. Allerdings bekam man nur 4 ½ Liter in der Minute,
in der Küche im ersten Stock aber floss kein Tropfen. Der Wasserdruck war zu
gering. Wieder wurde im Eichelgarten gegraben. Im April 1854 konnten die
Schwestern voll Freude melden, dass nun auch in der Küche genug Wasser aus der
Leitung fließe. Nach 4 Jahren Wasserschleppen und Wasserfahren glaubte man die Misere
endlich behoben.
Dreieinhalb Jahre
ging’s gut, doch im Dezember 1857 versagte die Leitung. Froh war man, dass ein
verständnisvoller Nachbar seinen Brunnen für die Trinkwasserversorgung zur Verfügung
stellte. Koch-, Wasch- und Gießwasser konnten die Schwestern beim Krankenhauskuraten
holen. Für die drei Klosterfrauen begannen anstrengende Wochen. Sie hatten sich
ja nicht nur um die Kranken zu kümmern, auch die Küche, der Waschraum, der
Garten und der Einkauf war ausschließlich ihre Angelegenheit. 1858 war das
Krankenhaus mehr belegt als je vorher, da viele Arbeiter, die beim Bahnbau
beschäftigt waren, mit Prellungen, Quetschungen und Verletzungen eingeliefert
wurden. Kühlende Umschläge konnte Dr. Luckinger nur in Ausnahmefällen
verordnen.
Anfang Juni 1858 stellte
die Stadt den Schwestern einige Arbeiter für den Wassertransport zur Verfügung,
die nur für das Wasser zu sorgen hatten. Dies war umso notwendiger, da
inzwischen der Kuratenbrunnen ebenfalls erschöpft war.
1859 wurden auf
einer längeren Strecke die Holzrohre durch solche aus Blei ersetzt. Der
Wasserzulauf besserte sich und genügte wenigstens fürs Kochen und Trinken. Dr.
Luckinger bemühte sich in dieser Zeit um die Zuweisung des
Lindernbrünnerlwassers, das bislang der Türkenwirt hatte, für das Krankenhaus.
Beim Durchbruch der Straße zum Bahnhof hatte das Türkenwirtsanwesen abgelöst und
abgebrochen werden müssen. Sein Anrecht auf Wasser vom Lindenbrünnerl war an
die Stadt gekommen. Die „aufgeschlossene“ Stadtverwaltung ging auf diese
Anregung nicht ein. Die Leitung vom Eichelberg versagte ebenfalls.
Obwohl zwei
Bergleute den Stollen nochmal verlängerten, flossen im Krankenhaus gerade 0,75
l aus der Leitung. Nun wurden auch die letzten Holzrohre durch Bleirohre
ersetzt, und nun floss endlich wieder das Wasser in reichlichem Maß für einige
Monate.
Die Freude war kurz.
Im Februar 1860 schien die Leitung verhext. Einige Stunden lief das Wasser
normal, dann blieb es stundenlang aus, um anschließend mit ziemlichem Druck aus
der Leitung zu strömen. Es war kein Verlass mehr auf diese kostspielige Anlage.
Im Sommer 1860 lieferte sie 225 l in der Stunde, diese Menge genügte nicht.
Die
Wasserversorgung durch eine bequeme Leitung war also nicht möglich, man musste
es mit herkömmlichen Mitteln versuchen. Noch im September 1860 wurden drei
Bergleute eingesetzt, um nahe dem Krankenhaus einen Brunnen zu graben. Schon in
geringer Tiefe stieß man auf reichlich Wasser. Auf 290 Gulden waren die
Arbeiten gekommen, und die
Wassernot war nun endgültig vorbei. Man war nicht mehr von der unzuverlässigen
Leitung abhängig. Das Pumpen und Wasserschleppen blieb allerdings eine ziemliche
Belastung und 12 Jahre änderte sich nichts.
Damals war die
Situation so: Der Krankenhausbrunnen hatte stets reichlich Wasser, doch war
dieses Wasser nicht gut. Alles Trinkwasser musste von einem Nachbarn geholt werden,
der natürlich zu dieser Abgabe rechtlich nicht verpflichtet war, aber als
vernünftiger Bürger half. Reichlich Wasser stand auch stets in der Zisterne, die
Wasserleitung aber gab seit Weihnachten 1871 keinen Tropfen mehr. Man war zur
Erkenntnis gekommen, dass die Rohre nicht tief genug verlegt waren und deshalb
im Winter einfroren.
Im Februar 1872
bemühten sich Stadtverwaltung und Krankenhausverwaltung endlich gemeinsam um
den Erwerb der alten Jesuitenleitung, um nach 22 Jahren endlich eine arbeitssparende
und einwandfreie Wasserversorgung für das Marienspital zu sichern.
Die Malteserleitung
gab zuverlässig 8 bis 10 l in der Minute. Für 2750 Gulden war die Verwaltung
der Malteserbrauerei schließlich bereit, die Leitung zu verkaufen. Sie behielt
sich aber den Besitz der Bleirohre auf der Strecke zwischen Oberer Stadtmühle
und Brauerei vor.
Mit diesem Kauf war
der Wassermangel im Krankenhaus endlich beseitigt. Klagen sind nicht mehr
überliefert. Ganz ohne Brunnen und Zisterne kam man im Garten nicht aus. Den
Schwestern aber war trotzdem viel Zeitaufwand und Arbeit erspart.
Es sollte immerhin
noch 20 Jahre dauern, ehe für das Marienkrankenhaus Wasser in unbeschränkter
Menge bequem zur Verfügung stand.
Die rund 300 Privatbrunnen, die 44 öffentlichen Brunnen und
die Wasserleitung vom Lindenbrünnerl mussten noch im 19. Jahrhundert für die
Wasserversorgung Ambergs genügen, und von der erforderlichen Menge her genügten
sie auch. Die Verhältnisse in Amberg selbst aber änderten sich in dieser Zeit
in auffallender Weise. Die Bevölkerung wuchs von 5785 im Jahre 1800 auf 19141
im Jahre 1890. Die Altstadt war so dicht wie nie zuvor bewohnt. Über 7000
Menschen lebten innerhalb des Mauerrings, das Militär nicht eingerechnet. Die
Viehhaltung war sicher nicht zurückgegangen, waren doch bis 1892 zwei Eskadrons
Chevauxlegeres („Schwolische“) mit rund 400 Pferden in der Altstadt
untergebracht. Die Kanalisation aber blieb unverändert mangelhaft, das
Grundwasser im Stadtbereich war also schwerer als je vorher belastet.
Man nahm es als unabänderlich hin, dass der Typhus in Amberg
immer wieder auftrat. Schlimm wütete er zwischen 1809 und 1815, also in der
Zeit der napoleonischen Kriege. Sächsische, französische, österreichische und
russische Soldaten starben damals an dieser Krankheit in Amberg und viele Bürger.
Auch Dekan Gerner starb 1813 an Typhus, 1814 starben innerhalb von 12 Wochen
101 Amberger an dieser Seuche. Dass der Tod aus dem Grundwasser kam, ahnte man
kaum.
Während man beim Bau des Marienkrankenhauses (1847 -1850)
alles unternahm, freilich ohne Erfolg, um Quellwasser für diese Stiftung zu
beschaffen, begnügte man sich 1857 beim Bau der Steinhofkaserne (jetzt
Stadtbauamt) mit der Anlage von Pumpbrunnen, die übrigens von der Miststätte
für die rund 400 Pferde nicht sonderlich weit entfernt waren.
Ab 1857 brauchte die Ostbahngesellschaft für ihre
Lokomotiven Wasser. Sie begann mit dem Bau einer Leitung vom Schimmelbauern
(Ende Triftweg) zum Bahnhof. Gegen diese Maßnahme beschwerte sich die
Verwaltung der Malteserbrauerei, da sie eine Beeinträchtigung ihrer Leitung vom
Deglberg her befürchten musste. Die Ostbahngesellschaft gab daraufhin die
Arbeiten beim Schimmelbauern auf und legte mit Genehmigung der Stadt eine Leitung
vom Lindenbrünnerl zum Bahnhof.
Schlimm waren die hygienischen Verhältnisse im Zuchthaus.
Bis 1862 waren hier oft bis zu 500 Frauen zusammengepfercht, für die einige
Pumpbrunnen zur Verfügung standen. Die Sterblichkeit lag zeitweise bei 20 % und
mehr im Jahr. Als man nach 1862 die Anstalt für männliche Strafgefangene
umbaute, erhielt sie eine zentrale Wasserversorgung, an welche auch die
Wohngebäude der Bediensteten angeschlossen wurden. Am Ende der Trappstraße
wurde ein Hochbehälter erbaut. Das Wasser der Fürstenquelle musste Tag für Tag von
Häftlingen in diesen Behälter gepumpt werden, eine mühsame und schwere Arbeit.
In natürlichem Gefälle lief das Wasser dann in die verschiedenen Gebäude. So
war für Amberg die erste „Hochdruckwasserleitung“ geschaffen worden, die
allerdings „billig“ durch menschliche Arbeitskraft erst auf Hochdruck gebracht
werden musste.
Ab 1864 plante man den Bau einer neuen Infanteriekaserne (Kaiser-Willhelm-Kaserne).
Obwohl hier 1000 Mann untergebracht werden mussten, begnügte man sich mit Pumpbrunnen,
Plumpsklos und Versitzgruben.
Eine betriebseigene Wasserleitung ließ 1864 die Verwaltung der
Malteserbrauerei bzw. des kgl. Studienseminars zwischen Braustätte und Vils
verlegen. Eine Dampfmaschine pumpte Gebrauchswasser von der Vils zur Braustätte.
Die Leitung selbst verlief im Stadtgraben. Die Stadt musste versichern, dieses
Grabenstück nicht zu verfüllen und zu bebauen, damit man Reparaturen an den
Leitungsröhren jederzeit vornehmen könne. - Nur deshalb blieb das
Stadtmauerstück zwischen St. Georg und Vilstor weitgehend erhalten.
Für die Versorgung der Allgemeinheit mit einwandfreiem
Trinkwasser aber geschah nichts, obwohl inzwischen Dr. Pettenkofer den
Zusammenhang von verschmutztem Grundwasser und Typhus nachgewiesen hatte.
Erstmals wurde am 4. Juli 1872 in einer Sitzung der
Gemeindebevollmächtigten öffentlich erklärt, dass es in Amberg an sauberem
Wasser fehle. Das Wasser der Fürstenquelle wollte man in die Stadt leiten und
eine Dampfmaschine sollte für den nötigen Druck sorgen. Es blieb bei Erklärung
und Absicht.
1874 wurde das Wasser der 44 öffentlichen Brunnen
untersucht. Es ergab sich, dass nur von 6 Brunnen das Wasser als sehr gut und
von weiteren 6 als gut bezeichnet werden konnte. 10 hatten mittelmäßige
Qualitäten und 22, also die Hälfte, ganz schlechtes Wasser. Trotz dieses
schlimmen Befundes sollte es noch fast 20 Jahre dauern ehe Amberg einwandfreies
Wasser hatte.
1880 konnte die neue Lehrerbildungsanstalt eröffnet werden,
und sie hatte in den drei Stockwerken fließendes Wasser aus einem neuen
Brunnen. Eine im Nebenraum untergebrachte „Gaskraftmaschine“ betrieb die Pumpe.
Für Amberg ein Aufsehen erregender Fortschritt. Ansonsten gabs noch Plumpsklos
und Versitzgruben.
Probleme mit dem Wasser gab es nicht nur in der Altstadt.
Rings um Amberg wurde eifrig gebaut, denn die beginnende Industrialisierung
lockte viele in die Stadt. Bei jedem Neubau musste aber auch ein Brunnen
gegraben werden. Andererseits konnte man nur dort bauen, wo mit Sicherheit
Grundwasser erschlossen werden konnte. Für jeden Bauherrn wurden Wassersuche
und Brunnenbau zu einer teueren und aufregenden Angelegenheit.
Bedacht sei auch, dass bis 1893 in Amberg das Wasserpumpen
und Wasserschleppen eine Alltäglichkeit waren. Diese mühevollen, zeitraubenden
Arbeiten gehörten zum Tagesablauf. Am Waschtag mussten selbstverständlich 1½
bis 2 Zentner Wasser nur fürs Einweichen und Kochen herangeschleppt werden. Zum
Fleien ging man da gerne zur Vils auf eines der vielen Waschbänkchen. Jedem
Vollbad im heimischen Waschzuber ging ein anstrengendes Wassertragen voraus,
und zumeist musste das Badewasser noch für eine oder gar zwei weitere Personen
reichen. Baden daheim war mit viel Arbeit verbunden, und so kam es, dass ein
Vollbad häufig nur alle „heiligen Zeiten“ üblich war.
Ein alter Amberger aus der Kickstraße erzählte, dass im großen
Hausgarten seiner Eltern an heißen Tagen gegen 100 Kannen Wasser vergossen
wurden. 100 Kannen, das sind gegen 800 bis 1000 Liter Wasser im Gewicht von 800
bis 1000 kg, die da aus rund 6 m Tiefe heraufgepumpt und weggeschleppt werden
mussten.
Neidvoll schauten da die Amberger verständlicherweise nach
Sulzbach, wo schon ab 1875 die zentrale Wasserversorgung gut funktionierte, wo
eine Dampfmaschine das unentbehrliche Nass in jedes Haus und in jeden Garten
drückte und man unbedenklich und ohne Angst Wasser trinken konnte.
Seit 1830 arbeiten auf dem Erzberg zwei Dampfmaschinen,
übrigens die ersten Bayerns, und pumpen Wasser aus den Stollen. Schon 1859
fährt die erste Dampflokomotive durch Amberg, ab 1861 beleuchten Gaslaternen
nachts die Gassen und Straßen der Stadt, und 1882 wird erstmals ein
Schaufenster elektrisch beleuchtet. 1883 kann die moderne Hochofenanlage in
Betrieb genommen werden. Welch ein Fortschritt in dieser kurzen Zeitspanne!
1890 aber stehen noch immer jeden Morgen Männer und Frauen
in langen Reihen an den Brunnen, um in uralter Weise das Wasser für den Tagesbedarf
zu holen. Dass dieses Wasser nicht einwandfrei ist, weiß man inzwischen. Viele
bayerische Städte haben bereits ihre zentrale Wasserversorgung. Dort braucht
man den Typhus nicht mehr zu fürchten.
In Amberg aber plagt man sich mit Wasserpumpen und
Wasserschleppen und ist froh über jeden Sommer, der ohne gesteigerte
Thyphuserkrankungen vergeht. Seit fast 20 Jahren spricht man immer wieder von
einer Wasserleitung, finanzielle Überlegungen aber verhinderten bislang das
entscheidende Tun. – Die Typhusgefahr sollte schließlich den Bau einer modernen
Wasserversorgung erzwingen.
1890 erkranken wieder einige Bürger an dieser gefährlichen
Krankheit. Im Sommer 1891 weitet sie sich zur Epidemie aus und fordert erste
Opfer. Groß ist der Schrecken. Die Amberger Garnison begegnet dieser Gefahr,
indem sie vorzeitig ins Manöver zieht. Am 10. August rückte das 6. Regiment ab
und biwakiert bei Moosburg bis zum Beginn der Kaisermanöver um Indersdorf. Am
12. September kommen die Sechser zurück. Die Kavallerie hat bereits am 8.
August die Kasernen verlassen und rückt erst am 16. September wieder ein.
Das Wasser verschiedener Brunnen wird 1891 untersucht. Alle
Brunnen am Spitalgraben, auch der im Zeughaus, in den Kasernen am Spitalgraben,
erweisen sich als verseucht. Militärische Stellen drängen auf Beseitigung
dieser üblen Verhältnisse. Sie drohen sogar mit dem Abzug der Garnison. Ein Gutachten
des Bezirksarztes zur Amberger Wasserversorgung fällt alles andere als gut aus.
Die Regierung der Oberpfalz schaltet sich ein, und gedrängt von so vielen
Stellen beschließt die Stadtverwaltung am 23. März 1892 den Bau einer
Hochdruckwasserleitung. Man will also von einer hoch über dem Niveau Ambergs
entspringenden Quelle das Wasser in einen Wasserbehälter auf einer Anhöhe über der
Stadt leiten und von dort aus die Häuser mit Wasser versorgen. Fast bis zur
Höhenlage des Hochbehälters steigt dann das Wasser zu den Häusern durch
natürlichen Druck von selbst.
Schon im Mai überträgt man dem Ingenieur Kullmann von
Offenbach Planung und Bauaufsicht. Rasch sind die Verhandlungen über den Erwerb
umfangreicher Waldungen im Quellgebiet des Krumbachs abgeschlossen. Wenig
Schwierigkeiten bereitet die Ablösung der Wasserrechte der verschiedenen
Mühlenbesitzer, schließlich ist ja vorauszusehen, dass nach Inbetriebnahme der
Leitung der Krumbach nicht mehr genug Wasser für die Mühlen hat. Die Firma
Holzmann übernimmt die gesamten Bauarbeiten.
Die Notwendigkeit dieser umfangreichen und teuren Arbeiten
wird bald in drastischer Art bestätigt. Im Juli 1892 kommt es zu einem starken
Ansteigen der Typhusfälle.
Wieder rücken die Soldaten vorzeitig in das Manövergelände
um Schnabelwaid. Die Infanterie kommt nach 5 Wochen am 18. September zurück. Auf
die Chevauxlegers („Schwolische“), diese schmucken Reiter, warten in Amberger
vergebens. Man hat ihnen Bayreuth als Garnison zugewiesen. Gleich wird in
Amberg gemunkelt, dass dies nur wegen der miserablen Wasserverhältnisse erfolgt
sei. Zu diesem Zeitpunkt ist dieser Vorwurf unberechtigt, man ist bereits fest
am Arbeiten.
Die Quellen bei Urspring werden gefasst. Auf dem Nordhang
des Amberger Galgenbergs (446 m ü. d. M.) wird an einem großen Wasserbehälter
gearbeitet. Von der Höhe über der Ortschaft Steininglohe, wo die große Brunnenstube
entsteht, und dem Galgenberg bei Amberg wird ein Graben von gut 10 km
ausgehoben. Geländeeinschnitte bis zu 8 m Tiefe sind nötig, um ein annähernd
gleichmäßiges Gefälle zu
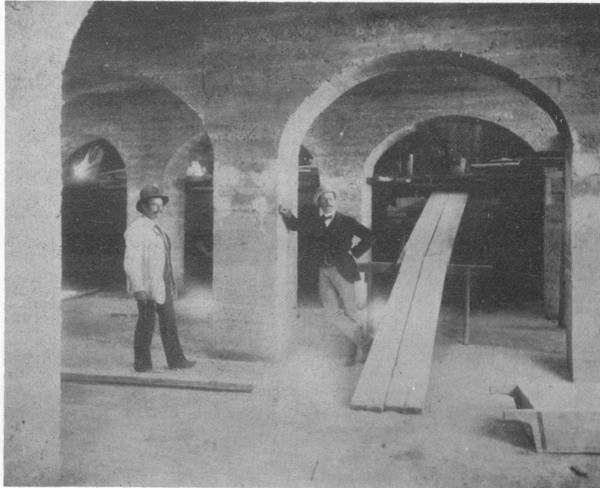
Wasserbehälter „Am Anger“ im Bau
 erreichen.
In drei Absätzen, muss an solchen Stellen der Graben eingetieft werden, und
gewaltige Wälle wachsen dann links und rechts des Grabens empor. Hunderte von
Arbeitern darunter viele Italiener, sind mit Pickel und Schaufel und
Schubkarren tätig. Endlich kann man die schweren Rohre aus Gusseisen verlegen.
erreichen.
In drei Absätzen, muss an solchen Stellen der Graben eingetieft werden, und
gewaltige Wälle wachsen dann links und rechts des Grabens empor. Hunderte von
Arbeitern darunter viele Italiener, sind mit Pickel und Schaufel und
Schubkarren tätig. Endlich kann man die schweren Rohre aus Gusseisen verlegen.
Gleichzeitig wird in Amberg allüberall die Erde aufgewühlt.
Zwei Leitungsstränge ziehen sich schließlich hinab zur Stadt. Einer quert die
Vils und kommt beim Vilstor in die Altstadt und versorgt die westliche
Stadthälfte. Der andere erreicht beim Ziegeltor die Altstadt und bringt das
Wasser in die Viertel links der Vils. Unmengen, insgesamt 22.500 laufende Meter
von Rohrstücken werden angeliefert und verlegt. Was niemand für möglich
gehalten hat, was auch uns unglaublich vorkommt, in 18 Monaten sind alle
Arbeiten, an die man sich Jahrzehnte nicht gewagt haben, vollendet. Sogar die
Kosten, 750.000 Goldmark kommen insgesamt zusammen, halten sich in recht erträglichen
Grenzen.
 Am 3. Oktober 1893 kann die
„Hochdruckwasserleitung Amberg“ in Betrieb genommen werden. Mit einem Festgottesdienst
in der Martinskirche beginnt der ereignisreiche Tag. Die Schulkinder ziehen
anschließend singend hinaus zum Hochbehälter. Gegen 11 Uhr erscheint dort der
Regierungspräsident von Ziegler aus Regensburg. Die Herren der Stadtverwaltung
und alle für den Bau Verantwortlichen finden sich ein, und dann werden die für
ein solches Ereignis als angemessen empfundenen Reden gehalten. Sodann öffnet
Herr Kullmann die Ventile und in breiten Fächern strömt aus drei Trichteröffnungen
das Wasser in den großen, unterirdischen Raum, der mit seinen Pfeilern und
Gewölben einer alten Kirche gleicht.
Am 3. Oktober 1893 kann die
„Hochdruckwasserleitung Amberg“ in Betrieb genommen werden. Mit einem Festgottesdienst
in der Martinskirche beginnt der ereignisreiche Tag. Die Schulkinder ziehen
anschließend singend hinaus zum Hochbehälter. Gegen 11 Uhr erscheint dort der
Regierungspräsident von Ziegler aus Regensburg. Die Herren der Stadtverwaltung
und alle für den Bau Verantwortlichen finden sich ein, und dann werden die für
ein solches Ereignis als angemessen empfundenen Reden gehalten. Sodann öffnet
Herr Kullmann die Ventile und in breiten Fächern strömt aus drei Trichteröffnungen
das Wasser in den großen, unterirdischen Raum, der mit seinen Pfeilern und
Gewölben einer alten Kirche gleicht.
Erstaunt betrachten die Festgäste vom Vorraum her das
einmalige Schauspiel. Bengalisches Licht lässt die Wasserkaskaden aufleuchten.
Fanfarenklänge vermischen sich mit dem Rauschen der Fluten.
Während man im Hochbehälter in feierlicher Weise die Leitung
ihrer Bestimmung übergibt,
Endlich fließendes Wasser!
warten unten in der Stadt die Bürger gespannt auf das
Wasser. Entsprechend den Anweisungen des Magistrats sind alle Wasserhähne
geöffnet. Gegen 11 Uhr 15 vernimmt man ein leises Pfeifen aus der Leitung, das
sich immer mehr steigert, bis endlich aus den Hähnen die ersten Tropfen spritzen.
Es gurgelt und rauscht in den Wasserrohren, und dann gischtet schäumend das
Wasser in die Becken. Nach 30 Minuten sind die Druckverhältnisse ausgeglichen
und gleichmäßig strömt es aus den Hähnen. Ein erstaunliches Bild!
Man denke! Da läuft Wasser durch eine 10 km lange Leitung
von selbst zum Hochbehälter am Anger. Ja, Amberg hat eben eine
Hochdruckleitung, denn die Urspringer Quellen befinden sich fast 80 m über dem
Amberger Marktplatz. Der Hochbehälter am Anger liegt noch so hoch, dass das
Wasser bis in die obersten Geschosse der Häuser in der Altstadt steigt und
ferner die meisten Gebäude in den neuen Stadtteilen erreicht.
Auch für jene Amberger, die an den Hängen des Maria-Hilfe-Bergs
wohnen, ja sogar für die Franziskaner droben bei der Kirche, die mit dem Wasser
stets ihre Not hatten, beginnt etwas später eine bessere Zeit. Auf dem höchsten
Gipfel des Berges ist ein kleinerer Wasserbehälter gebaut worden. Drunten, beim
Krankenhaus steht eine Pumpstation, die mit Stadtgas betrieben wird und die
durch einen Röhrenstrang und einer elektrischen
Leitung mit dem Hochbehälter verbunden ist. Sinkt droben das Wasser unter eine
bestimmt Marke, schaltet unten die elektrische Leitung automatisch die Pumpe
ein. Ist der Behälter gefüllt, beendet die Pumpe auf einen elektrischen Impuls
hin ihre Arbeit. Alles geht bei der Amberger Wasserversorgung von selbst,
eigentlich braucht kein Mensch mehr einen Finger zu rühren. Eine wunderbare
Einrichtung, das bestätigen alle, eine billige außerdem.
Die Bürger können es kaum fassen. Das Pumpen und
Wasserschleppen hat ein Ende. Zeit hat man plötzlich, weil man ja nur an einem
Hahn drehen braucht, um klares und frisches Wasser im Topf oder im Eimer zu
haben. Und gesundes Wasser! Niemand wird sich aus dieser städtischen Leitung
den Typhus holen. Fröhlich feiert die Bürgerschaft, und ihre Freude war selten
so berechtigt.
Auch wir, die Ur-, und Ururenkel jener, die 1893 diese
Leitung gebaut haben, sind noch Nutznießer jener Anlage. Noch immer fließt das
Wasser ohne jeden zusätzlichen Energieaufwand von Steininglohe zum Behälter am
Anger, ja, es fließt sogar noch durch die über 100 Jahre alten Rohre. Selbst
der Hochbehälter mit dem Amberger Wappen steht noch unverändert am Anger. Rund
50 Millionen Kubikmeter Wasser waren schon 1984 durch diese Wasserleitung
geströmt.
Bis 1917 genügte die Steiningloher Leitung allen Ansprüchen,
doch seit 1893 war der Wasserbedarf gestiegen. Das „Wasserwerk II“, das damals
bei Lengenlohe geschaffen wurde, lief allerdings nicht mehr von alleine. Aus
zwei Tiefbrunnen förderten elektrische Pumpen das Wasser, das im Gegensatz zu
dem von Steininglohe sehr kalkhaltig war.
1919 betrug der Zulauf aus dem Urspringer Quellgebiet rund
500.000 m³, bei Lengenlohe förderte man gegen 130.000 m³ Wasser. Das
Leitungsnetz im Stadtgebiet betrug damals 34.800 m. Bis zur Erschließung der
Tiefbrunnen bei Paulsdorf / Hiltersdorf im Jahre 1965 deckte die
Hochdruckleitung von 1893 den größten Teil des Wasserbedarfs unserer Stadt.
Gegenwärtig liefert die alte Hochdruckleitung immerhin noch rund ein Drittel
des kostbaren Wassers, das Amberg verbraucht.
Im Pfarrfriedhof Kümmersbruck überragt ein großer, massiger
Steinobelisk, der ungefähr in der Mitte des älteren Gräberfeldes steht die
Reihung der Grabsteine. Die Jahreszahl 1914/18 stellt den Zusammenhang zum
ersten Weltkrieg her, die französischen Namen und russischen Schriftzeichen genügen,
um hier ein Denkmal für verstorbene Kriegsgefangene zu vermuten. Die
Verhältnisse, in denen dieses Denkmal entstand, sind allerdings fast völlig in
Vergessenheit geraten.

Nach dem 1. August 1914 stand nahezu ganz Europa unter den
Gesetzen des Krieges. Noch bevor in Amberg die ersten Siegesmeldungen aus Frankreich
bejubelt werden konnten, wurde die Luitpoldschule entsprechend bestehender
Planung in ein Lazarett umgewandelt. Die Leopoldkaserne, an der seit 1913 mit
Nachdruck gebaut wurde, sollte im November 1914 bezugsfertig sein. Das
königlich-bayerische Feldartillerieregiment Nr. 13 wartete in Grafenwöhr
bereits auf den Einzug in diese damals schönste und modernste Kaserne Bayerns.
Doch dazu kam es nicht, denn mit Kriegsbeginn wurde das Regiment in Frankreich
eingesetzt. Dafür konnte man in einigen der fertigen Kasernengebäuden gefangene
Franzosen unterbringen, bis das für diesen Zweck ebenfalls schon geplante
Barackenlager bei Kümmersbruck aufgebaut war.

Barackenlager nördlich von Kümmersbruck
Am 28. August kam der erste Transport gefangener Franzosen,
insgesamt 473 Mann, darunter 10 Schwerverwundete. Obwohl der Zug erst gegen Mitternacht
am Bahnhof ausgeladen wurde, hatte sich eine große Anzahl Neugieriger
eingefunden, besonders um die 365 Kolonialsoldaten zu sehen. Die Verwundeten
wurden mit Autos in die Luitpoldschule gebracht, die übrigen marschierten zur
Leopoldkaserne, wo man ihnen zum Empfang Tee und Brot reichte. – Sie wurden
sogleich beim Aufbau des Barackenlagers eingesetzt.
Laut Zeitungsbericht der Volkszeitung – jetzt AZ – benahm
sich das „Publikum würdig“. Man hatte schließlich das Volk auf dieses Ereignis
schon obrigkeitlich vorbereitet. So wurde fünf Tage vorher schon amtlicherseits
erwartet, „dass niemand von Ambergs Bevölkerung den Gefangenen gegenüber
vergessen möge, was er seiner eigenen Selbstachtung und der Würde des deutschen
Volkes schuldig ist. Liebesgaben sind den Gefangenen gegenüber unangebracht.
Man möge aber daran denken, dass es sich um Soldaten handle, die im Dienst
ihres Vaterlandes ehrlich gekämpft haben. Ernstes Schweigen und Vermeidung jeglichen
Drängens ist das einzig angemessene Verhalten.“
Nun wusste es jeder.
Ganz so distanziert wie es ich die Obrigkeit wünschte blieb
aber das Verhalten der Amberger nicht. Schon am 1. September schrieb die
Volkszeitung einen fast freundlichen Artikel „Aus unserer Franzosenkaserne“.
Von den Zeitungsleuten wurden Aussagen von Gefangenen wiedergegeben, welche die
deutsch-bayerische Tüchtigkeit und Tapferkeit eindeutig bestätigten. Da soll
ein Franzose gesagt haben: „Wenn unsere Kameraden wüssten, wie gut wir hier in
Deutschland behandelt werden, würde unser ganzes Regiment die Hände hochheben
und sich ergeben.“ Ein anderer: „Die Deutschen
kämpfen wie besessen.“ Und schließlich: „Preußen verdammt gut, Bayern verdammterer
gut.“ – Ähnliches konnte man in der Folgezeit noch öfter lesen, die Leute
lasens gern und die Zeitungen brachtens „gernerer“.
Bemerkenswert ist die Geschichte eines Gefangenen, eines
geborenen Nürnbergers. Seine Eltern waren kurz nach seiner Geburt nach
Frankreich gezogen und hatten die französische Staatsbürgerschaft erworben.
Ihren Sohn aber schickten sie mit 12 Jahren wieder nach Nürnberg, wo er später
das Uhrmacherhandwerk erlernte. Er dürfte dort bei Verwandten untergekommen
sein. Seinen Wehrdienst leistete er in Frankreich ab. Im Mai 1914 wurde er zu
einer Reserveübung nach Belfort einberufen. An Krieg dachte damals niemand.
Schon im August kam sein Regiment an die Front und kurz darauf war er als
Gefangener in Amberg.
Verwundetentransporte brachten in der Folgezeit immer wieder
verwundete Franzosen nach Amberg, die wie die deutschen Verwundeten ins Marienkrankenhaus,
ins Reservekrankenhaus Luitpoldschule oder ins Militärlazarett im alten
Paulanerkloster eingeliefert wurden.

Verwundete
Gefangene in der Luitpoldschule
In Nürnberg war man allerdings gar nicht mit der Art und
Weise einverstanden, mit der die Amberger ihre Franzosen behandelten. Das
„Einvernehmen geht viel zu weit“, besonders wenn „bessere Weibsen ihr
mildtätiges Herz in Form von Zigarren und Zigaretten auf die Gefangenen
ausgießen“. – Man stelle sich so was bildlich vor! In Amberg wusste man von
solchen Herzensergüssen nichts. Dann beschwerte sich der Nürnberger Kritikus
konkret, denn man bringt in Amberg verletzte Franzosen mit dem Auto ins
Lazarett, während deutsche Verwundete zu Fuß gehen müssen.“ In Amberg verwahrte
man sich gegen diese Unterstellung. Man habe alle Verwundeten ohne Rücksicht auf
ihre Nationalität gleich behandelt und sich bemüht die schwersten Fälle
schnellstens in die Lazarette zu schaffen. – Am 10. September wurde der erste
hier verstorbene Franzose im Katharinenfriedhof beerdigt.
Am 16. September berichtet die Volkszeitung erstmals von dem
Lager bei Kümmersbruck, an dem bereits "seit längerer Zeit" gebaut
wurde. Russische Kriegsgefangene sollten hier untergebracht werden. „Die
Arbeiten waren bereits weit fortgeschritten, da kam heute ganz unerwartet der
Befehl, dass die Baracken für die Russen nicht am vorbestimmten Platz nahe
Kümmersbruck, sondern in unmittelbarer Nähe der Kaserne auf dem Gelände des
Artilleriedepots gebaut werden müssen. Die Zeitung vermutete, dass mögliche Seuchengefahr
für die Ortschaft der Grund dieser Verlegung sei, doch glaubte man auch, dass
das Wasser des Krumbachs, das man in Gräben durchs Lager leiten wollte, trotz
Filterung nicht hygienisch einwandfrei befunden wurde….“ Man benutzte daher die
Wasserleitung der Kaserne und verlängerte sie ins vorgesehene Lager, das Mitte
Oktober aufnahmebereit war.
Das neue Lager sollte jedoch einen ganz anderen
Personenkreis, an den niemand gedacht hatte, aufnehmen. Am 23. Oktober war zu
lesen: „Gestern Nachmittag konnten wir den Krieg von einer besonders traurigen
Seite kennen lernen. Gegen 17 Uhr kam ein langer Zug französischer Schutzgefangener,
ungefähr 450 bis 500 Frauen dazu, Kinder und Greise, im Ganzen ca. 740
Personen. „Sie stammen aus Dörfern zwischen Toul und Verdun, die bei den
letzten Kämpfen vollständig zerstört wurden. Die Bewohner flüchteten und
stießen auf deutsche Truppen, bei denen sie Hilfe und Schutz suchten. Als arme
Flüchtlinge, nur mit wenig gerettetem Gut bepackt, sind sie nach Amberg
transportiert worden. Ähnliches erlebten wir im Krieg 1870/71 nicht.“ Die
Zeitungsleute fühlten sich bei diesem Anblick an Szenen in Goethes „Hermann und
Dorothea“ erinnert.

Russische Soldaten
„Halb Amberg strömte in der Bahnhofsgegend zusammen, um das
traurige Bild zu betrachten. Ein starkes Militäraufgebot hatte Mühe, den Weg zu
den Baracken frei zu halten. Es dauerte lange, bis die Gruppe der Flüchtlinge
marschfertig war. Sie schleppten Betten, Körbe, etwas Hausrat, kurz ihren
letzten Besitz mit sich. Einige steinalte Mütterchen mussten zu den bereitstehenden
Autos geführt werden. Von den vielen Kindern waren die meisten ohne
Kopfbedeckung. Einige waren ohne Eltern. Soldaten führten sie, Soldaten trugen
auch Gepäckstücke, schoben Kinderwägen und halfen, wo es nur ging. Eine alte
Frau trugen sie auf einem untergelegten Gewehr. Zwei Priester befanden sich
auch unter den Flüchtlingen.“
„Man hörte vielfach, und sicher mit Recht, Stimmen des
Mitleids, besonders mit den bedauernswerten Kindern, die ein raues Geschick in
so jugendlichem Alter von der Stätte ihrer Wiege riss. Einige gebrechliche
Personen wurden von der Sanitätskolonne auf Tragbahren zu ihrem Bestimmungsort
bei der Leopoldkaserne gebracht.“
In den folgenden Tagen kamen weitere Schutzgefangene nach
Amberg. Sie müssen alle „Schreckliches mitgemacht“ haben, denn „alle sind nun
mit ihrem Los verhältnismäßig zufrieden, alle sind froh, dass sie in guter
Pflege und Obhut sind“.
Insgesamt waren am 30. Oktober 1914 neben 757 französischen
Soldaten 874 Zivilisten beiderlei Geschlechts, darunter 259 Kinder im
Barackenlager untergebracht. Jedes Alter war vertreten, vom Säugling bis zum
Greis. Einige Frauen standen kurz vor der Entbindung, und eine kleine Französin
hat bereits am 28.10. in Amberg das Licht der Welt erblickt. Trotz der eigenen
Sorgen und des Kriegselends – das Amberger Regiment hatte bereits verlustreiche
Kämpfe in Frankreich hinter sich, und die ersten Verlustlisten hatten in der
Stadt Trauer und Leid verbreitet – hatte man in Amberg ehrliches Mitgefühl
angesichts dieser vom Krieg vertriebenen Franzosen. Ein Aufruf zeigt dies:
„Besonders sind die im zartesten Alter stehenden Kinder betroffen, sie bieten
ein Bild menschlichen Elends. Die Schutzgefangenen sind nur mit dem Allernötigsten
versehen. Bei der Unzulänglichkeit der zur Verfügung stehenden Räume und bei
den ungünstigen Witterungseinflüssen, sowie bei dem fast gänzlichen Mangel an
warmer Kleidung, reichen die staatlichen Mittel nicht zur Abhilfe aus.“ Man
appelierte daher an die „rühmlichst bekannte Mildtätigkeit aller Bürger“, man
bat um „Kinderhemden, Wollstrümpfe, Jacken, Schuhe, Bettwäsche usw., um die
größte Not zu lindern“. Dieser Aufruf löste eine großzügige Spendenaktion aus,
und beim Bezirkskommando, Herrnstraße 50 häuften sich die Gaben.
Angesichts der vielen Kinder und Jugendlichen bemühten sich
zwei französische Lehrerinnen und die zwei Priester um die Errichtung einer
Lagerschule. Der deutsche Lagerkommandant tat, was ihm möglich war. Zwei
größere Barackenräume wurden zu
Schulsälen, man kümmerte sich um die behelfsmäßige Möblierung und sorgte für
den Schulbedarf.
Ein Beschluss des Magistrats vom 2. September 1914 hatte den
Katharinenfriedhof zum Begräbnisplatz verstorbener Franzosen bestimmt. Zu
Allerseelen 1914 waren dort bereits 9 Franzosengräber mit Blumen und Kränzen
schön geschmückt. Bereits einen Tag nach der Ankunft in Amberg war am 23. Oktober
die 68jährige Maria Massin verstorben.
Es war sicher der Wunsch der Zivilfranzosen, dass ihre Toten
im nahe gelegenen Friedhof Kümmersbruck beerdigt werden. Man kam diesem Wunsch
nach, und bald reihte sich dort Hügel an Hügel. Am 29.11. schrieb die Volkszeitung:
„Im Laufe der letzten Woche wurden aus den Reihen der französischen Schutzgefangenen
bzw. Kriegsgefangenen, die in den Baracken bei Kümmersbruck untergebracht sind,
nicht weniger als 5 Erwachsene und ein Kind im Kümmersbrucker Friedhof
beerdigt. Zwei weitere Todesfälle sind eben aus dem Lager gemeldet worden. Der
Kümmersbrucker Friedhof ist zu klein. Als Todesursache ist bei den verstorbenen
Franzosen neben der Altersschwäche besonders das ungewohnte Klima anzusehen.
Man sieht dem Winter mit großen Befürchtungen entgegen.“
Diese Befürchtungen erwiesen sich als berechtigt. 27
Sterbefälle wurden im Januar 1915 verzeichnet. Insgesamt starben 60
französische Zivilisten im Lager, darunter vier Kinder. Da starb Olga Gagmeur,
geboren in Amberg, am 18. November 1914 im Alter von 10 Tagen. Am Heiligen
Abend wurde Louise Vejoux geboren, um noch am gleichen Tag zu sterben. Auch
Yvonne Sauce starb noch am Tag ihrer Geburt am 2.1.1915. Maria Mangin war mit
87 Jahren die älteste Französin, die in Kümmersbruck bestattet wurde. Als
letzter Zivilist des Lagers starb Petit Adolphé am 26. März 1915. – Im April
konnte das Zivilgefangenenlager schon aufgelöst werden. Kinder, Frauen und
Greise waren über die Schweiz in ihr Vaterland zurückgekehrt.

Beerdigung in
Kümmersbruck
Im ersten Weltkrieg war es noch selbstverständlich auf
Zivilisten größte Rücksicht zu nehmen. So hat man von deutscher Seite sehr bald
über die Schweiz mit Frankreich wegen der in Amberg untergebrachten Frauen, Männer
und Kinder aus umkämpften und zerstörten ostfranzösischen Dörfern verhandelt.
Ehe diese Schutzgefangenen Amberg verließen, baten sie ihre im Lager
verbliebenen Landsleute und den Lagerkommandanten, ihren in Amberg begrabenen
Angehörigen und Freunden einen Gedenkstein zu schaffen.
Noch 1915 errichten tüchtige französische Steinmetzen den
großen Gedenkobelisken. Eingemeißelt sind an der Westseite die Namen der 60 im
Lager verstorbenen Zivilpersonen, von denen 8 im Katharinenfriedhof und 52 in
Kümmersbruck beerdigt wurden. Der Abschiedsgruß der 1915 nach Frankreich Heimkehrenden
lautet sinngemäß: „Euch, Greisen, Frauen und Kindern, die ihr fern der Eueren
im letzten Schlafe liegt, entbieten wir Euere Schicksalsgefährten, ein letztes
Adieu.

Arbeiten am Gedenkstein
Nachdem die Zivilgefangenen das Lager verlassen hatten,
wurden russische Kriegsgefangene nach Amberg gebracht. Mit ihnen kam
anscheinend auch ein orthodoxer Priester. Für die polnisch sprechenden, meist
katholischen Soldaten des Zaren übernahm Pfarrer Kuttosovsky aus Lemberg,
damals Benefiziat auf Schloss Eck die religiöse Betreuung.
Mit den Zivilgefangenen hatten auch deren Seelsorger Amberg
verlassen. Nun übernahm Stadtpfarrer Wagner von St. Martin mit seinen Kaplänen
die priesterlichen Aufgaben bei den Franzosen.
Das Lager war für rund 5.000 Gefangene vorgesehen, und diese
Zahl dürfte erreicht worden sein. Noch 1915 musste der kleine Dorffriedhof
Kümmersbruck vergrößert werden. Kriegsgefangene leisteten die Hauptarbeit für
dieses neue, gen Westen anschließende Gräberfeld. Auf 16.000 Mark kam diese
Baumaßnahme und die Militärverwaltung beteiligte sich an den Kosten entsprechend
dem Anteil der Gefangenengräber. - Im August 1916 erklärte das Königreich
Italien dem Kaiserreich Deutschland den Krieg. 1917 dürften die ersten
italienischen Gefangenen gekommen sein.
Zwar liegen in Amberg keine Beschreibungen und Berichte über
das Gefangenenlager vor, doch können wir uns gut ein Bild von dessen
Einrichtung und dem Lageralltag machen, denn unter den französischen Gefangenen
war ein Fotograf, der als Lagerfotograf mit zwei Gehilfen anscheinend sehr beschäftigt
war. Der Lagerkommandant hatte ihm die Einrichtung eines leistungsfähigen
Fotolabors ermöglicht, und 1916 konnte der tüchtige Meister aus seinem
reichlichen Bildmaterial 60 Aufnahmen auswählen und ein recht aufschlussreiches
Album zusammenstellen. Knapp sind die Bildunterschriften in deutscher,
französischer und russischer Sprache. – Und dieses Album ist die Hauptquelle
unseres Berichts, und eine Reihe von Fotos vergegenwärtigt und veranschaulicht
uns heute jene Zeit.

Der Lagerfotograf
Verständlich, dass für die Gefangenen Kochen und Verpflegung
besonderen Rang hatten, und der Fotomeister war sicher auch dieser Meinung,
denn 12 seiner Bilder zeigen Kochstellen und Speisende. Erstaunt ist man über
die anfangs recht primitiven Kochstellen, die sich von einem Lagerfeuer der
Pfadfinder kaum unterscheiden. Eine Besonderheit und ein Fortschritt war dann
der Kochgraben. Die Köche standen in einem gut 1 m tiefen Graben vor der
offenen Feuerstelle, die am Grabenrand eingetieft war. Der Erdaushub bildete
wahrscheinlich einen gewissen Windschutz.

Kochgraben
Einfache kleine Herde wurden bald geliefert, also stationäre
„Gulaschkanonen“. Der Kochgraben wurde breiter. Die Feuerstellen waren mit
Ofenrohren versehen und durch Schutzschilde gegen Niederschläge von oben
geschützt, also eine „Batteriestellung von Gulaschkanonen“. Natürlich gab es
bald Gemeinschaftsverpflegung, wahrscheinlich aus der Großküche der Leopoldkaserne.
Erfreulicherweise hat es den meisten Gefangenen nicht an Fresspaketen ihrer
Angehörigen gefehlt, und es wurde daher auch in den Baracken fest gekocht.


Fresspaketempfang
Wer über Geld verfügte, Geldüberweisungen waren möglich, konnte
in der Lagerkantine einkaufen. Würste, Bier, Wein und Brot wurden angeboten.
Das Foto zeigt aber auch Emailtöpfe, Pfannen, Schüsseln und Geschirr. 6 Mann
umfasste das Kantinenpersonal. Die Leitung hatte ein bayerischer,
wahrscheinlich kaufmännisch vorgebildeter Landwehrmann. Auf einer Preistafel
sind über 50 Artikel aufgeführt.


Gulaschkanonen
im Kochgraben

Lagerkantine
Wurden die Gefangenen in Dörfern für Arbeiten bei Bauern
eingesetzt, lernten sie zumindest auch die oberpfälzische Küche kennen. Dunkles
Roggenbrot, Bauernseufzer, Knödel und Kartoffelsuppe entsprachen zwar nicht dem
französischen Geschmack, und waren ein ungewohntes Mahl, aber satt wurde jeder.
Das Bier hat allerdings für die Franzosen den Wein ersetzen müssen, und der
Gerstensaft hat so viele neue Freunde gefunden. Allgemein waren die
Kriegsgefangenen nicht schlechter versorgt mit Lebensmitteln als die Zivilbevölkerung.
Auf den Bildern des Albums sieht man keine unterernährten Personen, wie man
leicht nachprüfen kann.
Die Unterbringung so vieler Menschen in Holzbaracken mit
wenig Waschgelegenheiten und primitiven Abortanlagen steigerte sicher die
Gefahr von ansteckenden Krankheiten, wie Grippe und Typhus und Cholera. Die
ärztliche Betreuung war daher besonders wichtig. Man hatte im Lager mindestens
25 französische und russische Sanitäter, darunter wohl auch Mediziner. Für die
erste Hilfe genügte das Krankenrevier im Lager, doch standen für die französischen
und die russischen Patienten je ein Klassenzimmer in der Luitpoldschule zur
Verfügung. Behandelt wurden die Gefangenen wie die deutschen Verwundeten von
Fachärzten, gepflegt und betreut haben sie ihre Landsleute.
Besondere Fälle wurden ins Militärlazarett bei der
Paulanerkirche oder auch ins städtische Marienkrankenhaus verlegt.
Zahnbehandlungen übernahm ein Amberger Dentist, für den man


Zahnstation Sanitätspersonal
ein eigenes Behandlungszimmer im Lager eingerichtet hatte.
Dank dieser medizinischen Betreuung blieb das Lager von Epidemien verschont,
die Sterbefälle waren verhältnismäßig sehr niedrig.
Es wurde bereits erwähnt, dass sich für die kath. Franzosen
und Polen rasch Seelsorger fanden. Die Lagerleitung konnte einen eigenen
Barackenraum als Kapelle zur Verfügung stellen, und Pfarrer Wagner fiel es
nicht schwer, ihn mit einem Altar, Bildern, Leuchtern, Figuren und den nötigen
Sakralgefäßen und Geräten auszustatten. Die Geistlichkeit von Amberg und
Benefiziat Kuttosovsky hielten regelmäßig Gottesdienst und waren stets erreichbar.
Würdig gestaltete man jede Beerdigung und jedes Mal erwies dabei ein höherer
bayerischer Offizier dem Toten die letzte Ehre.


Allerheiligen
1915
Bilder vom Allerseelentag 1915 zeigen, dass der Gottesdienst
vor dem Westeingang der neuen Friedhofsmauer an einem aufwändig aufgebauten und
geschmückten Freialtar gehalten werden musste, denn hunderte von Gefangenen
wollten am feierlichen Amt teilnehmen. Das Lagerorchester übernahm die
musikalische Umrahmung und begleitete Lieder und Choräle. Ministranten mit
Traglaternen begleiteten das Allerheiligste. Wahrscheinlich hatte die Pfarrei
St. Martin den Aufbau und die Gottesdienstgestaltung übernommen. Da ist es
verständlich, dass viele Kümmersbrucker zu diesem großen Feldgottesdienst kamen.
Von der Straße beim Knabenschulhaus aus, konnten sie das Geschehen am Altar und
die viele gläubigen Franzosen und Polen gut überschauen.
Wie üblich in kath. Landen folgte dem Gottesdienst der
Gräberbesuch im westlichen Teil des Friedhofs. Gleichförmig waren die
Soldatengräber, mit Blumen und Kränzen geschmückt, nicht nur jene für die
verstorbenen Freunde und Bekannten der Gefangenen, sondern auch für die hier
begrabenen französischen Zivilpersonen. Auch die Franzosengräber im Kathrinenfriedhof
hatten auffallenden Grabschmuck.
Selbstverständlich berücksichtigte die Lagerleitung auch die
Festtage der orthodoxen Christen, die sich unserer Kalenderreform im 16.
Jahrhundert nicht angeschlossen hatten.
So hat man von Seiten der Lagerverwaltung für Leib und Seele
der Lagerinsassen gesorgt. Ausreichende Verpflegung und ärztliche Betreuung
verhinderten Krankheiten, das Wirken der Geistlichen aber zeigte ihnen die Verbundenheit
mit der Gemeinschaft der Christen und dürfte vielen Trost in ihrer
kriegsbedingten Unfreiheit und der Trennung von Heimat und Familie gewesen
sein.
Aufbau und Erhaltung der Unterkünfte, die Gestaltung des
Lagers selbst, und die Verbesserung der Lebensbedingungen im Lager durch
gegenseitige Hilfe war allerdings eine Möglichkeit und Aufgabe der Gefangenen
selbst. Die vielen Handwerker konnten alle notwendigen Arbeiten bestens
verrichten.
So hatten die ersten Franzosen schon beim Aufbau des Lagers
mitgeholfen und zwar nicht nur Zimmerleute und Schreiner oder Mauerer. Steine
zerklopfen zum Einschottern der Wege war eine schwierige, aber ebenfalls notwendige
Arbeit. Eine Lagerstraße längs der Baracken hat man gärtnerisch sehr schön
gestaltet. Die neue Friedhofsmauer konnten Fachleute errichten und an
Hilfsarbeitern hat es nie gefehlt.
Den Schreinern, neun sind fotografiert worden, stand eine
Werkstatt zur Verfügung. An Türen, Fenstern, Stühlen, Bänken, Fensterläden war
immer etwas zu richten. Viel musste auch neu gefertigt werden. Das Foto zeigt,
dass selbst Schaukelpferde hier entstanden sind. Möglicherweise hat manches
Kind in und um Amberg so einen französischen Gaul unterm Christbaum gefunden.
Wichtig war die Arbeit der acht russischen Schuster, die ebenfalls eine
Werkstatt hatten.
Schreinerei Schuster
Für die Instandhaltung der Kleidung und Wäsche waren
Schneider nötig, und solche gab es im Lager sicher. Alle Bilder zeigen, dass
man sich im Lager zwar recht leger bewegte. Bei entsprechenden Anlässen aber
trat man in sehr ordentlichen Uniformen auf. Auf eine Sonderleistung der
Schneiderzunft im Lager ist noch hinzuweisen.
Ein Foto zeigt den Platz vorm „Coffier“, anscheinend das
Freiluftwartezimmer des Haarkünstlers, wo man sich bei frischem Kaffee
plaudernd die Zeit vertreiben konnte. Zu sehen ist auch der Frisörmeister und
seine drei Gehilfen, die den Gefangenen einen ordentlichen Haarschnitt
verpassten und vor allem die vielen, sehr unterschiedlichen Bärte angemessen
pflegten. Also ein großer, gut besuchter „französischer Friseursalon“ in
Amberg.


Brotzeit im
Lager Friseursalon
Obwohl einige Großwäschereien fürs Amberger Militär
arbeiteten, müssen gelegentlich Gefangene ihre schmutzigen Kleidungsstücke
selbst gewaschen haben, denn auf einigen Bildern hängt Wäsche an der Leine.
Es gab jedoch auch Freizeit, die jeder allein oder mit
andern nutzen konnte. Dafür stand zumindest für die Franzosen eine Bücherei mit
rund 400 Bänden zur Verfügung. In der Bibliothek war auch Gelegenheit für
Schach- und andere Brettspiele. Dort lagen auch französische Zeitungen aus
Belgien auf. Ob nach 1915 auch russische und schließlich italienische Blätter
erschienen, ist vorerst nicht nachweisbar. Einige Franzosen schafften es sogar,
für ihre Landsleute eine Lagerzeitung zu gestalten. Leider ist kein Exemplar zu
finden.
Bilder belegen, dass im Lager Fußball gespielt und gekegelt
wurde. Die Franzosen beschäftigten sich auch mit dem Boulespiel und sogar
Tennismatchs fanden im Lager statt.
Und auch das gehört zur Freizeitgestaltung. Kriegsgefangene
durften in größeren Gruppen durch die Umgebung Ambergs wandern, wie Fotos
beweisen. Der Mariahilfberg muss ein besonderes Wanderziel gewesen sein, sicher
hat man auch die Wallfahrtskirche aufgesucht, und einer der Patres war wohl in
der Lage, Einiges zur Geschichte von Wallfahrt, Kirchenbau und Kloster französisch
oder russisch zu erklären.
Fotografiert wurde am Kalvarienberg, der besonders die
Franzosen interessiert haben dürfte. Am Arc de Triomphe ist immerhin das
Treffen bei Amberg 1796 unter den siegreichen Schlachten der Zeit Napoleons
bzw. der französischen Revolution zu finden. Die Armee Jourdanes konnte sich
nämlich in großer Eile und unter Verlusten weiter zurückziehen. Allerdings
betrachten die Österreicher die Schlacht bei Amberg als ihren Sieg. Erzherzog
Karl konnte schließlich seine Truppen mit denen des Generals von Wartensleben
vereinigen, den Franzosen ziemliche Verluste zufügen und mit größerem Nachdruck
die Verfolgung fortsetzen.
Ein anderes Bild zeigt französische und russische Soldaten
bei einer Rast am Waldrand, der irgendwo außerhalb des Lagers zu suchen ist.
Mit einer Wanderung verbunden hat man die Feier des Pfingstfestes 1916. Man hat
im Freien, wo ist unbekannt, einen Platz hergerichtet für Konzertaufführungen,
und dorthin sind Hunderte von Gefangenen gewandert. Dicht gedrängt haben sich
Russen und Franzosen um die Musikkapelle gelagert. Das Programm ist unbekannt,
aber sicher blieb es nicht nur bei Instrumentalmusik. Man hat wahrscheinlich
auch gesungen und vielleicht sogar Theatralisches dargeboten. Leider hat uns
der Lagerfotograf nur drei solche Wanderungen und Aufenthalte im Freien
festgehalten. Es war für ihn allerdings umständlich mit Fotokasten, Stativ,
Glasplatten und Zubehör solche Ausflüge zu begleiten.
Das Bestreben, die Freizeit im Lager sinnvoll und
abwechslungsreich zu gestalten, veranlasste einige Theaterfreunde oder
Berufsschauspieler frühzeitig ein Liebhabertheater zu gründen. Was sie an
Stücken aufführten, ist leider in Vergessenheit geraten, aber man wagte sich
auch an Stücke für Sänger und Orchester, wie die Bilder zeigen.
Man muss mit viel Begeisterung begonnen haben, und viele
Mitgefangene als Mitarbeiter gewonnen haben. Die Lagerleitung hat das Vorhaben,
einen Theaterraum zu schaffen, vorbehaltslos unterstützt, und das Lagertheater
konnte sich wirklich sehen lassen.
Die erhöhte Bühne mit Soufleurkasten und Orchestergraben
fertigten Schreiner und Zimmerleute des Lagers. Maler gestalteten mit viel
Geschick die Bühnenfront und möglicherweise auch die Kulissen für mehrere Bühnenbilder.
Einiges, z. B. den Vorhang, dürfte die Lagerkommandantur besorgt haben.
Bühne und
Orchestergraben Russische
Schauspieler
Viele Kostüme könnten möglicherweise vom Amberger
Stadttheater stammen. Alte Zivilkleider gab es sicher auch in Amberg, aber wer
besorgte und bezahlte sie? Doch wie man zu den verschiedenen Klamotten auch
kam, ohne die Kunst geschickter Schneider hätte man niemals eine vornehme Herren-
und Damengesellschaft einkleiden können. Vollendet sind z. B. die drei lustigen
Freunde (Bild Seite 20)in den ihren Rollen entsprechenden Garderoben. Bewundern
muss man wiederum den Frisör und sein Gehilfen, die russische und französische
Krieger sogar in recht hübsche russische und französische Damen verwandeln
konnten. Und auch darüber darf man staunen, wie geschickt und passend die
„männliche Weiblichkeit“ bekleidet wurde. Elegant, von Hut und Perücke bis zu
den Stöckelschuhen. Selbst die Kaffeetassen sind kein Lagergeschirr. Woher
kamen bloß alle diese Theaterutensilien?
Ankündigung
einer Aufführung Schauspiel
mit Boxkampf
Diese Frage ist auch für das Instrumentarium des Orchesters
berechtigt. Man verfügte schließlich über ein Klavier, eine Bassgeige, mehrere
Trompeten, Klarinetten, Flöten, Trommeln und Geigen. Eigentlich hatte nur die Lagerkommandantur
die Mittel und Beziehungen, all diese Instrumente zu besorgen. Man verstand
allerdings zu improvisieren. Balalaika und Mandoline sind normalerweise nicht
im Orchestergraben zu finden. Können aber notfalls eine Harfe recht und schlecht
ersetzen.
Es waren wohl die Franzosen, die schon 1914, als noch die
französischen Zivilisten im Lager waren, mit dem Theaterspiel begannen.
Vielleicht haben die Französinnen sogar mit Kleidungsstücken ausgeholfen und
die Schneider bei ihrer Arbeit unterstützt. Als 1915 Russen im Lager
untergebracht wurden, verstärkten sie sofort die Musikantenschar. Lange dauerte
es dann nicht, bis im Lager zwei nationale Theatergruppen bestanden. Auch unter
den Russen (Bild Seite 20 rechts) waren Theaterfreunde, begeisterte
Laienspieler und vielleicht einige vom Fach. Ob die Italiener auch auf dem
Theater auftraten und sangen, ist nicht belegt, aber eigentlich doch
anzunehmen.
Drei lustige
Brüder Französische
„Damen“
Ein Gefangenenlager mit mindestens zwei nationalen
Theatergruppen, einem französisch-russischem Orchester und einem eigenen
Theater dürfte damals eine Seltenheit gewesen sein. So viel kulturelle
Aktivität gab es in Gefangenschaft sicher selten in Europa. Mehr ist aus den
Fotos zum Theater nicht zu erkennen, bzw. zu folgern. Dieses Theater und der
Theaterbetrieb im Amberger Kriegsgefangenenlager ist eine erstaunliche
Leistung, wobei die königlich-bayerische Kommandantur auch mit sich selbst
recht zufrieden sein konnte.
Die Amberger
Kriegsgefangenen wurden zu verschiedenen großen Bauvorhaben eingesetzt. Die
sehr umfangreichen Erdarbeiten bei der Kanalisierung der Amberger Altstadt wären
ohne ihr Mitwirken kaum möglich gewesen. Bis zu 4 m Tiefe mussten stellenweise
mit Pickel und Schaufel die Gräben für die Kanalrohre ausgehoben werden.
Transportiert wurden die Erdmassen mit Schubkarren, und der Aushub bildete in
den Straßen hohe Wälle. Wenn Amberg ab 1920 eine vorbildliche
Abwasserbeseitigung mit vielen Klärteichen für eine rentable Fischzucht hatte
und dazu ein Klärwerk dessen Biogas einen Elektrogenerator trieb, dann war dies
ebenfalls nur durch den Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen möglich geworden.


Arbeiten an den Geleisen vor dem Lager Arbeiten bei der
Vilsbegradigung
Bei den umfangreichen Erdarbeiten im Zusammenhang mit der
Begradigung der Vils zwischen Amberg und Drahthammer halfen ebenfalls die
Kriegsgefangenen. Der Fluss bildete damals unterhalb der Stadt weite Bögen und
Kehren, die seine Laufstrecke sehr verlängerten und seine Fließgeschwindigkeit
entsprechend verlangsamten. Im Frühjahr und bei starken Regenfällen, kam es
daher leicht zu Hochwasser in der Altstadt. Eine Hochwasserkatastrophe, wie man
sie 1909 in Amberg erlebt hatte, wollte man durch diese Baumaßnahmen vermeiden.
Im Rahmen all dieser Arbeiten wurde etwas oberhalb
Drahthammer von französischen Zimmerleuten ein fester Holzsteg über die Vils
gebaut. Dieser „Franzosensteg“ war lange Zeit die einzige Verbindung zwischen
Amberg rechts und links der Vils unterhalb der Altstadt von Amberg. Viele Jahre
verkürzte er für Siemensangehörige den Weg zur Arbeit. 1968 hat man ihn durch
die Perigeuxbrücke ersetzt.
Die Kriegsgefangenen wurden auch viel beim Straßenbau
beschäftigt, und auch die bayerische Eisenbahn forderte für Erdarbeiten
Arbeitskommandos an.
Wahrscheinlich waren Kriegsgefangene in Sulzbach-Rosenberg,
in der Maxhütte beschäftigt. Auch in Hirschau wird berichtet, dass im ersten
Weltkrieg Franzosen im Kaolinwerk tätig waren.
Wegen des Krieges fehlten besonders in der Landwirtschaft
männliche Arbeitskräfte, denn alles was wehrfähig war in Deutschland, leistete
irgendwo Kriegsdienst. Französische und russische Kriegsgefangene wurden daher in
benachbarten Orten untergebracht und arbeiteten auf den Bauernhöfen besonders
bei der Ernte mit.

Hopfenernte

Abschluss der
Hopfenernte
Dem Lagerfotografen mag die bäuerliche Tätigkeit, die sich
ja in Frankreich nicht wesentlich von der deutschen Landwirtschaft unterschied,
nicht sonderlich interessiert haben. Mehr Gefallen hat er an der Hopfenernte
gehabt. So hat er zum Abschluss dieser Zupferei ein Andenken für alle an der
Ernte Beteiligten geschaffen Bunt gemischt haben sich französische Kriegsgefangene,
Hopfenzupferinnen mit ihren Kindern und die Hofbesitzerin hinter vollen
Hopfenkörben gruppiert. Die Körbe sind geschmückt, und viele Zupfer haben Hopfenranken
an den Kleidern. Ein weiteres Bild zeigt die Einfuhr des letzten Hopfenranken.
Die Pferde sind auch entsprechend geschmückt und die französischen Hopfenzupfer
machen einen recht heiteren Eindruck. Anzunehmen ist, dass auch sie sich aufs
Hopfenmahl freuen können.
In welchen Orten die Kriegsgefangenen bei der Hopfenernte
tätig waren, ist unbekannt. Für Schmidmühlen darf man das annehmen. Denn jener
Franzosen, der in Schmidmühlen begraben ist, hat sicher dort gearbeitet, und in
Schmidmühlen wurde damals noch viel Hopfen angebaut. Möglicherweise war dies
auch in und um Sulzbach der Fall. Auch dort wurde ein französischer
Kriegsgefangener beerdigt.
In vielen Orten entwickelte sich ein recht gutes Verhältnis
zwischen den Bauernfamilien und ihren französischen Helfern. Man hat nicht nur
zusammen gearbeitet, sondern auch zusammen gegessen und getrunken und sich
gegenseitig schätzen gelernt, wie ein weiteres Bild zeigt. Im Garten eines
Bauernhauses hat es der Lagerfotograf aufgenommen. Bauer und Bäuerin und zwei
kleine Mädchen stehen inmitten einer Schar französischer Kriegsgefangener, mit
denen sich die Kinder vertrauensvoll beschäftigen. Vielleicht ist das Pferdchen
ein Mitbringsel aus der französischen Schreinerei. Von einem Nationalhass ist
auf dem Bild nichts zu erkennen, und es ist durchaus möglich, dass hier
Verbindungen geknüpft wurden, die auch nach dem Krieg weiter bestanden.

Bauernfamilie
mit ihren Franzosen
Leider hat uns der Lagerfotograf keine Bilder mehr für die
Kriegsjahre 1917 /18 hinterlassen. Wir dürfen annehmen oder hoffen, dass sich
die Verhältnisse im Amberger Lager nicht negativ entwickelt haben.
Am 9.11.1918 endete der blutige Völkerkampf. Deutschland
hatte den Krieg gegen nahezu ¾ der übrigen Welt verloren. Ehe die Franzosen im
Laufe des Dezembers das Lager verließen, um in ihre Heimat zurückzukehren,
haben sie noch die Namen ihrer in der Gefangenschaft verstorbenen Kameraden auf
der Nordseite des Obelisken eingemeißelt. 14 von ihnen waren im Kathrinenfriedhof,
einer in Schmidmühlen, einer in Sulzbach und 14 in Kümmersbruck beerdigt
worden. Der Spruch unter diesem Namen lautet: „Brüder der Armee, Frankreich
erinnert sich euer, vereint im Gedenken an seine auf dem Felde der Ehre
gefallenen Söhne“.
Ab 1920 wurden alle Franzosen exhuminiert und nach
Frankreich überführt. Wahrscheinlich hat man auch die hier beerdigten sechs
italienischen Soldaten in ihre Heimat gebracht. Nur die 15 russischen Soldaten
liegen noch im Kümmersbrucker Friedhof. Die kyrillische Inschrift hat Prof.
Grasser von Köfering übersetzt:
Ruhet ihr jungen
Freunde,
ruhet in ewigem Frieden,
ihr habt ein gutes Gedenken
und ewige Ruhe verdient.
Das Lager, alle Baracken und sonstigen Bauwerke wurden
bereits 1919 abgebaut. Was man davon verwenden konnte, brachte man nach Belgien
ins ehemalige Kriegsgebiet, wo sie für Arbeiter beim Wiederaufbau des Landes
als Unterkünfte verwendet wurden. Das Lagergelände wurde 1933 ein Teil des
Heeresnebenzeugamts, das 1945 bei zwei Fliegerangriffen stark zerstört wurde,
wobei viele russische Kriegsgefangene und deutsche Zivilangestellte kurz vor
Kriegsende umkamen. 1950, fünf Jahr nach Kriegsende begann man in dem
Trümmergelände mit dem ersten großen Wohnungsbauprogramm Ambergs. Im Lauf von
vier Jahren wurden 569 Wohnungseinheiten erstellt. Rund 2000 aus Osteuropa
geflüchtete Russen, Ukrainer, Letten, Litauer und besonders Polen fanden hier
neben den Deutschen ein Unterkommen, viele sogar eine neue Heimat.
Wo 1914 – 18 Franzosen, Russen und Italiener als deutsche
Kriegsgefangene untergebracht waren, entstand 1950 ein neues Stadtviertel
Ambergs. „Am Bergsteig“ ist’s genannt, mit Bewohnern aus unterschiedlichsten
Nationen, die sich im Laufe der Jahre nicht nur verständigen konnten, sondern
in jeder Hinsicht verstanden. Noch heute besteht hier noch immer eine polnische
Pfarrei. An das Kriegsgefangenenlager von 1914 – 1919 erinnert hier nichts
mehr.
So blieb nur der Kümmersbrucker Gedenkobelisk mit den Namen
von 60 französischen Zivilpersonen, Frauen, Greisen und Kindern, den Daten von
30 französischen, 15 russischen und 6 italienischen Kriegsgefangenen und dem
Reliefbild des einstigen Lagers, als letzter Hinweis auf das große Gefangenenlager
des Weltkriegs 1914 – 1918. Dass in diesem Lager zu jener Zeit Menschlichkeit
und Rücksichtnahme noch Gewicht hatten, erfährt man, wenn man sich, angeregt
von diesem anfangs fast rätselhaften Stein, mit diesem Lager befasst. Man
findet es erfreulich bis bewundernswert, wie man sich selbst gegen „Feinde“
benahm und Humanität und Nächstenliebe walten ließ.
Erschüttert ist man, wenn man dagegen sieht, was inzwischen
an Grausamkeiten und Unmenschlichem bei kriegerischen Auseinandersetzungen
nahezu alltäglich wurde. – Es könnte auch anders sein, wie dieser Rückblick auf
die Geschichte des Kriegsgefangenenlagers beweist.

Relilef des Lagers auf der Vorderseite des Mahnmals.
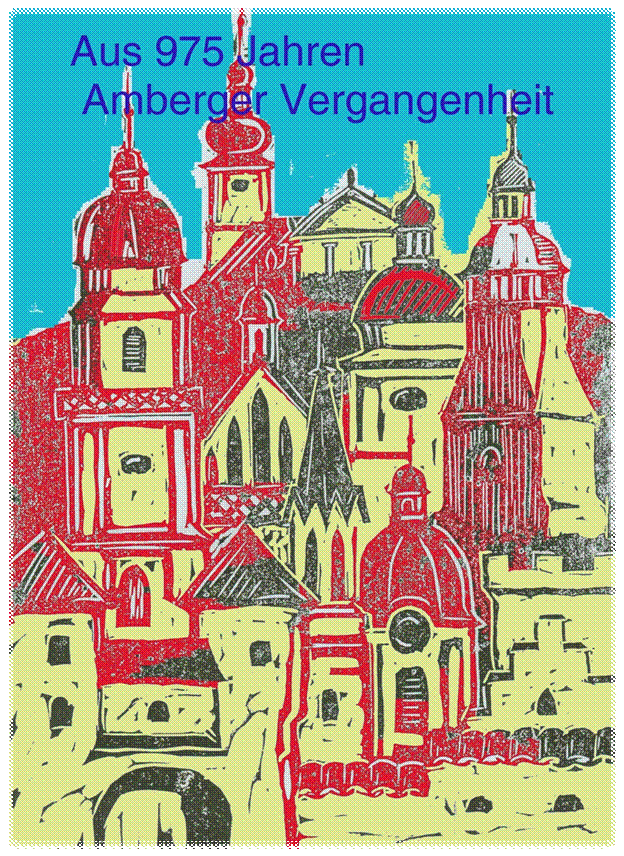




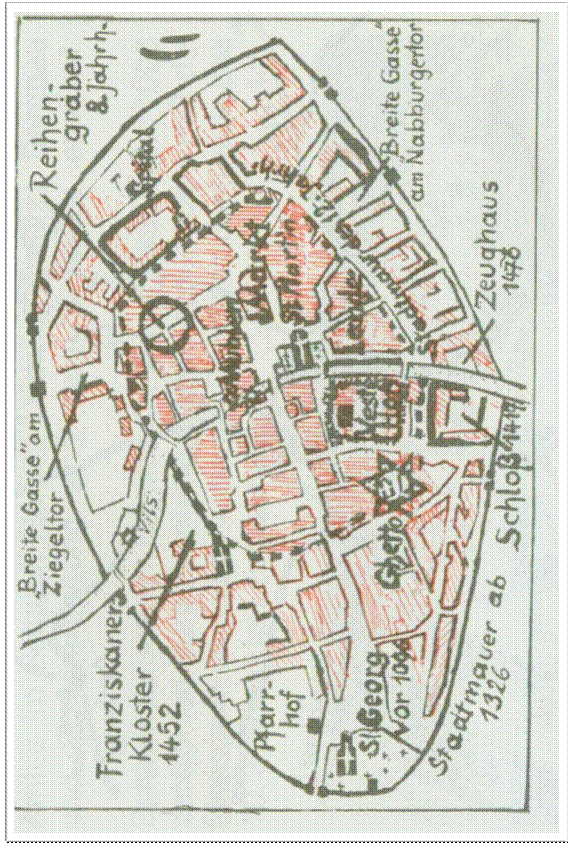
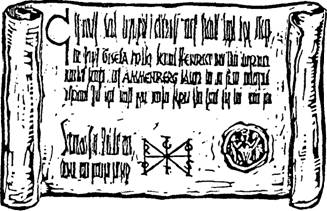 Kanzler
Burchard unterschrieben, man hat das kaiserliche Siegel aufgedrückt und Kaiser
Konrad hat sein Namenszeichen dazusetzen lassen.
Kanzler
Burchard unterschrieben, man hat das kaiserliche Siegel aufgedrückt und Kaiser
Konrad hat sein Namenszeichen dazusetzen lassen. 
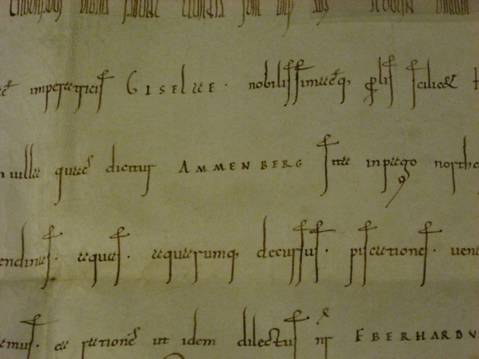


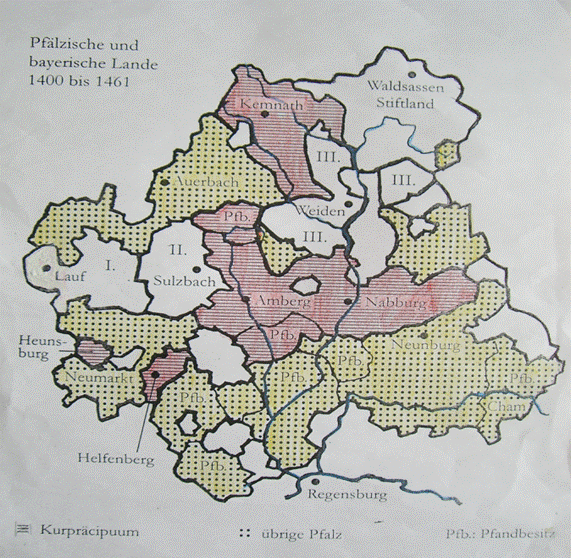
 An sich hätte
Friedrich sich als versöhnlicher, großzügiger Sieger zeigen können. Doch Unterwerfung
und Huldigung genügten ihm nicht. „Wutentbrannt war er gegen Amberg gezogen“,
schreibt Veit Arnpeck, der 1454 in Amberg studierte und diese Tage miterlebte
und später beschrieb. Die Zuträger hatten dem Kurfürsten reichlich Material
geliefert. Allerdings waren viele der Angezeigten aus der Stadt geflohen,
dennoch fanden die Häscher noch 60 Bürger, gegen die am 4. Februar verhandelt
werden konnte. Die Anklage fußte ausschließlich auf den geheimen Mitteilungen
der Spitzel Friedrichs. Bei der Vielzahl der Beschuldigten konnte von langen
Verhandlungen nicht die Rede sein. Verteidiger standen den Angeklagten nicht
zur Verfügung.
An sich hätte
Friedrich sich als versöhnlicher, großzügiger Sieger zeigen können. Doch Unterwerfung
und Huldigung genügten ihm nicht. „Wutentbrannt war er gegen Amberg gezogen“,
schreibt Veit Arnpeck, der 1454 in Amberg studierte und diese Tage miterlebte
und später beschrieb. Die Zuträger hatten dem Kurfürsten reichlich Material
geliefert. Allerdings waren viele der Angezeigten aus der Stadt geflohen,
dennoch fanden die Häscher noch 60 Bürger, gegen die am 4. Februar verhandelt
werden konnte. Die Anklage fußte ausschließlich auf den geheimen Mitteilungen
der Spitzel Friedrichs. Bei der Vielzahl der Beschuldigten konnte von langen
Verhandlungen nicht die Rede sein. Verteidiger standen den Angeklagten nicht
zur Verfügung.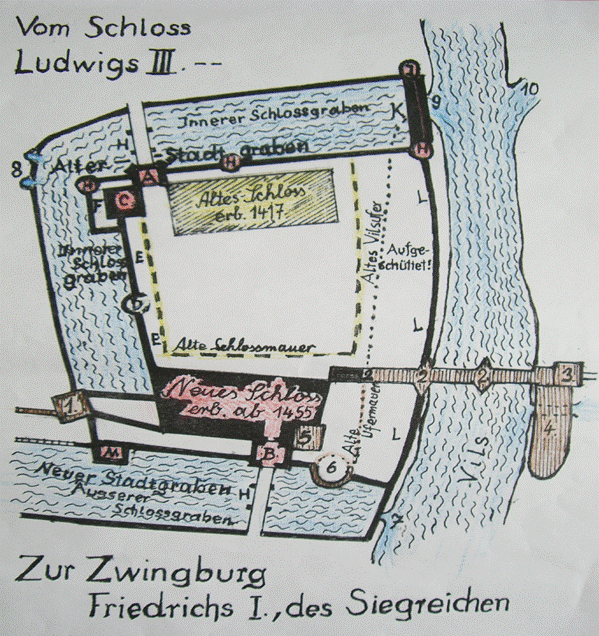
 Amberg
ist die einzige kurpfälzische Stadt, deren militärische Hilfe die beiden
Chronisten Friedrichs erwähnenswert fanden, und nur Martin Mertz und Jörg
Gutzinofen haben sie sogar persönlich gerühmt.
Amberg
ist die einzige kurpfälzische Stadt, deren militärische Hilfe die beiden
Chronisten Friedrichs erwähnenswert fanden, und nur Martin Mertz und Jörg
Gutzinofen haben sie sogar persönlich gerühmt. Links des Hauptportals
von St. Martin ist dem Mauerwerk eine auffallend schöne Steinplatte aus rotem
Marmor eingefügt. Ungewöhnlich ist schon ihr Breitformat. Rundbogenarkaden
gliedern die Fläche, wobei das Mittelfeld die doppelte Breite eines der übrigen
vier Felder hat und zudem durch einen „Eselsrücken" noch vergrößert ist.
Eine zeitlos wirkende Kreuzigungsgruppe bildet die Mitte des Steines. In den
rechts und links anschließenden Arkaden stehen die Bischöfe St. Nikolaus und
St. Wolfgang. Die äußeren Felder füllen prächtig gestaltete Wappen.
Links des Hauptportals
von St. Martin ist dem Mauerwerk eine auffallend schöne Steinplatte aus rotem
Marmor eingefügt. Ungewöhnlich ist schon ihr Breitformat. Rundbogenarkaden
gliedern die Fläche, wobei das Mittelfeld die doppelte Breite eines der übrigen
vier Felder hat und zudem durch einen „Eselsrücken" noch vergrößert ist.
Eine zeitlos wirkende Kreuzigungsgruppe bildet die Mitte des Steines. In den
rechts und links anschließenden Arkaden stehen die Bischöfe St. Nikolaus und
St. Wolfgang. Die äußeren Felder füllen prächtig gestaltete Wappen.
 Mehr und bessere
Gelegenheiten zu gewinnbringender Geldanlage als Weiden bot damals die
kurpfälzische Residenzstadt Amberg. 1444 bewarben sich die Klopfers um das Amberger
Bürgerrecht. Das kostete nicht viel, Bürgermeister und Rat Ambergs freuten sich
über diesen Neubürger, der fortan sein großes Vermögen an der Vils versteuern
wollte.
Mehr und bessere
Gelegenheiten zu gewinnbringender Geldanlage als Weiden bot damals die
kurpfälzische Residenzstadt Amberg. 1444 bewarben sich die Klopfers um das Amberger
Bürgerrecht. Das kostete nicht viel, Bürgermeister und Rat Ambergs freuten sich
über diesen Neubürger, der fortan sein großes Vermögen an der Vils versteuern
wollte. Reichtum verpflichtet.
Wie andere angesehene Bürger hat auch Hans Klopfer das seine beigetragen zum
Bau von St. Martin, zu dieser bewundernswerten Gemeinschaftsleistung der
Amberger. 1457 stiftete er zudem noch eine „ewige Messe" zu Ehren des
heiligen Wolfgangs, die auf dem Nikolausaltar in der Klopferkapelle zu lesen
war. Dem Seelenheil der Klopferschen Eheleute und deren Vorfahren, besonders aber der Seelenruhe des Ulrich
Markhart, des ersten Mannes der Klopferin, ist diese Stiftung gewidmet.
Reichtum verpflichtet.
Wie andere angesehene Bürger hat auch Hans Klopfer das seine beigetragen zum
Bau von St. Martin, zu dieser bewundernswerten Gemeinschaftsleistung der
Amberger. 1457 stiftete er zudem noch eine „ewige Messe" zu Ehren des
heiligen Wolfgangs, die auf dem Nikolausaltar in der Klopferkapelle zu lesen
war. Dem Seelenheil der Klopferschen Eheleute und deren Vorfahren, besonders aber der Seelenruhe des Ulrich
Markhart, des ersten Mannes der Klopferin, ist diese Stiftung gewidmet.

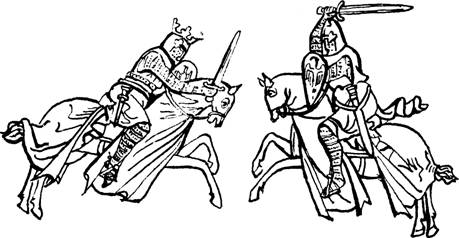






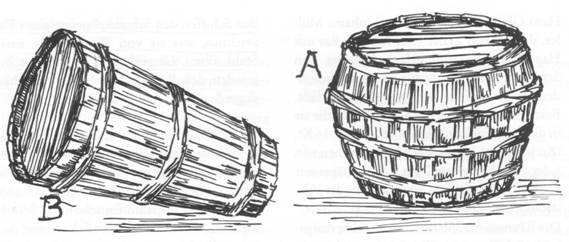


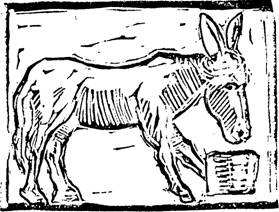 Was
soll da für ein Kunstwerk entstehen? Die Leute blieben stehen und rätselten
herum und fragten. Der Steinmetzmeister blieb stumm. Er verriet nichts. Aber
dann sahen sie doch, was da allmählich aus dem Stein herauskam: Ein Esel.
Was
soll da für ein Kunstwerk entstehen? Die Leute blieben stehen und rätselten
herum und fragten. Der Steinmetzmeister blieb stumm. Er verriet nichts. Aber
dann sahen sie doch, was da allmählich aus dem Stein herauskam: Ein Esel.



 Der alte Stadtgraben führt nun kein Wasser
mehr, dafür hat man schöne Spazierwege angelegt, die an den alten Mauern und Türmen,
aber auch an hübschen Baum- und Buschgruppen vorbeiführen. Aus den Befestigungsanlagen
der „festesten Fürstenstadt“ sind Stätten der Erholung geworden.
Der alte Stadtgraben führt nun kein Wasser
mehr, dafür hat man schöne Spazierwege angelegt, die an den alten Mauern und Türmen,
aber auch an hübschen Baum- und Buschgruppen vorbeiführen. Aus den Befestigungsanlagen
der „festesten Fürstenstadt“ sind Stätten der Erholung geworden.



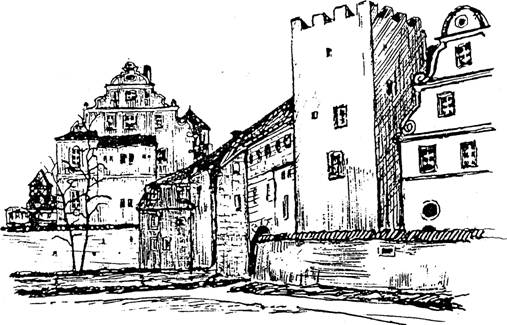
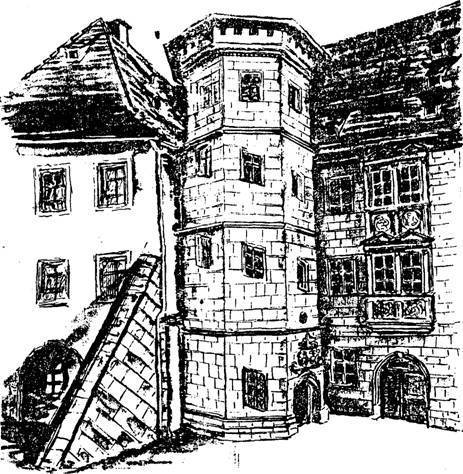





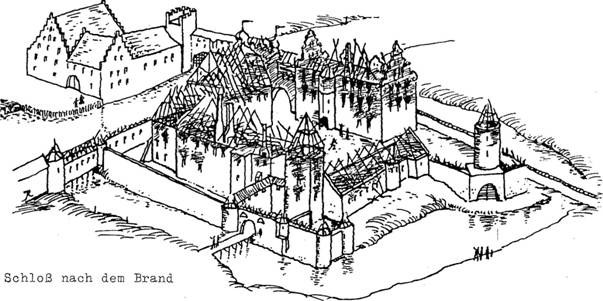
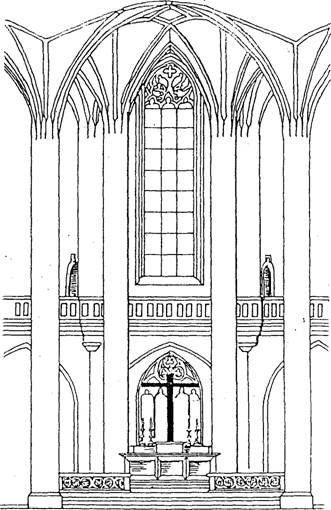
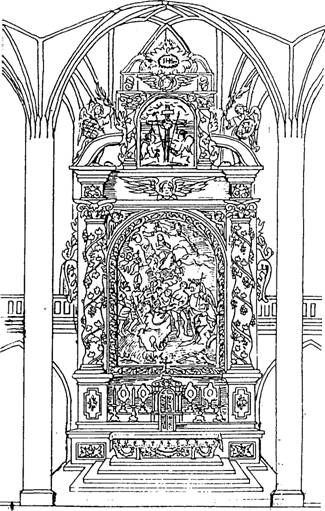

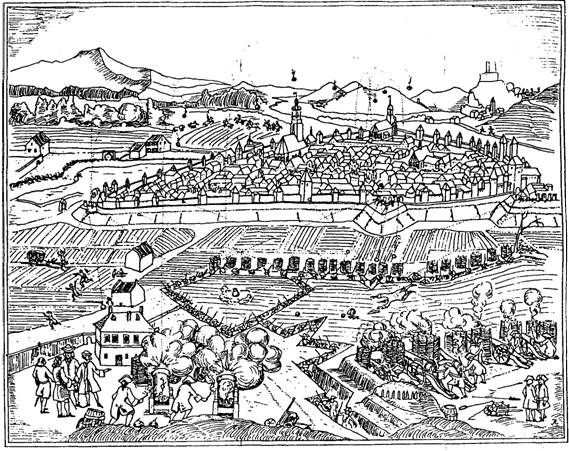

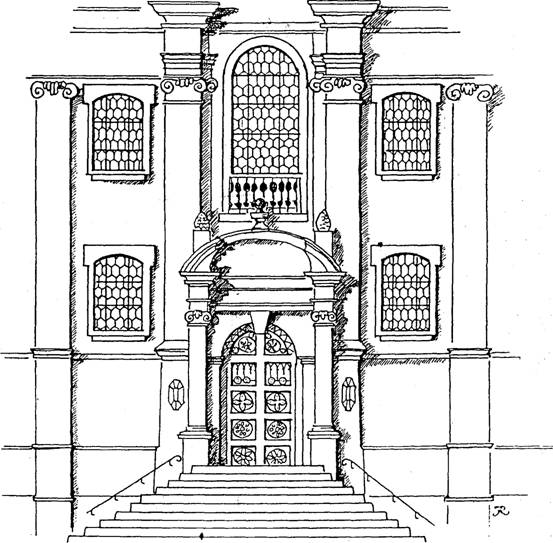
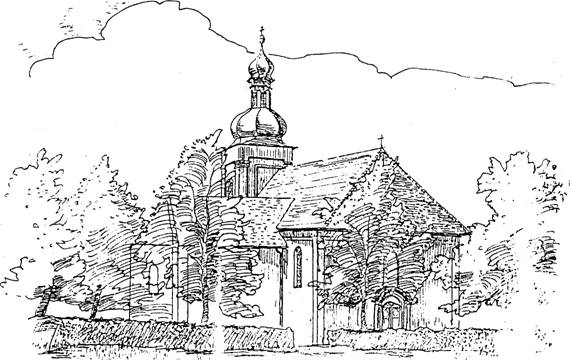

 Nach der
Vollendung des Neubaus der jetzigen Sebastianskirche erfahren wir nichts mehr
von Hans-Georg Haider. Auf dem Gedenkstein über dem Kirchenportal werden die
Leistungen des Ordinariats, des Stadtrats und der Regierung gerühmt. Haiders
Nach der
Vollendung des Neubaus der jetzigen Sebastianskirche erfahren wir nichts mehr
von Hans-Georg Haider. Auf dem Gedenkstein über dem Kirchenportal werden die
Leistungen des Ordinariats, des Stadtrats und der Regierung gerühmt. Haiders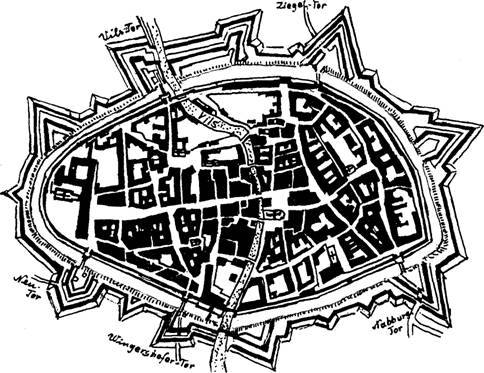
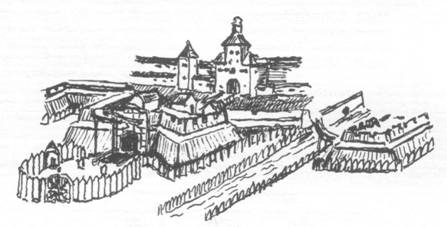

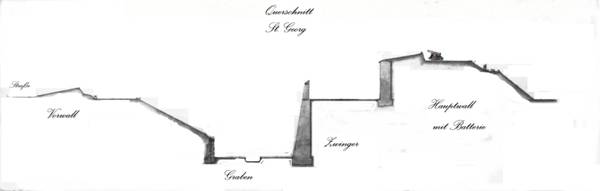


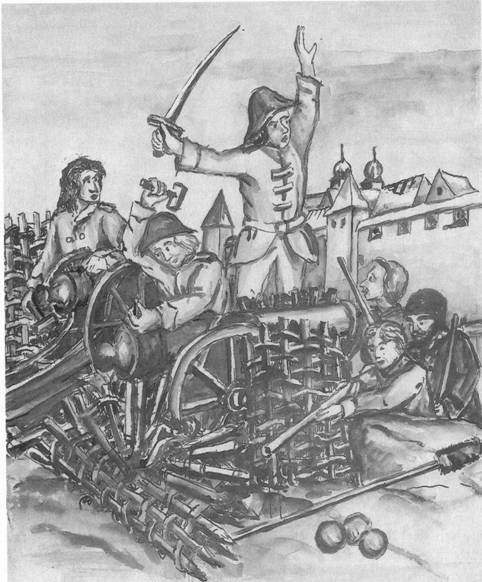

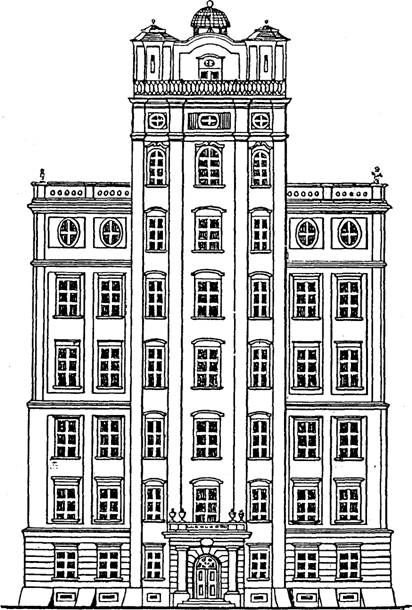
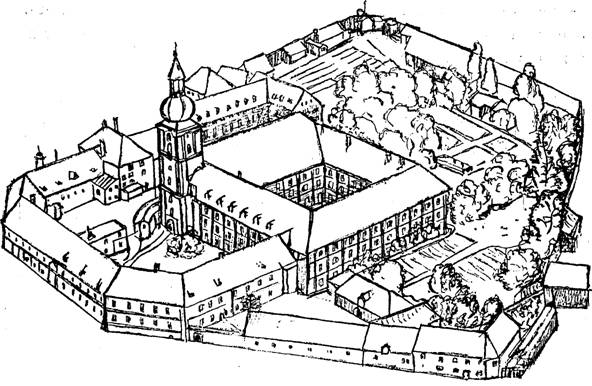


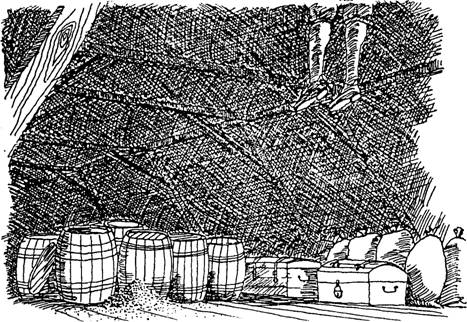

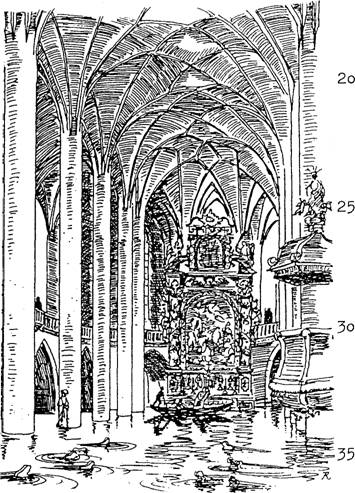
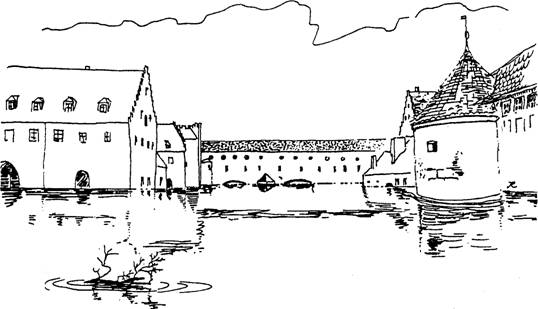
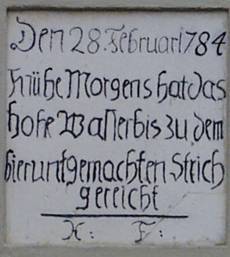
 Über die weiteren Ereignisse
schrieb der Pater noch nieder, dass man im Kloster über 14 Tage täglich an der „Ausschöpfung
der Keller“ arbeitete: „Dabei waren 10 - 15, anfangs sogar 20 - 25 Personen
beschäftigt. Im Bierkeller und auch in der neuen Gruft wurde eine Hauptmauer beschädigt,
es wurden auch einige Gräber geöffnet. Die Kessel im Waschhaus, in der Walk und
im Branntweinhäusl hat das Wasser herausgerissen, alles musste wieder repariert
werden. Die Kirche und der Kreuzgang sind zwar von der Überschwemmung befreit
geblieben, doch sind in der Kirche die Altäre St. Michaelis und Mater Dolorosa
und auch alle alten Totengrüfte samt dem Kirchenpflaster und auch das Gewölbe
beim Eingang der Pforten nachgesunken. Das muss nun alles neu aufgeschüttet
und gepflastert werden. An einigen Orten ist der Kreuzgang, das Refektorium,
die Sakristei und das Pflaster in der Kirche eingesunken. Die Gartenmauer ist
sowohl innen als auch außen durch das Wasser sehr beschädigt worden und muss
ebenfalls mit großen Kosten ausgebessert werden. Die Fischbehältnisse hat das
Wasser mit sich fortgeführt.“
Über die weiteren Ereignisse
schrieb der Pater noch nieder, dass man im Kloster über 14 Tage täglich an der „Ausschöpfung
der Keller“ arbeitete: „Dabei waren 10 - 15, anfangs sogar 20 - 25 Personen
beschäftigt. Im Bierkeller und auch in der neuen Gruft wurde eine Hauptmauer beschädigt,
es wurden auch einige Gräber geöffnet. Die Kessel im Waschhaus, in der Walk und
im Branntweinhäusl hat das Wasser herausgerissen, alles musste wieder repariert
werden. Die Kirche und der Kreuzgang sind zwar von der Überschwemmung befreit
geblieben, doch sind in der Kirche die Altäre St. Michaelis und Mater Dolorosa
und auch alle alten Totengrüfte samt dem Kirchenpflaster und auch das Gewölbe
beim Eingang der Pforten nachgesunken. Das muss nun alles neu aufgeschüttet
und gepflastert werden. An einigen Orten ist der Kreuzgang, das Refektorium,
die Sakristei und das Pflaster in der Kirche eingesunken. Die Gartenmauer ist
sowohl innen als auch außen durch das Wasser sehr beschädigt worden und muss
ebenfalls mit großen Kosten ausgebessert werden. Die Fischbehältnisse hat das
Wasser mit sich fortgeführt.“ welches ungefähr von einer
Stiege ins Wasser fiel. Der Herr bewahre in Zukunft unsere Vaterstadt vor solch
großem Übel.“
welches ungefähr von einer
Stiege ins Wasser fiel. Der Herr bewahre in Zukunft unsere Vaterstadt vor solch
großem Übel.“ 1662 heißt es, dass am
25. Januar die Vils um 10 Werkschuh (das sind 2,8 m) über ihren gewöhnlichen
Lauf gestiegen ist. Den Bewohnern der Unteren Georgenstraße musste man mit
Kähnen die Lebensmittel bringen.
1662 heißt es, dass am
25. Januar die Vils um 10 Werkschuh (das sind 2,8 m) über ihren gewöhnlichen
Lauf gestiegen ist. Den Bewohnern der Unteren Georgenstraße musste man mit
Kähnen die Lebensmittel bringen.

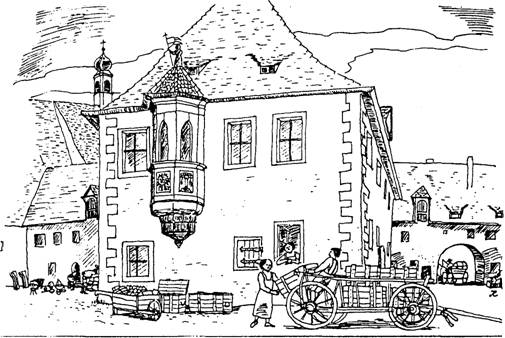
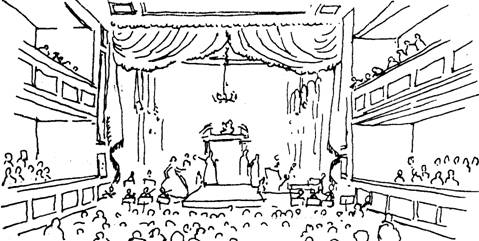
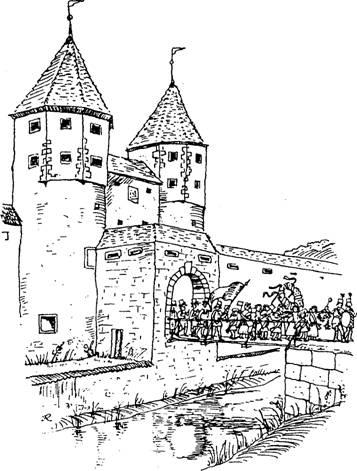
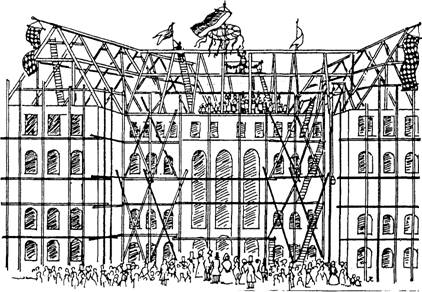

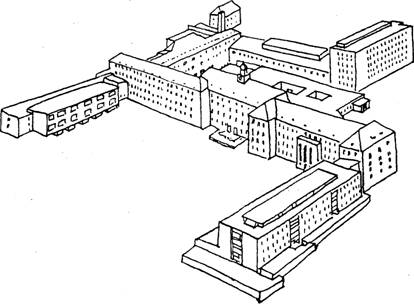
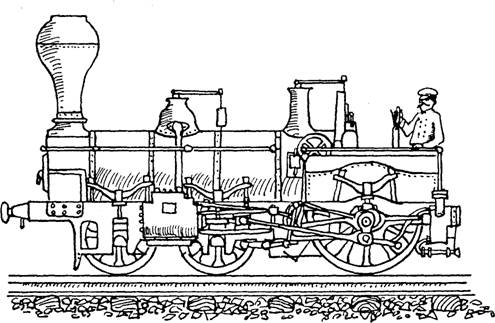

 Um 1550 zählte Amberg 42 öffentliche Schöpf-
oder Ziehbrunnen, aus denen sich jedermann nach Belieben bedienen konnte. Die „Löffelgasse“
erinnert noch an einen solche Straßenbrunnen, an den „Löffelbrunnen“. Wahrscheinlich
diente hier eine große Kelle zum Wasserschöpfen. Ansonsten hatten alle diese
Brunnen eiserne Ketten und feste Kübel.
Um 1550 zählte Amberg 42 öffentliche Schöpf-
oder Ziehbrunnen, aus denen sich jedermann nach Belieben bedienen konnte. Die „Löffelgasse“
erinnert noch an einen solche Straßenbrunnen, an den „Löffelbrunnen“. Wahrscheinlich
diente hier eine große Kelle zum Wasserschöpfen. Ansonsten hatten alle diese
Brunnen eiserne Ketten und feste Kübel. 24. In der unteren Hälfte der Unteren
Nabburger Gasse
24. In der unteren Hälfte der Unteren
Nabburger Gasse erneuerte das
gesamte Wasserleitungsnetz.
erneuerte das
gesamte Wasserleitungsnetz. 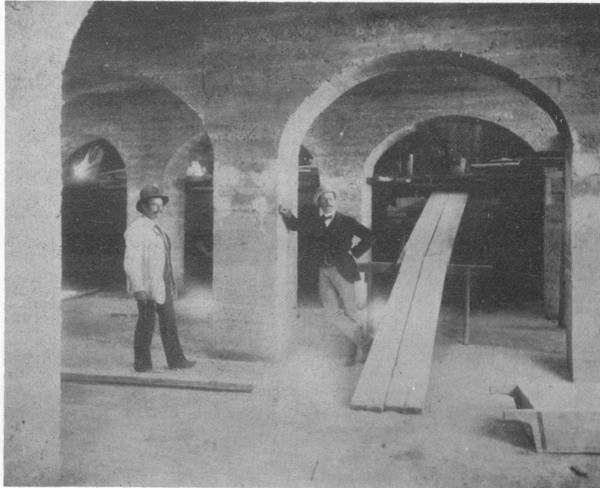
 erreichen.
In drei Absätzen, muss an solchen Stellen der Graben eingetieft werden, und
gewaltige Wälle wachsen dann links und rechts des Grabens empor. Hunderte von
Arbeitern darunter viele Italiener, sind mit Pickel und Schaufel und
Schubkarren tätig. Endlich kann man die schweren Rohre aus Gusseisen verlegen.
erreichen.
In drei Absätzen, muss an solchen Stellen der Graben eingetieft werden, und
gewaltige Wälle wachsen dann links und rechts des Grabens empor. Hunderte von
Arbeitern darunter viele Italiener, sind mit Pickel und Schaufel und
Schubkarren tätig. Endlich kann man die schweren Rohre aus Gusseisen verlegen. Am 3. Oktober 1893 kann die
„Hochdruckwasserleitung Amberg“ in Betrieb genommen werden. Mit einem Festgottesdienst
in der Martinskirche beginnt der ereignisreiche Tag. Die Schulkinder ziehen
anschließend singend hinaus zum Hochbehälter. Gegen 11 Uhr erscheint dort der
Regierungspräsident von Ziegler aus Regensburg. Die Herren der Stadtverwaltung
und alle für den Bau Verantwortlichen finden sich ein, und dann werden die für
ein solches Ereignis als angemessen empfundenen Reden gehalten. Sodann öffnet
Herr Kullmann die Ventile und in breiten Fächern strömt aus drei Trichteröffnungen
das Wasser in den großen, unterirdischen Raum, der mit seinen Pfeilern und
Gewölben einer alten Kirche gleicht.
Am 3. Oktober 1893 kann die
„Hochdruckwasserleitung Amberg“ in Betrieb genommen werden. Mit einem Festgottesdienst
in der Martinskirche beginnt der ereignisreiche Tag. Die Schulkinder ziehen
anschließend singend hinaus zum Hochbehälter. Gegen 11 Uhr erscheint dort der
Regierungspräsident von Ziegler aus Regensburg. Die Herren der Stadtverwaltung
und alle für den Bau Verantwortlichen finden sich ein, und dann werden die für
ein solches Ereignis als angemessen empfundenen Reden gehalten. Sodann öffnet
Herr Kullmann die Ventile und in breiten Fächern strömt aus drei Trichteröffnungen
das Wasser in den großen, unterirdischen Raum, der mit seinen Pfeilern und
Gewölben einer alten Kirche gleicht.































